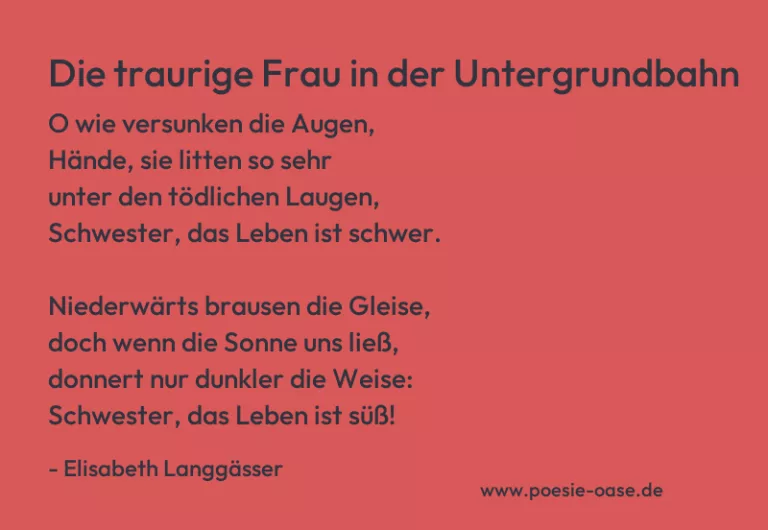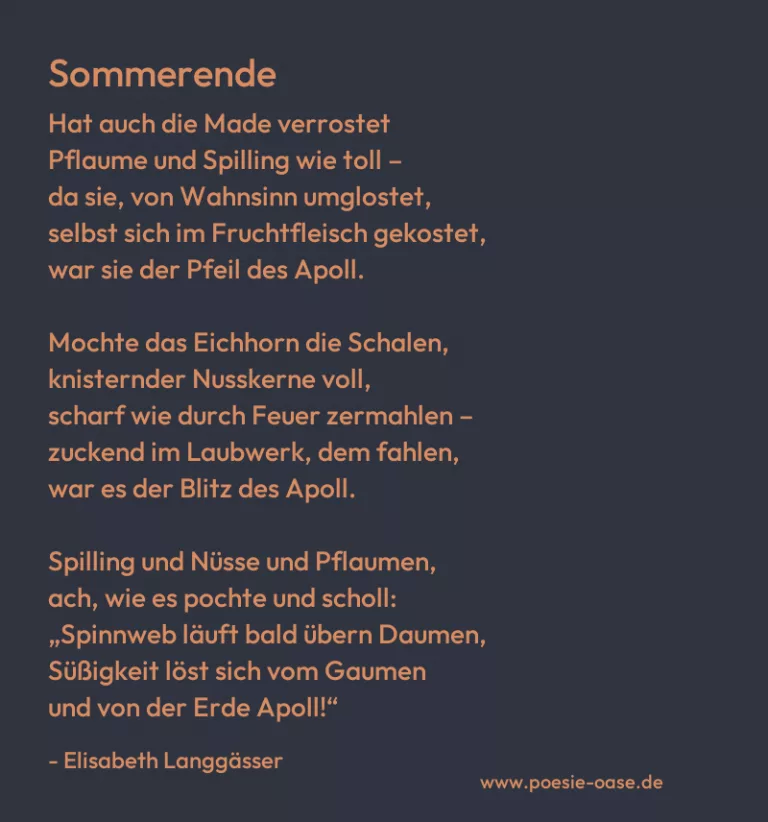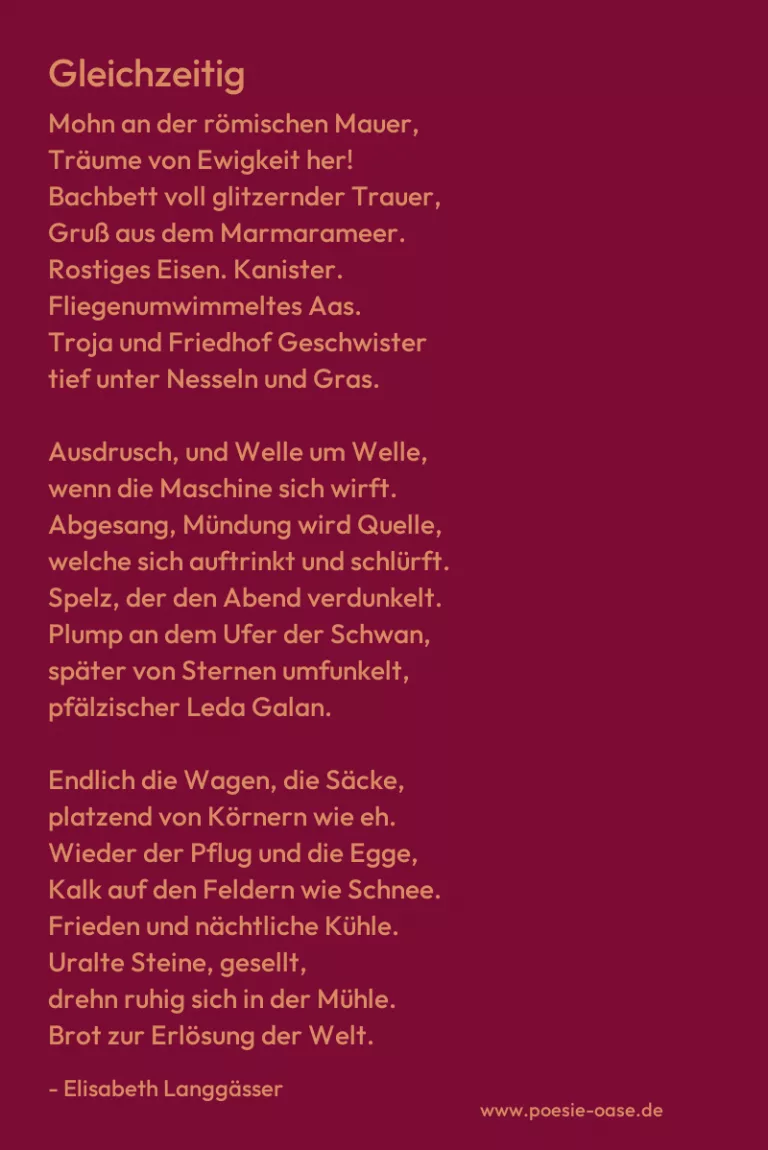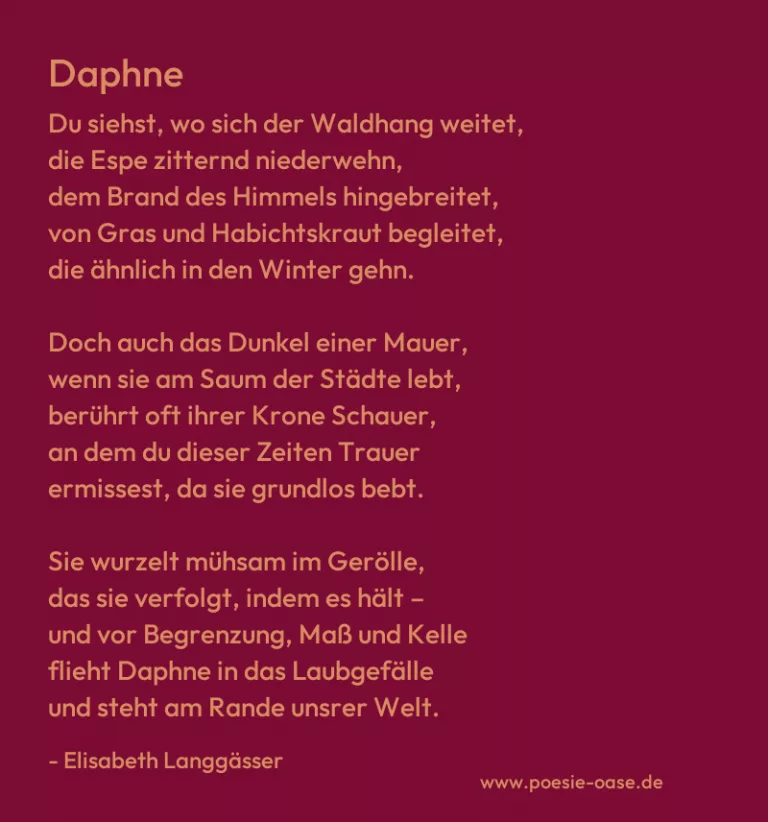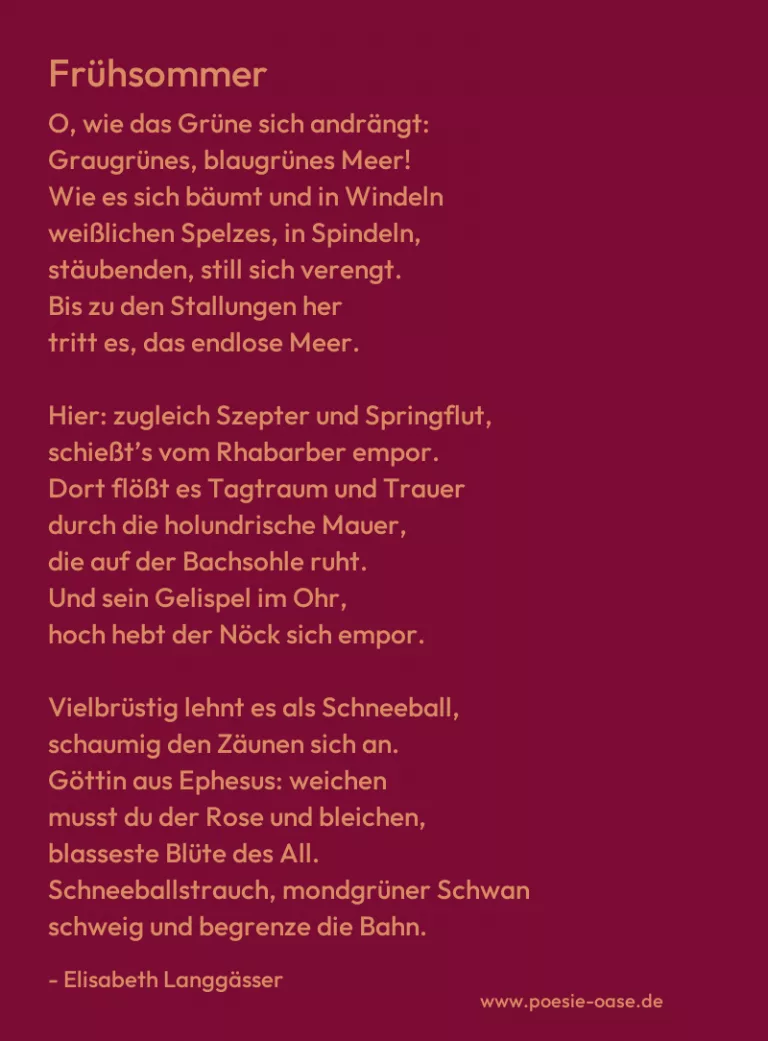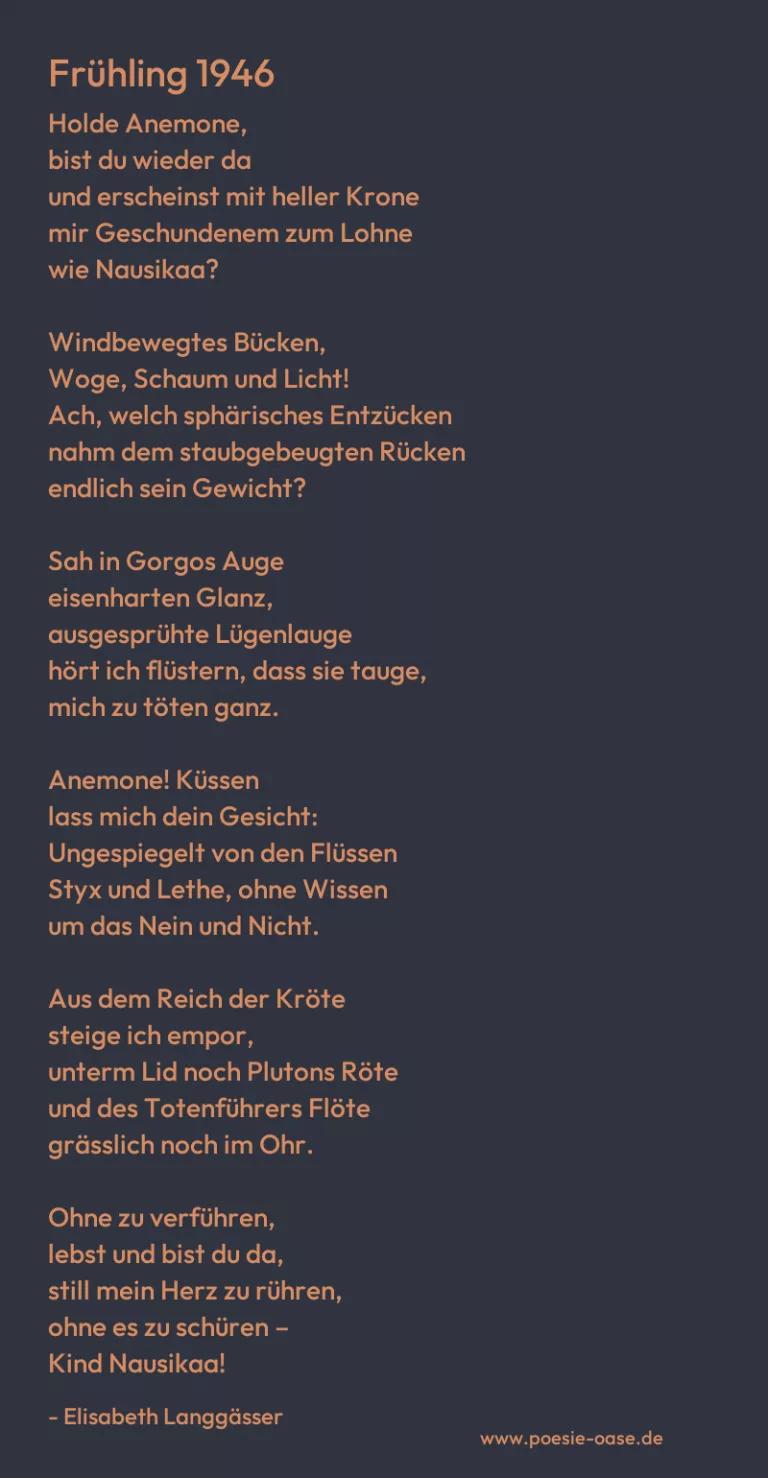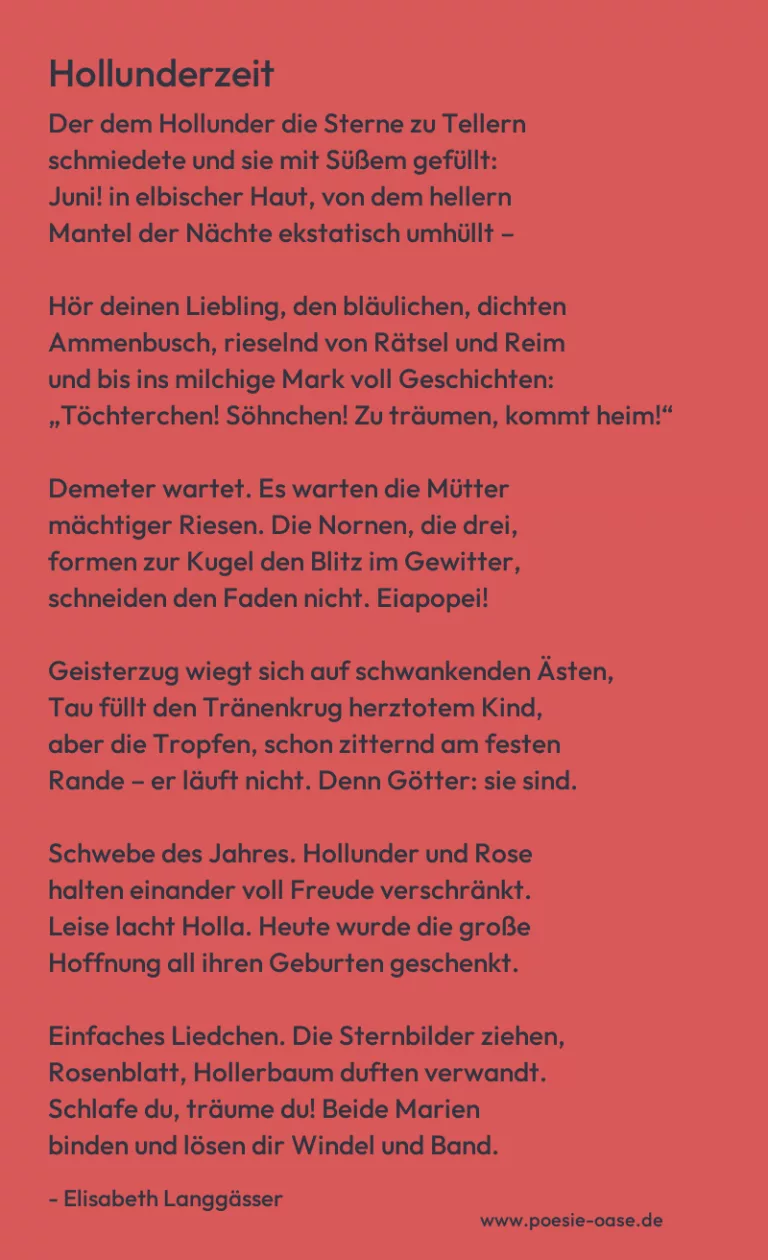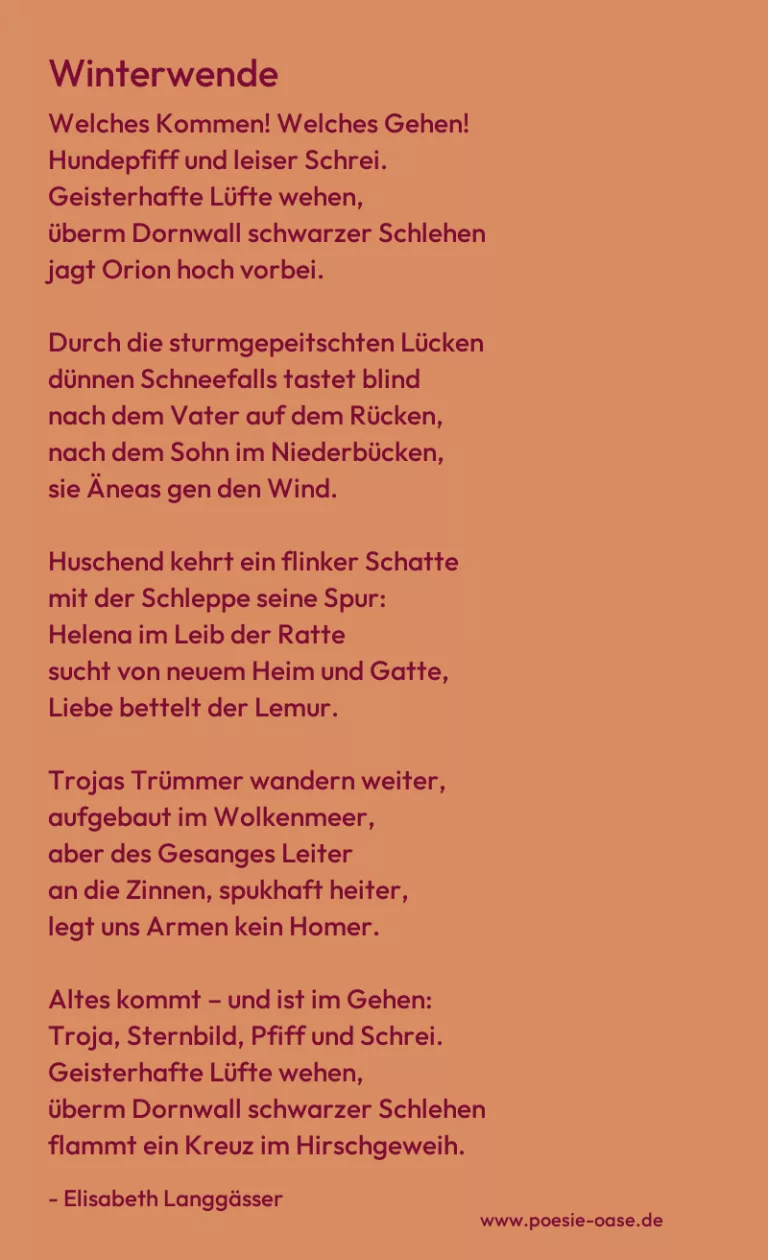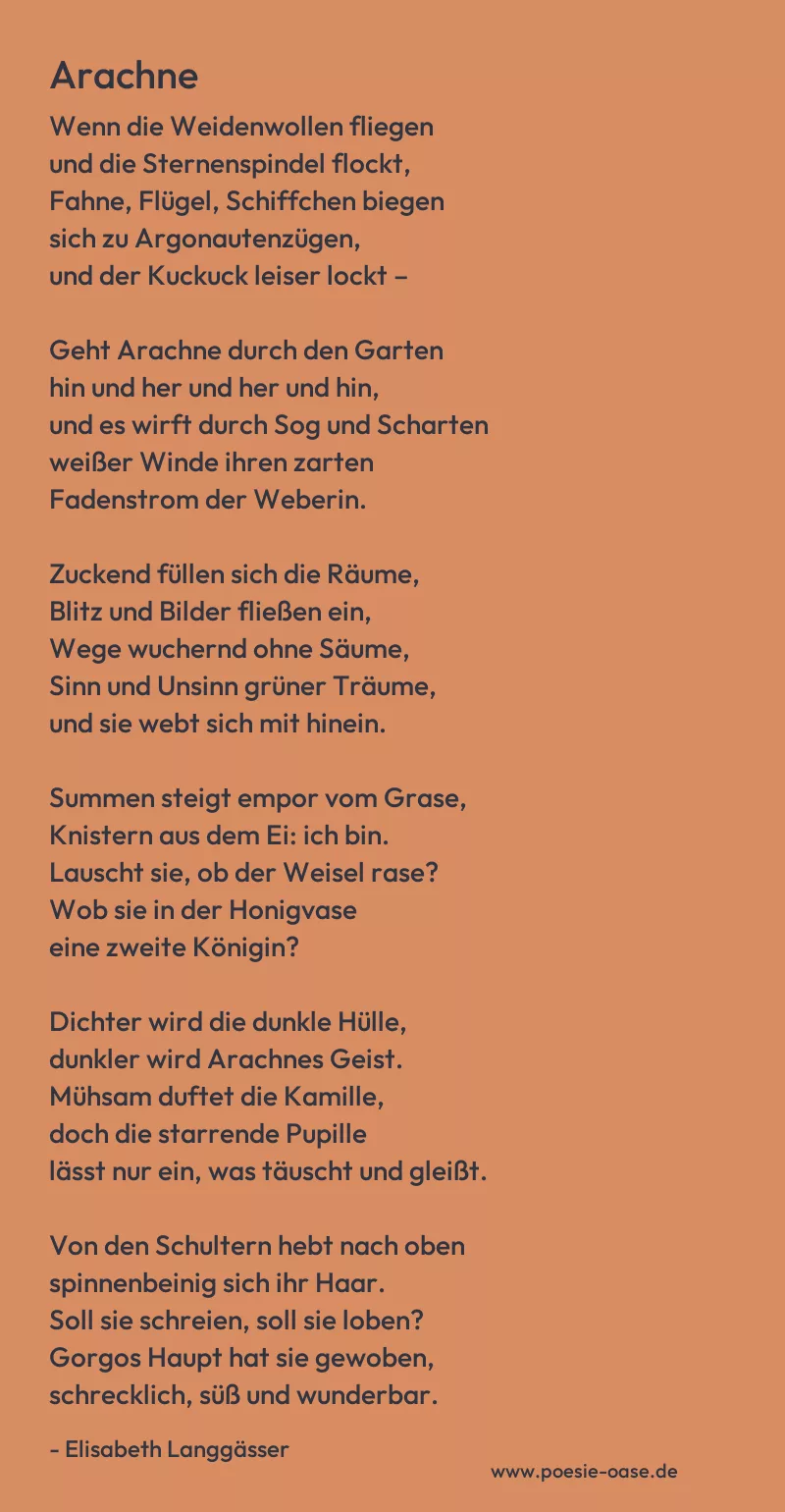Arachne
Wenn die Weidenwollen fliegen
und die Sternenspindel flockt,
Fahne, Flügel, Schiffchen biegen
sich zu Argonautenzügen,
und der Kuckuck leiser lockt –
Geht Arachne durch den Garten
hin und her und her und hin,
und es wirft durch Sog und Scharten
weißer Winde ihren zarten
Fadenstrom der Weberin.
Zuckend füllen sich die Räume,
Blitz und Bilder fließen ein,
Wege wuchernd ohne Säume,
Sinn und Unsinn grüner Träume,
und sie webt sich mit hinein.
Summen steigt empor vom Grase,
Knistern aus dem Ei: ich bin.
Lauscht sie, ob der Weisel rase?
Wob sie in der Honigvase
eine zweite Königin?
Dichter wird die dunkle Hülle,
dunkler wird Arachnes Geist.
Mühsam duftet die Kamille,
doch die starrende Pupille
lässt nur ein, was täuscht und gleißt.
Von den Schultern hebt nach oben
spinnenbeinig sich ihr Haar.
Soll sie schreien, soll sie loben?
Gorgos Haupt hat sie gewoben,
schrecklich, süß und wunderbar.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
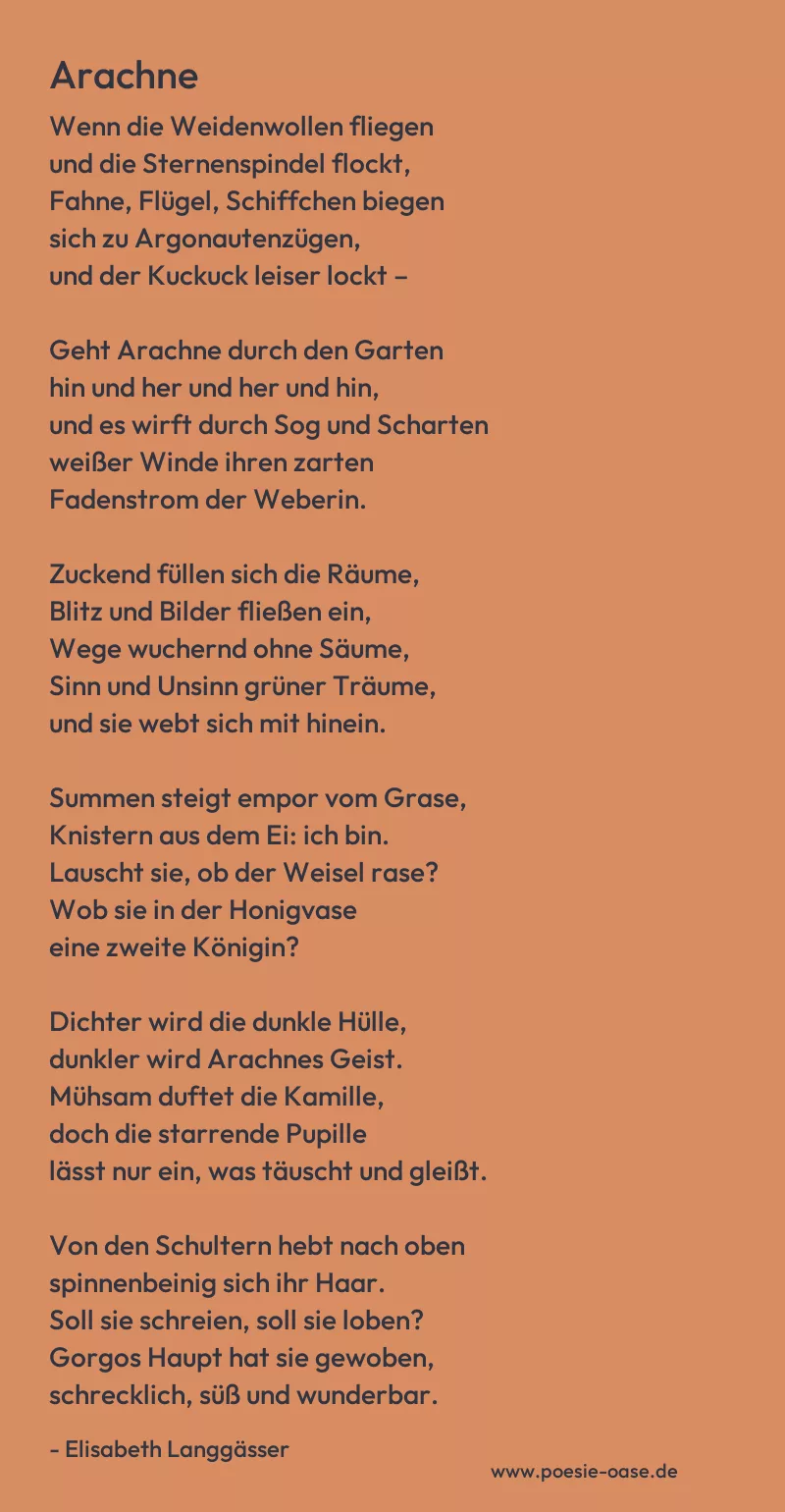
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Arachne“ von Elisabeth Langgässer beschreibt auf eindrucksvolle Weise die Figur der Arachne, die mit dem Bild der Weberin und der Spinne verschmilzt. Zu Beginn des Gedichts wird eine Naturkulisse aufgebaut, in der Bilder von fliegenden Weidenwollen und Sternenspindeln die Atmosphäre bestimmen. Diese scheinbar unschuldigen Naturbilder führen den Leser zu Arachne, die durch den Garten geht und mit ihrem „zarten Fadenstrom“ zu weben beginnt.
Die Vorstellung der Weberin Arachne wird mit einem fesselnden Bild von „weißen Winden“ und einem „Fadenstrom“ kombiniert, der sie mit ihrer Umgebung und dem natürlichen Zyklus verbindet. Die Metaphorik der „Fäden“ und „Bilder“ symbolisiert die Art und Weise, wie Arachne ihre eigene Realität in die Welt einwebt – eine Mischung aus Bewusstem und Unbewusstem. Die „grünen Träume“ deuten auf eine verworrene, vielleicht traumhafte Dimension hin, in der Realität und Fantasie verschwimmen.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird Arachne zunehmend in eine dämonische und schicksalhafte Rolle hineingezogen. Ihr Werk scheint zu wachsen und die Frage aufzuwerfen, ob sie möglicherweise eine „zweite Königin“ in der „Honigvase“ webt. Diese Anspielung auf Macht und Geheimnis verstärkt den Eindruck, dass Arachne eine tiefere, beinahe göttliche oder teuflische Bedeutung in ihrer Tätigkeit als Weberin hat.
Der letzte Abschnitt des Gedichts bringt die Figur Arachne in eine endgültige, tragische Dimension. Ihr Haar, das sich „spinnenbeinig“ erhebt, und die Andeutung, dass sie „Gorgos Haupt“ gewoben hat, verweist auf die düstere Mythologie von Arachne, die sich im Wettstreit mit den Göttern dem Schicksal stellte. Das „Gorgos Haupt“, das als schrecklich, süß und wunderbar beschrieben wird, steht symbolisch für die komplexe Mischung aus Schönheit und Verderben, die in Arachne selbst zu finden ist.
Insgesamt verwebt Langgässer mythologische, natürliche und psychologische Ebenen zu einem kraftvollen Bild der Arachne, die in ihrem Weben die Grenze zwischen Mensch und Gott, Realität und Fantasie, Gut und Böse durchbricht. Sie ist sowohl Schöpferin als auch Zerstörerin, und das Gedicht spiegelt diese duale Natur auf elegante Weise wider.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.