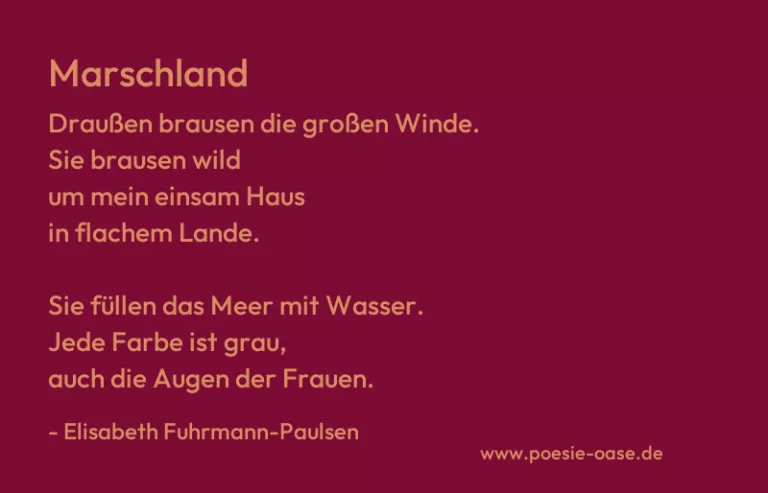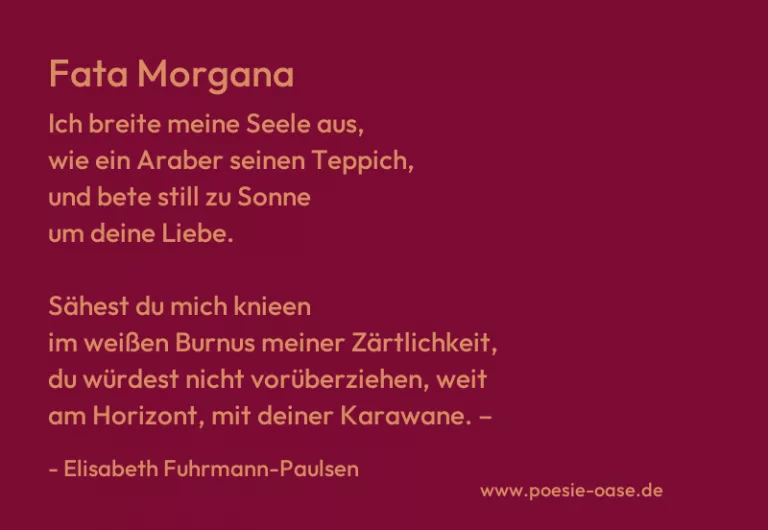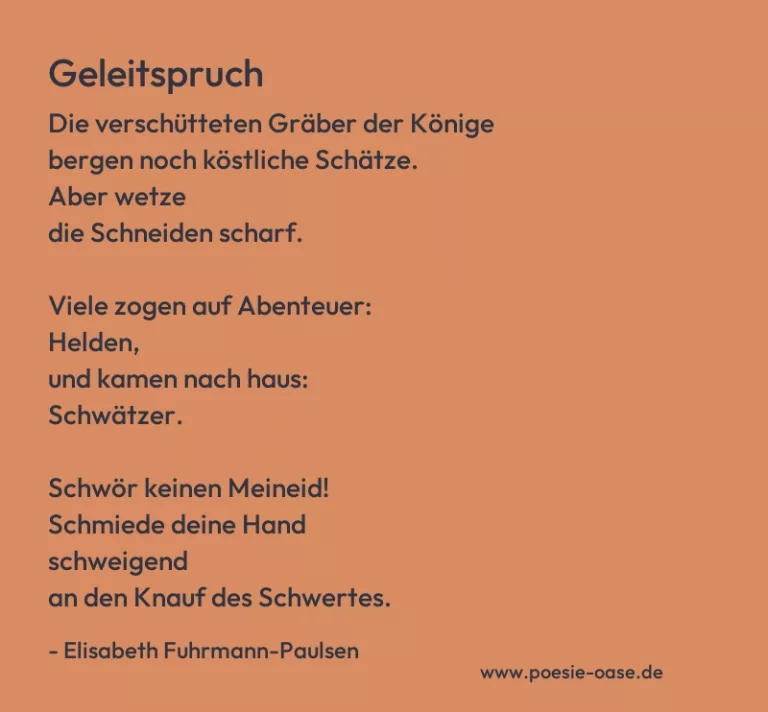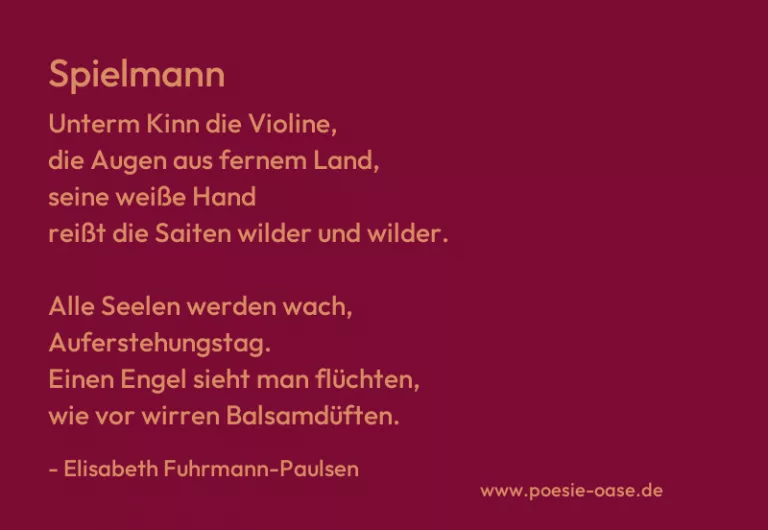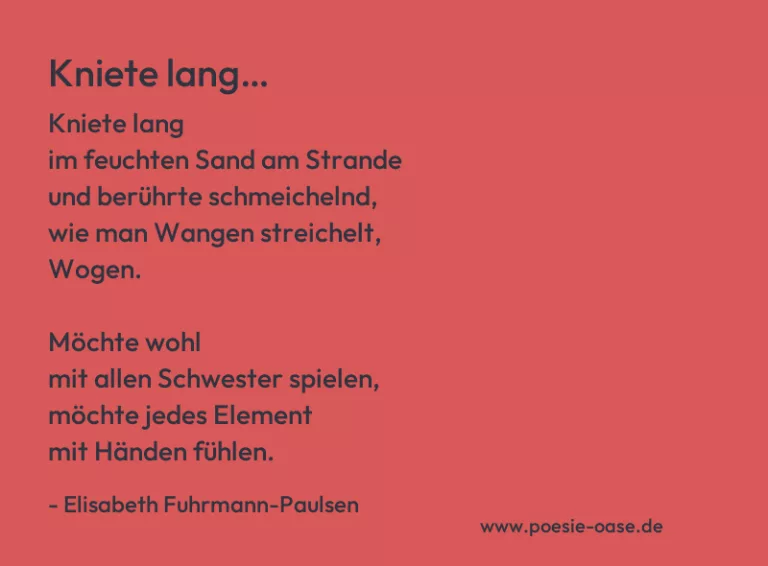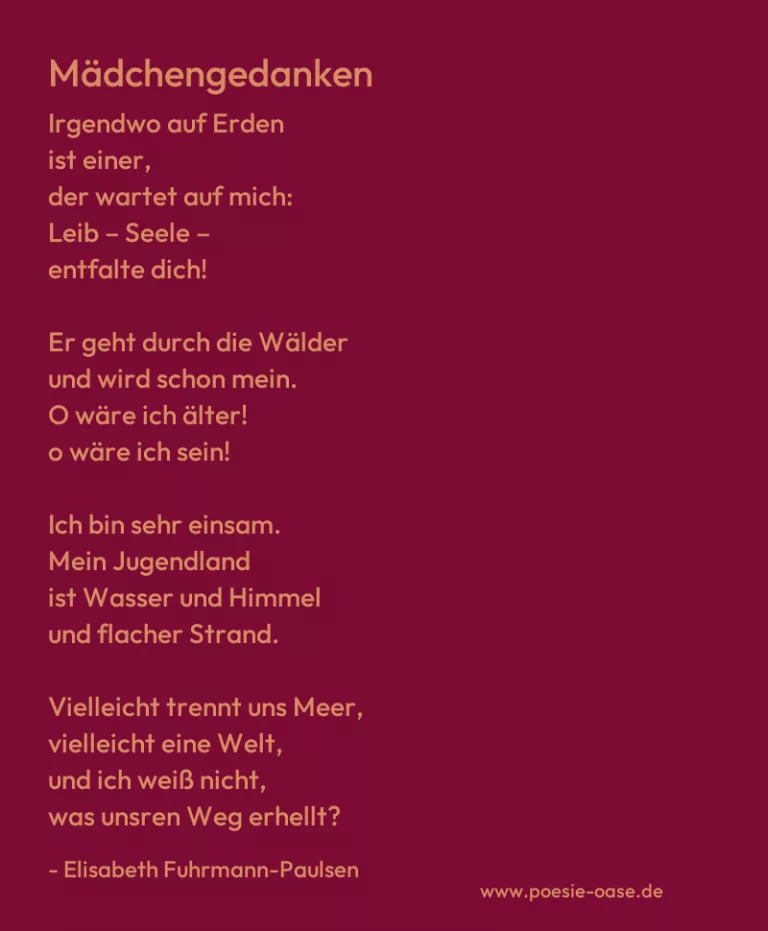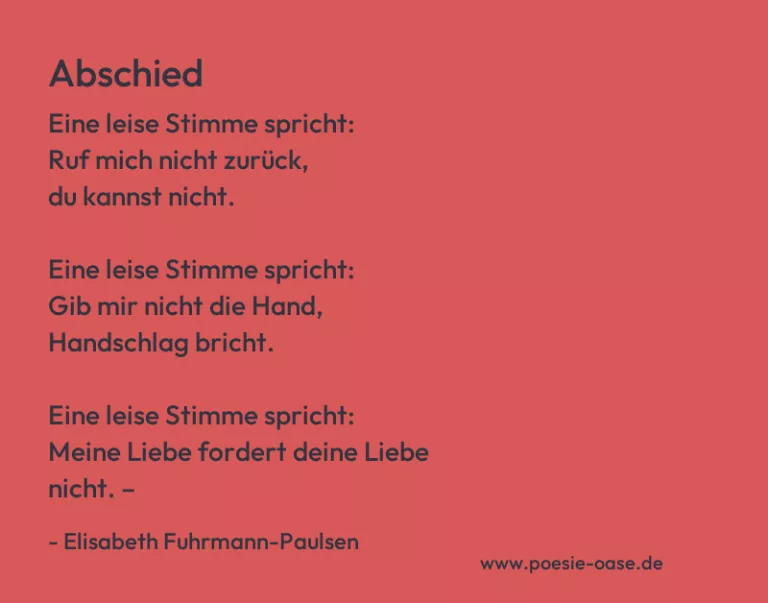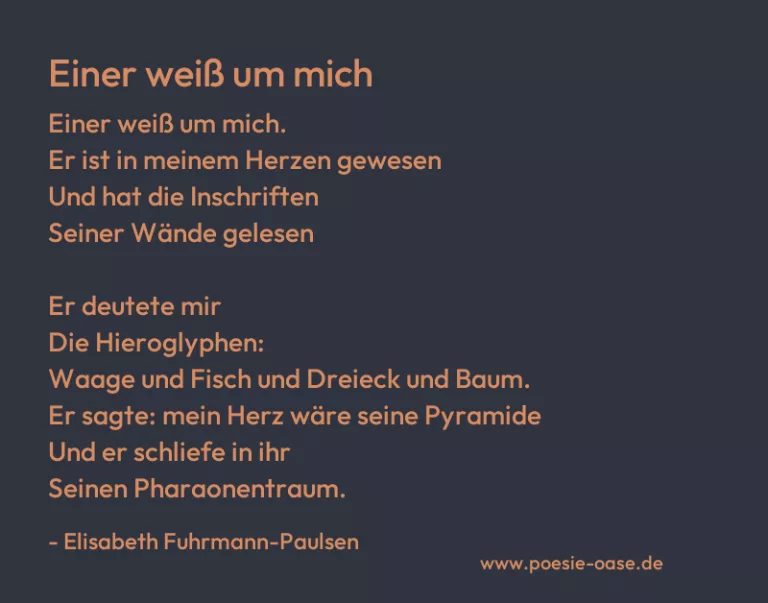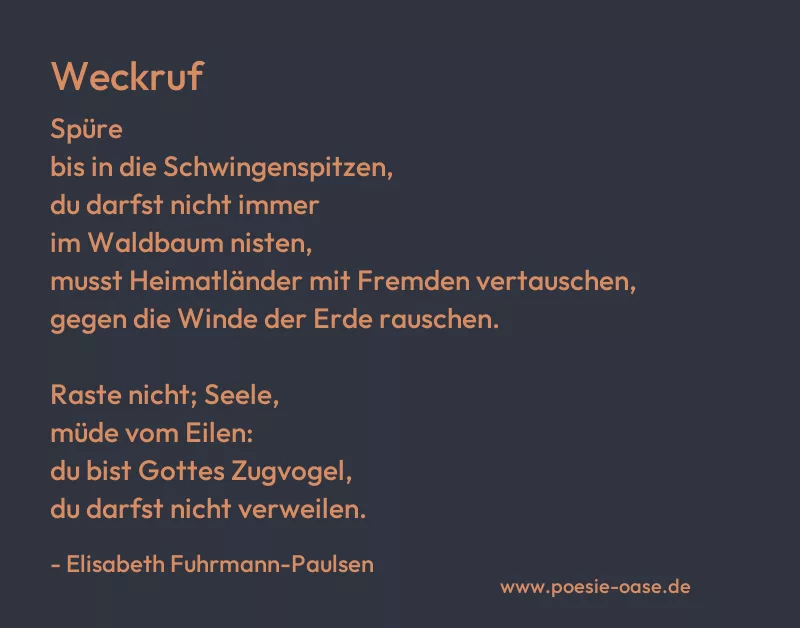Weckruf
Spüre
bis in die Schwingenspitzen,
du darfst nicht immer
im Waldbaum nisten,
musst Heimatländer mit Fremden vertauschen,
gegen die Winde der Erde rauschen.
Raste nicht; Seele,
müde vom Eilen:
du bist Gottes Zugvogel,
du darfst nicht verweilen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
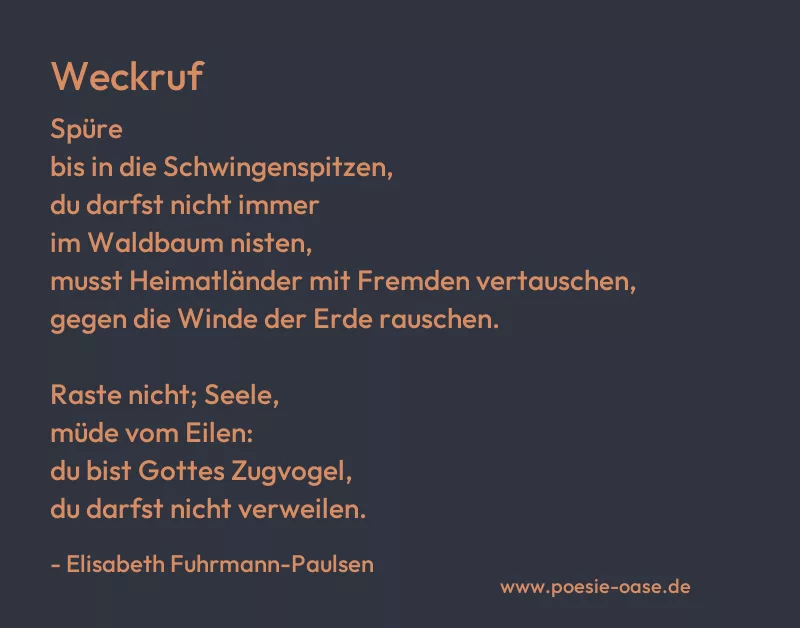
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Weckruf“ von Elisabeth Fuhrmann-Paulsen thematisiert die Unrast und Bestimmung der Seele, die sich nicht in der Bequemlichkeit niederlassen darf, sondern stets in Bewegung bleiben muss. Die zentrale Metapher des Zugvogels verleiht dem Text eine dynamische und fast drängende Energie, die zur ständigen Veränderung und Weiterentwicklung aufruft.
Die ersten Verse fordern dazu auf, sich nicht im „Waldbaum“ einzurichten, also nicht in der vermeintlichen Sicherheit einer festen Heimat zu verharren. Stattdessen soll das Individuum neue Länder entdecken und sich dem Wandel hingeben. Der „Wind der Erde“ steht dabei für Herausforderungen, Fremde und das Unbekannte – all das, was die Seele formen und bereichern kann.
In der zweiten Strophe wird die Rastlosigkeit auf eine spirituelle Ebene gehoben: Die Seele ist „Gottes Zugvogel“ und somit nicht dazu bestimmt, sich auszuruhen oder am Erreichten festzuhalten. Die göttliche Bestimmung verlangt nach stetigem Aufbruch und Weiterziehen. Der imperativische Ton verstärkt den mahnenden Charakter des Gedichts, das nicht nur als Aufforderung zum Reisen, sondern auch als Sinnbild für geistiges und seelisches Wachstum gelesen werden kann.
„Weckruf“ vermittelt somit eine kraftvolle Botschaft: Wer sich auf seinem Weg ausruht, verpasst seine eigentliche Bestimmung. Stattdessen gilt es, das Leben in seiner Bewegung und Veränderung anzunehmen und mutig den eigenen Pfad weiterzugehen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.