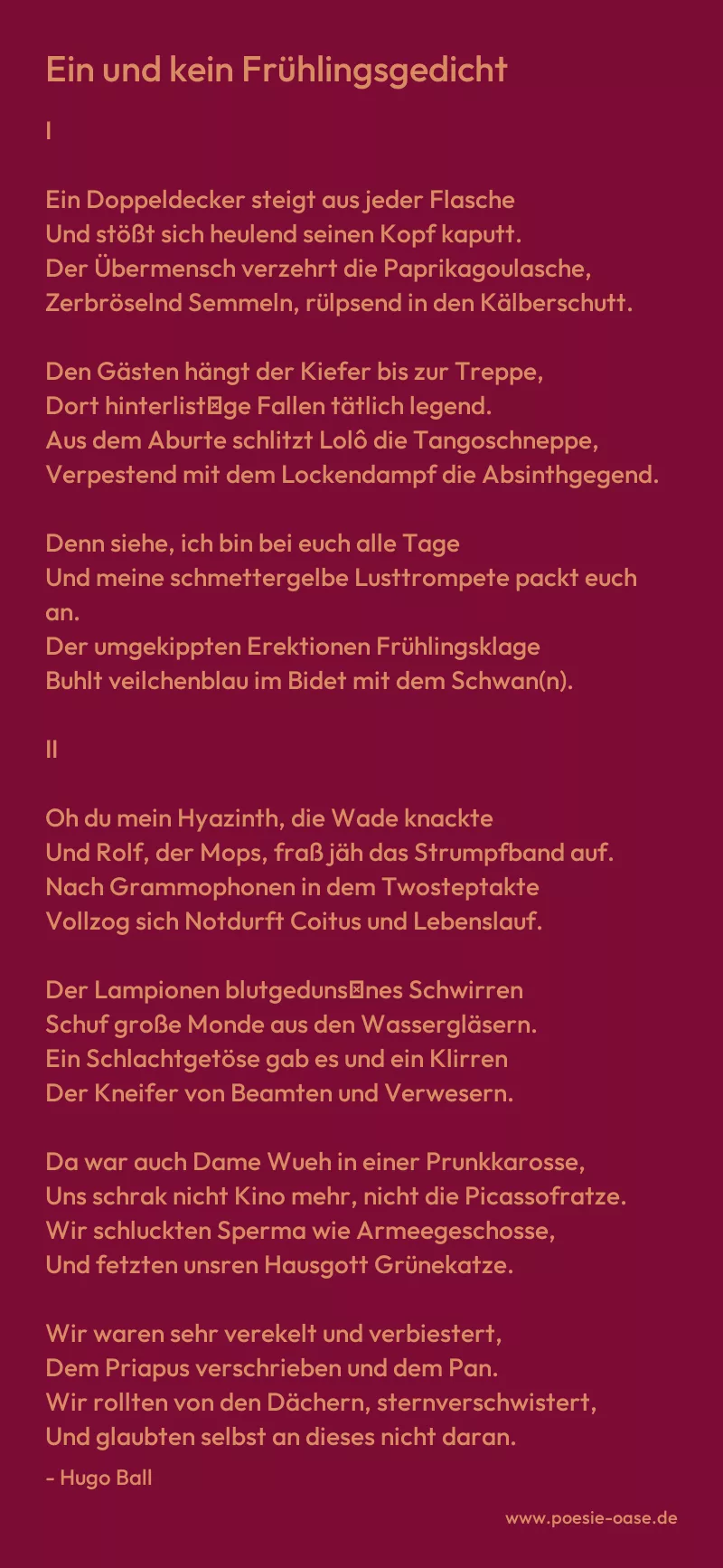Ein und kein Frühlingsgedicht
I
Ein Doppeldecker steigt aus jeder Flasche
Und stößt sich heulend seinen Kopf kaputt.
Der Übermensch verzehrt die Paprikagoulasche,
Zerbröselnd Semmeln, rülpsend in den Kälberschutt.
Den Gästen hängt der Kiefer bis zur Treppe,
Dort hinterlist′ge Fallen tätlich legend.
Aus dem Aburte schlitzt Lolô die Tangoschneppe,
Verpestend mit dem Lockendampf die Absinthgegend.
Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage
Und meine schmettergelbe Lusttrompete packt euch an.
Der umgekippten Erektionen Frühlingsklage
Buhlt veilchenblau im Bidet mit dem Schwan(n).
II
Oh du mein Hyazinth, die Wade knackte
Und Rolf, der Mops, fraß jäh das Strumpfband auf.
Nach Grammophonen in dem Twosteptakte
Vollzog sich Notdurft Coitus und Lebenslauf.
Der Lampionen blutgeduns′nes Schwirren
Schuf große Monde aus den Wassergläsern.
Ein Schlachtgetöse gab es und ein Klirren
Der Kneifer von Beamten und Verwesern.
Da war auch Dame Wueh in einer Prunkkarosse,
Uns schrak nicht Kino mehr, nicht die Picassofratze.
Wir schluckten Sperma wie Armeegeschosse,
Und fetzten unsren Hausgott Grünekatze.
Wir waren sehr verekelt und verbiestert,
Dem Priapus verschrieben und dem Pan.
Wir rollten von den Dächern, sternverschwistert,
Und glaubten selbst an dieses nicht daran.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
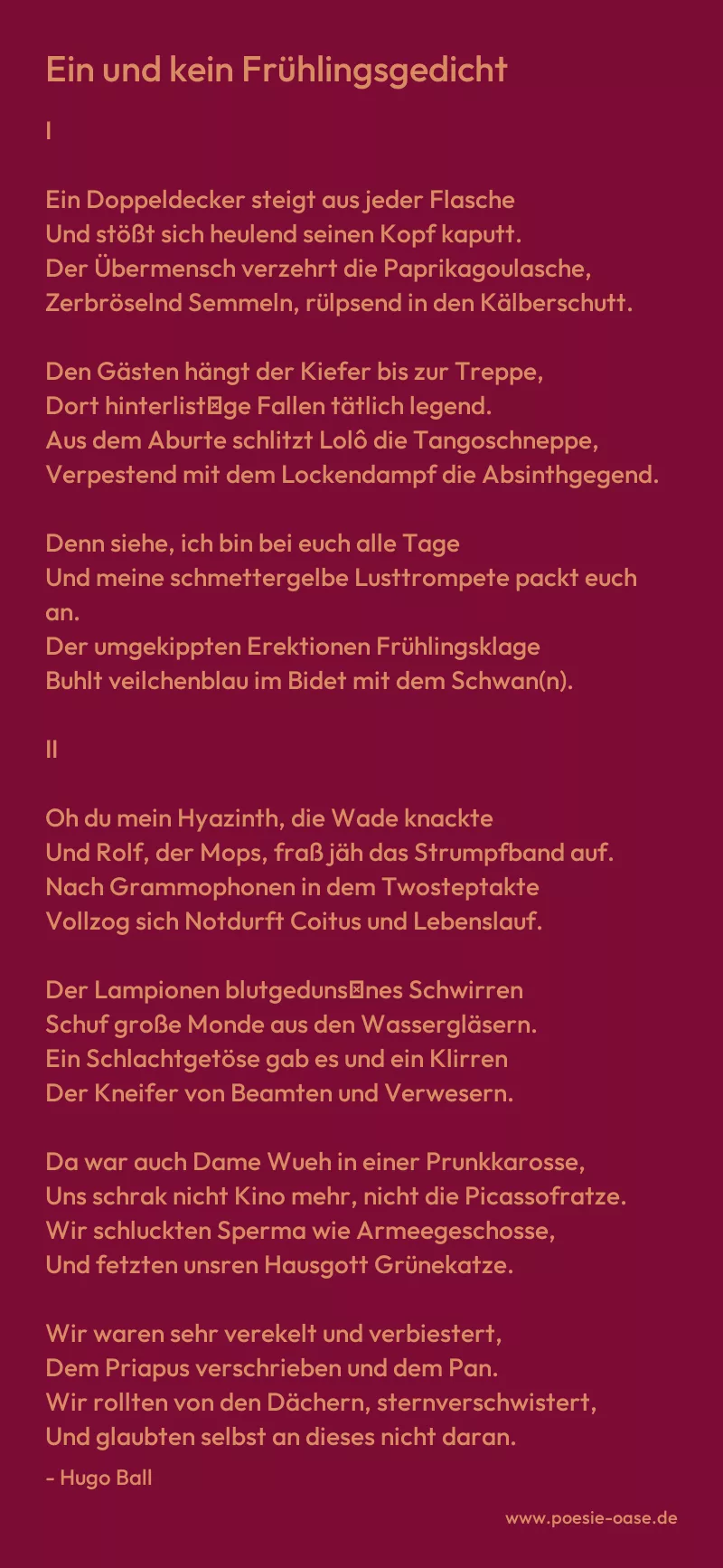
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein und kein Frühlingsgedicht“ von Hugo Ball präsentiert eine dadaistische Dekonstruktion des Frühlingsmotivs, indem es konventionelle Bilder durch absurde, groteske und teils obszöne Elemente ersetzt. Der Titel selbst deutet bereits auf diese Zerrissenheit hin: „Ein und kein“ impliziert sowohl Präsenz als auch Abwesenheit des Frühlings. Das Gedicht ist in zwei Teile unterteilt, wobei der erste Abschnitt eine Reihe von surrealen Szenen und Charakteren einführt, während der zweite Abschnitt eine noch exzessivere und nihilistischere Welt darstellt.
Im ersten Teil werden der traditionelle Frühling und seine Freuden durch eine chaotische und verdorbene Welt ersetzt. Bilder wie „Doppeldecker“, die sich den Kopf kaputtstoßen, und der „Übermensch“, der Paprikagoulasch verzehrt, vermitteln ein Gefühl von Zerstörung und Dekadenz. Die „Frühlingsklage“ der „umgekippten Erektionen“ und die „Tangoschneppe“ in Verbindung mit Absinth schaffen eine Atmosphäre von sexueller Obsession und Rausch. Balls Nutzung von Wortspielen, Neologismen und unerwarteten Bildern, wie der „schmettergelben Lusttrompete“, unterstreicht die dadaistische Ablehnung der Rationalität und des konventionellen Geschmacks.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft die bereits etablierte destruktive Tendenz. Hier finden wir eine noch wildere Mischung aus sexueller Anspielung, Gewalt und Nihilismus. Die „blutgeduns’nes Schwirren“ der Lampions, die „Coitus und Lebenslauf“ in einem Atemzug nennen, und das „Sperma“ als „Armeegeschosse“ stehen für eine völlige Entwertung von Leben und Moral. Die Referenzen an „Priapus“ und „Pan“ sowie die „Grünekatze“ als „Hausgott“ zeigen die Ablehnung der bürgerlichen Werte und eine Hinwendung zu primitiven, heidnischen Instinkten. Der letzte Vers, „Und glaubten selbst an dieses nicht daran“, verstärkt das Gefühl der Absurdität und des Zweifels an jeglichem Glauben.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hugo Balls „Ein und kein Frühlingsgedicht“ eine radikale Kritik an bürgerlichen Werten und dem konventionellen Verständnis von Frühling darstellt. Es ist ein dadaistisches Manifest, das durch seine Zerstörung konventioneller Sprache und Bilder eine Welt der Absurdität, des Nihilismus und der Rebellion gegen alle etablierten Ordnungen schafft. Das Gedicht ist ein Ausdruck des Schmerzes und der Desillusionierung über die menschliche Existenz.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.