Ein großer Teich war zugefroren;
Die Fröschlein, in der Tiefe verloren,
Durften nicht ferner quaken noch springen,
Versprachen sich aber, im halben Traum:
Fänden sie nur da oben Raum,
Wie Nachtigallen wollten sie singen.
Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz,
Nun ruderten sie und landeten stolz
Und saßen am Ufer weit und breit
Und quakten wie vor alter Zeit.
Ein großer Teich war zugefroren
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
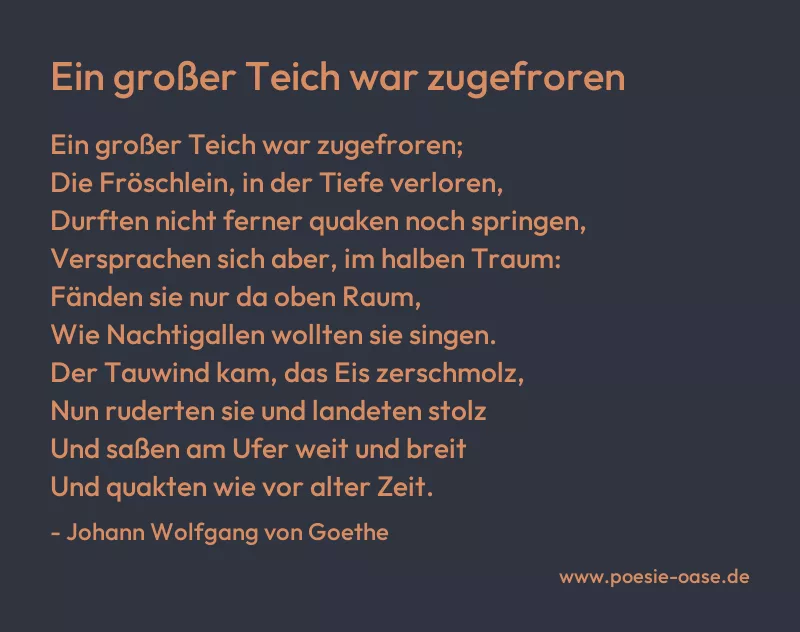
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein großer Teich war zugefroren“ von Johann Wolfgang von Goethe präsentiert eine humorvolle und leicht satirische Beobachtung menschlichen Verhaltens, verpackt in einer einfachen, idyllischen Szene. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung eines zugefrorenen Teiches, in dem die Frösche – tief unten im Eis gefangen – ihren gewohnten Aktivitäten nicht nachgehen können. Die scheinbare Stille und das Fehlen von Froschgequake erzeugen eine gewisse Erwartungshaltung, die durch das Versprechen der Frösche, wie Nachtigallen singen zu wollen, wenn sie erst wieder frei sind, gesteigert wird.
Diese Verheißung der Frösche stellt den Kern der Satire dar. Die Frösche sehen in ihrer momentanen Situation eine Einschränkung ihrer Möglichkeiten und versprechen, sich zu bessern und ein höheres Ziel anzustreben, sobald die Einschränkung aufgehoben ist. Dies spiegelt die menschliche Neigung wider, in schwierigen Zeiten Besserung und Veränderung zu versprechen, die jedoch oft vergessen werden, sobald die Widrigkeiten vorüber sind. Der „halbe Traum“ deutet dabei auf die Unaufrichtigkeit und die Unwahrscheinlichkeit der Erfüllung dieses Versprechens hin.
Die zweite Strophe bricht abrupt mit der ersten. Mit dem Tauwind, der das Eis schmilzt, kehren die Frösche in ihren angestammten Lebensraum zurück. Anstatt wie Nachtigallen zu singen, rudern sie stattdessen umher und landen schließlich am Ufer. Dort, weit und breit verteilt, fallen sie in ihre gewohnte Verhaltensweise zurück und quaken „wie vor alter Zeit“. Dieser unerwartete Rückfall in die altbekannte Routine unterstreicht die Ironie der Situation und die Enttäuschung, die von den anfangs erhabenen Versprechungen zurückbleibt.
Goethe nutzt hier die einfache Struktur des Gedichts und die leicht verständliche Sprache, um eine universelle Wahrheit zu vermitteln. Die Frösche dienen als Metapher für die menschliche Natur, die dazu neigt, in Zeiten der Not Versprechungen zu machen, die oft vergessen oder nicht eingehalten werden, sobald sich die Umstände ändern. Das Gedicht ist somit eine subtile Kritik an der menschlichen Schwäche und der Tendenz, trotz aller Vorsätze in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Es ist ein humorvolles, aber auch nachdenkliches Werk über Selbsttäuschung und die Schwierigkeit, Veränderungen wirklich durchzusetzen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
