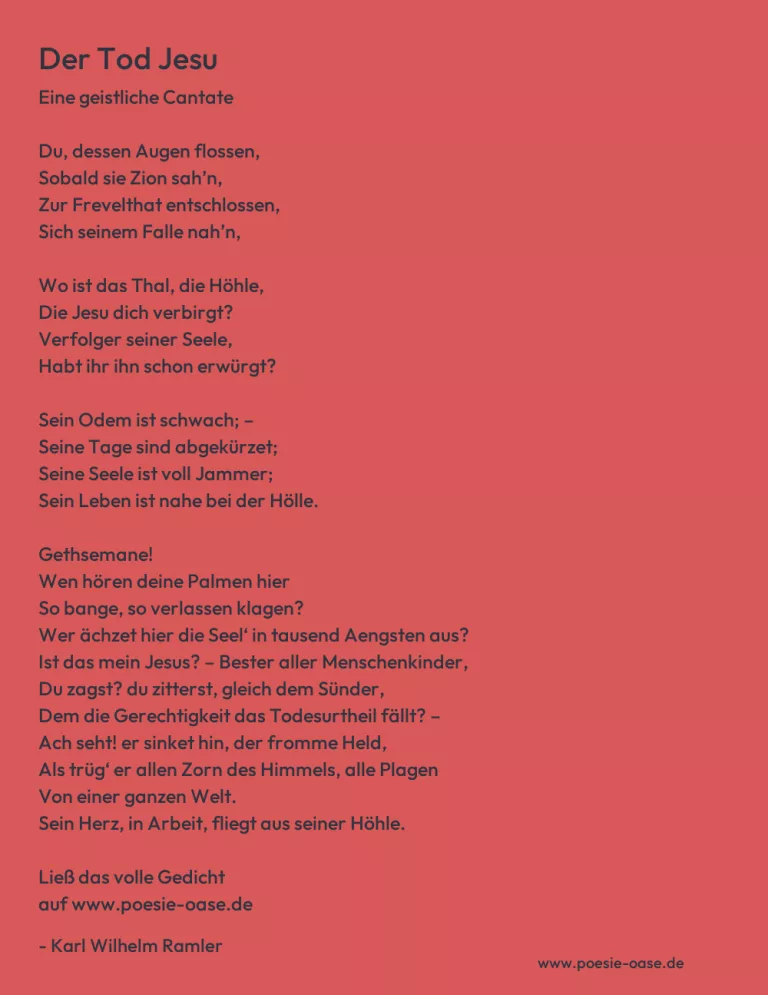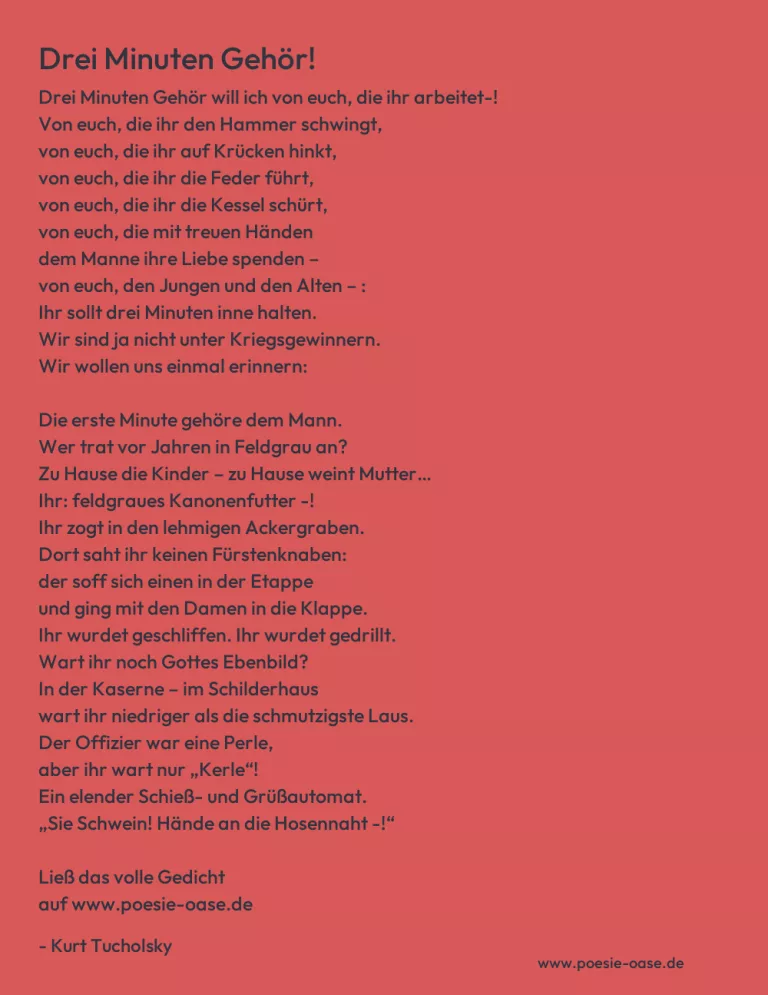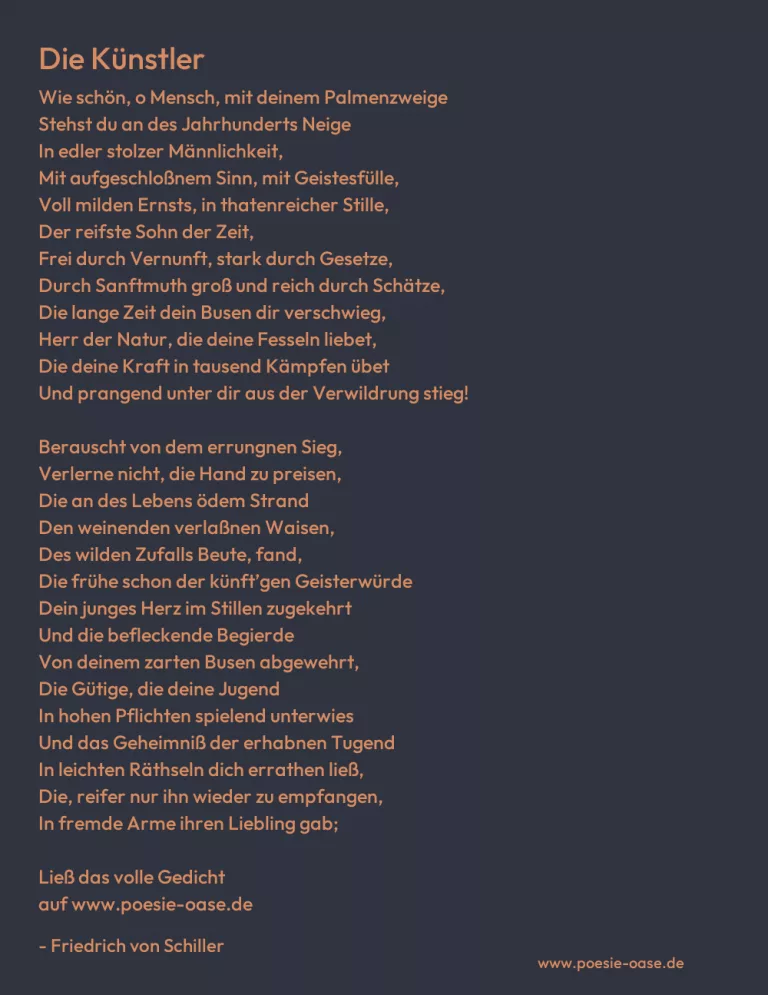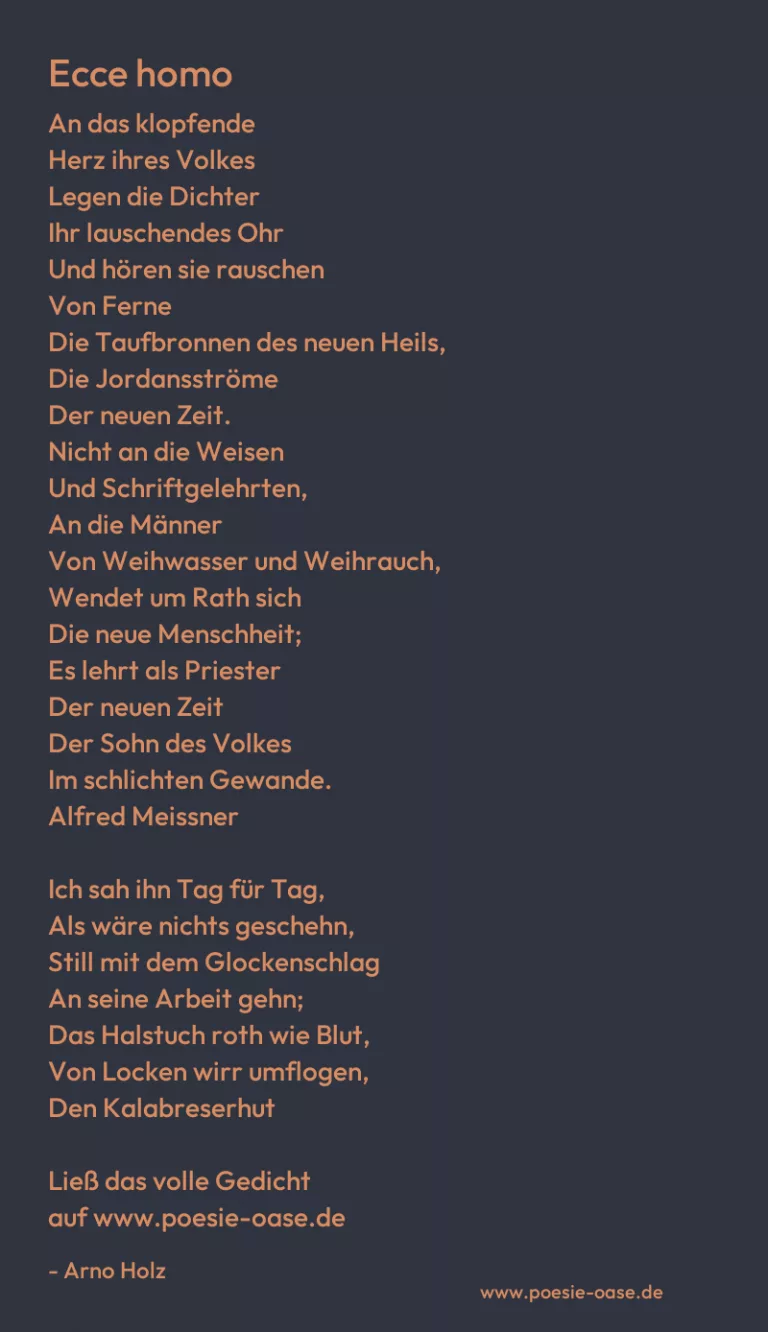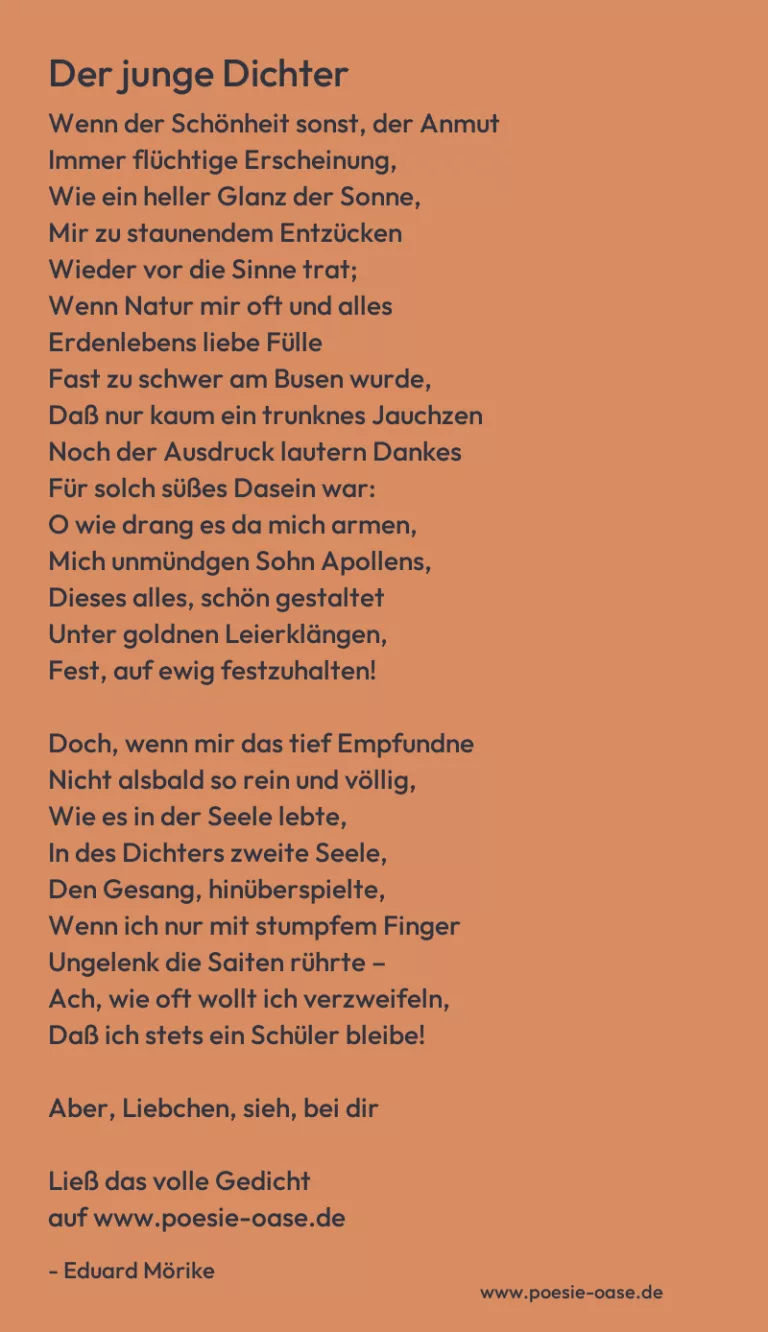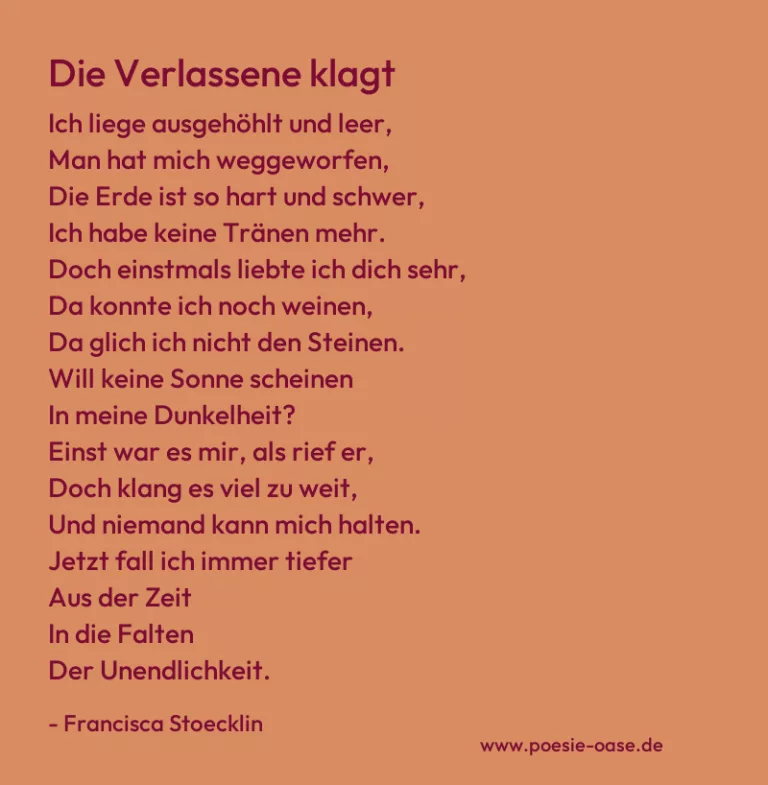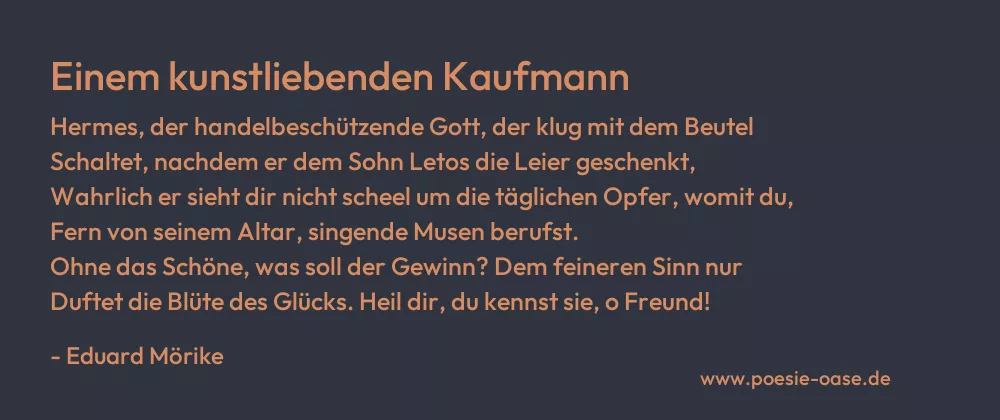Einem kunstliebenden Kaufmann
Hermes, der handelbeschützende Gott, der klug mit dem Beutel
Schaltet, nachdem er dem Sohn Letos die Leier geschenkt,
Wahrlich er sieht dir nicht scheel um die täglichen Opfer, womit du,
Fern von seinem Altar, singende Musen berufst.
Ohne das Schöne, was soll der Gewinn? Dem feineren Sinn nur
Duftet die Blüte des Glücks. Heil dir, du kennst sie, o Freund!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
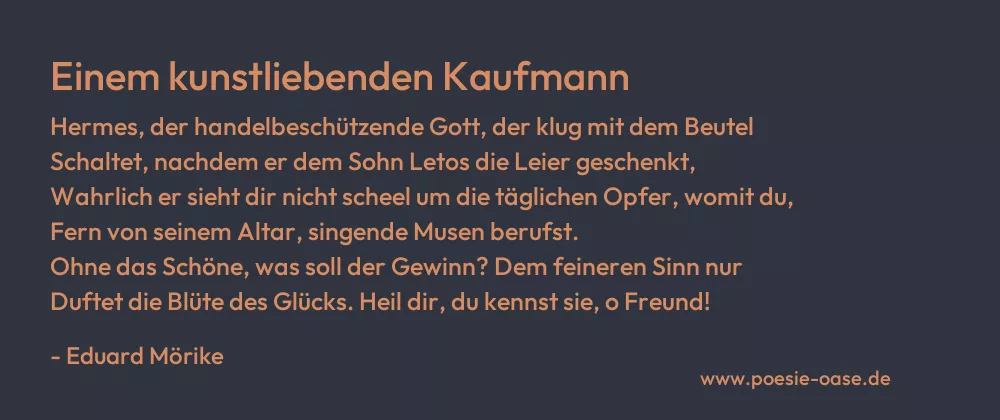
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Einem kunstliebenden Kaufmann“ von Eduard Mörike richtet sich an einen Kaufmann, der trotz seines Berufes die Bedeutung der Kunst und des Schönen in seinem Leben erkennt. Die erste Zeile verweist auf Hermes, den Gott des Handels, der in der griechischen Mythologie nicht nur die Geschäfte schützt, sondern auch ein Vermittler der Künste und Musen ist. Die Erwähnung von Hermes als „handelbeschützenden Gott“ zeigt die duale Bedeutung des Handels und der Kunst – zwei Aspekte, die in der Gesellschaft oft als voneinander getrennt betrachtet werden, aber hier zusammengebracht werden.
Mörike bringt den Kaufmann in Verbindung mit der Kunst, indem er darauf hinweist, dass dieser nicht nur materiellen Gewinn anstrebt, sondern auch eine tiefere, spirituelle Erfüllung durch die „singenden Musen“ sucht. Das Bild der Musen, die in der griechischen Mythologie für die Inspiration der Künste zuständig sind, unterstreicht die Bedeutung der Kunst als Quelle des höheren Glücks. Der Kaufmann, der den „täglichen Opfer“ des Handels nachgeht, wird als jemand beschrieben, der dennoch einen „feineren Sinn“ hat und sich von der „Blüte des Glücks“ nähren kann, die nur der Kunst zu entnehmen ist.
Der zweite Teil des Gedichts hebt hervor, dass der wahre Gewinn im Leben nicht nur materieller Natur ist. Es wird dem kunstliebenden Kaufmann ein höheres Verständnis und eine tiefere Lebensfreude zugeschrieben, die er durch seine Wertschätzung der schönen Künste erlangt. „Ohne das Schöne, was soll der Gewinn?“ stellt die Frage, ob der materielle Erfolg ohne ästhetische und geistige Erfüllung überhaupt als wahrer Erfolg gelten kann. Mörike weist darauf hin, dass der Kaufmann, der in der Lage ist, die Kunst und Schönheit zu schätzen, das wahre Glück erkennt.
Das Gedicht vermittelt eine Philosophie, die den Wert von Kunst und Schönheit über den bloßen materiellen Gewinn stellt. Es ist eine Hymne an die Bedeutung des ästhetischen Erlebens und der geistigen Erfüllung, die der Kaufmann durch seine Liebe zur Kunst zu finden vermag. Mörike zeigt, dass wahres Glück nicht allein im Handel und im Anhäufen von Reichtum zu finden ist, sondern in der Verbindung zur Kunst und zum Schönen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.