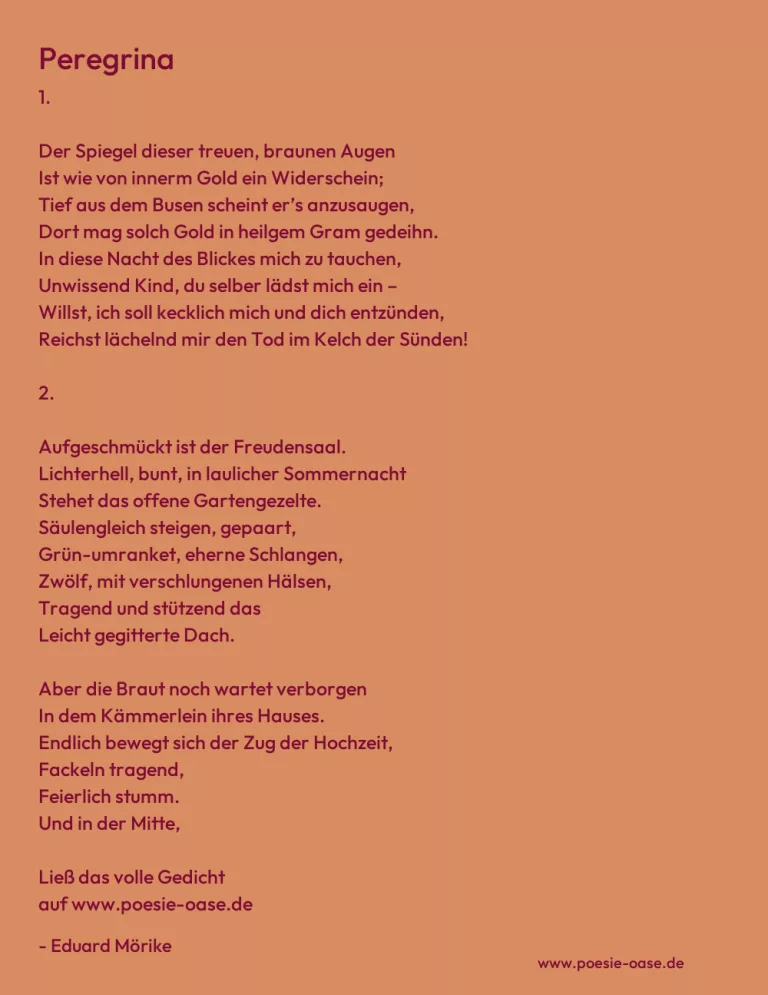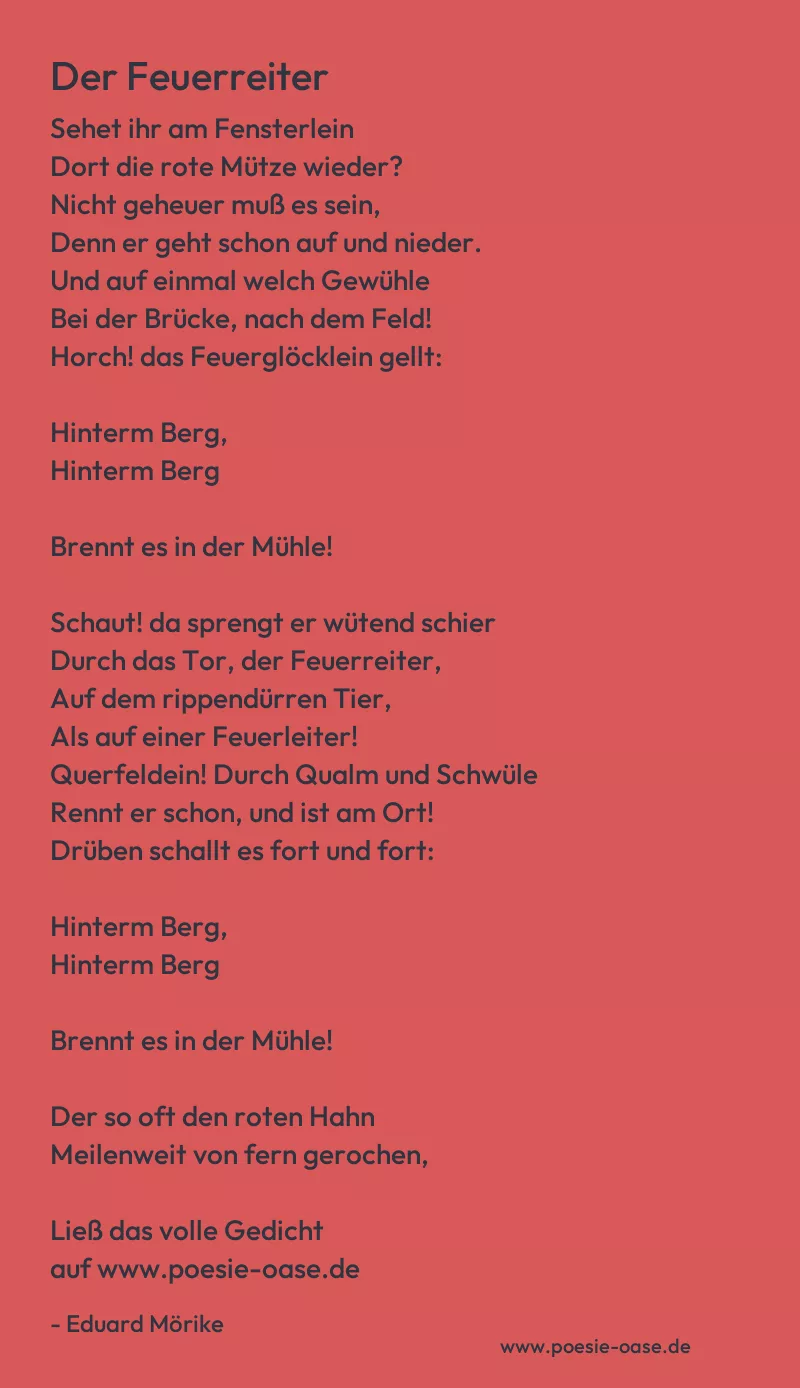Alltag, Feiertage, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Herbst, Jahreszeiten, Krieg, Religion, Sommer, Wut, Zerstörung
Der Feuerreiter
Sehet ihr am Fensterlein
Dort die rote Mütze wieder?
Nicht geheuer muß es sein,
Denn er geht schon auf und nieder.
Und auf einmal welch Gewühle
Bei der Brücke, nach dem Feld!
Horch! das Feuerglöcklein gellt:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Brennt es in der Mühle!
Schaut! da sprengt er wütend schier
Durch das Tor, der Feuerreiter,
Auf dem rippendürren Tier,
Als auf einer Feuerleiter!
Querfeldein! Durch Qualm und Schwüle
Rennt er schon, und ist am Ort!
Drüben schallt es fort und fort:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Brennt es in der Mühle!
Der so oft den roten Hahn
Meilenweit von fern gerochen,
Mit des heilgen Kreuzes Span
Freventlich die Glut besprochen –
Weh! dir grinst vom Dachgestühle
Dort der Feind im Höllenschein.
Gnade Gott der Seele dein!
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Rast er in der Mühle!
Keine Stunde hielt es an,
Bis die Mühle borst in Trümmer;
Doch den kecken Reitersmann
Sah man von der Stunde nimmer.
Volk und Wagen im Gewühle
Kehren heim von all dem Graus;
Auch das Glöcklein klinget aus:
Hinterm Berg,
Hinterm Berg
Brennt’s! –
Nach der Zeit ein Müller fand
Ein Gerippe samt der Mützen
Aufrecht an der Kellerwand
Auf der beinern Mähre sitzen:
Feuerreiter, wie so kühle
Reitest du in deinem Grab!
Husch! da fällt’s in Asche ab.
Ruhe wohl,
Ruhe wohl
Drunten in der Mühle!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
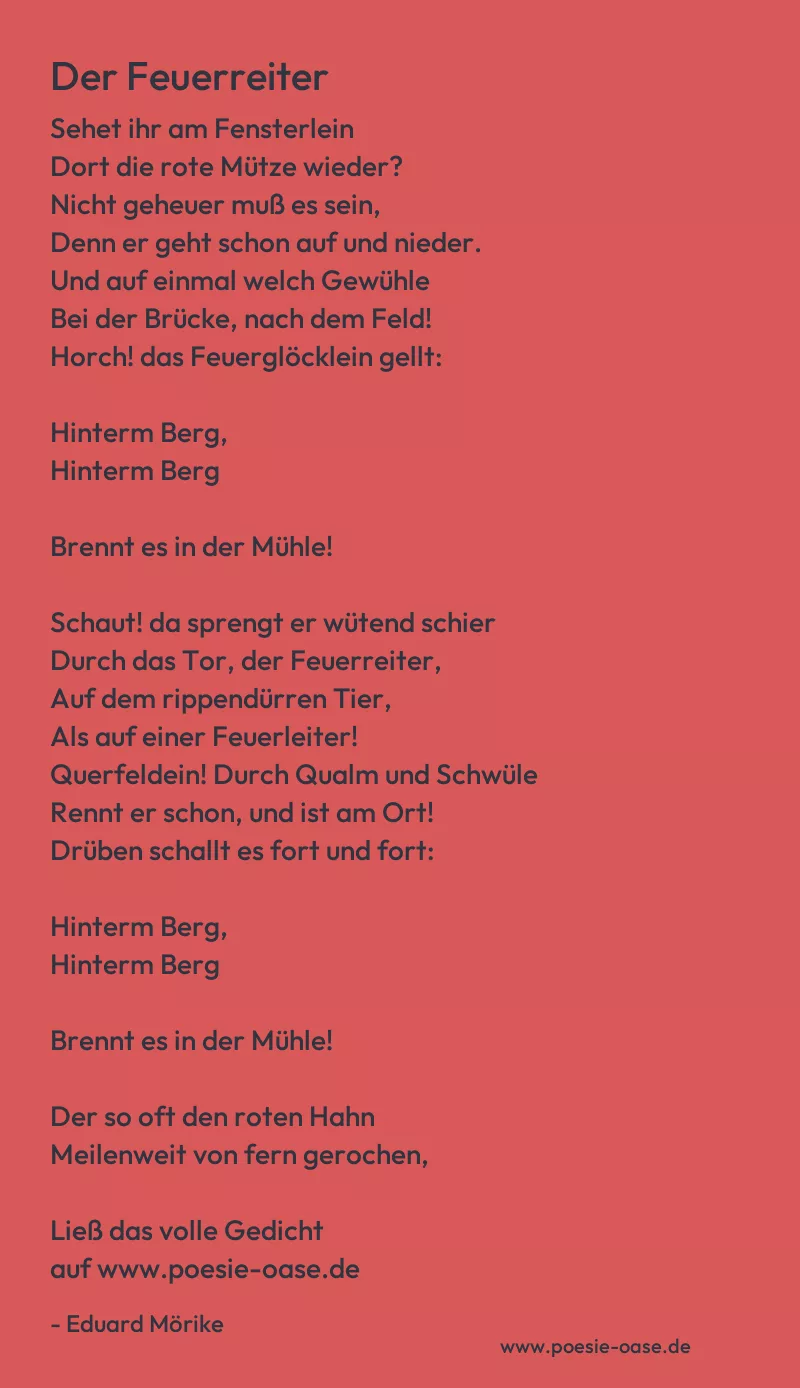
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Feuerreiter“ von Eduard Mörike ist eine balladenhafte Erzählung von unheimlicher Atmosphäre, dramatischer Spannung und düsterer Symbolik. Es erzählt die Geschichte eines geheimnisvollen Reiters, der immer wieder am Fenster erscheint, als könne er Feuer erspüren, und schließlich auf seinem „rippendürren Tier“ durch Rauch und Hitze zur brennenden Mühle reitet. Das Gedicht verknüpft volkstümliche Motive mit Elementen des Unheimlichen und Mythischen, wodurch es eine starke, beinahe gespenstische Wirkung entfaltet.
Zentrale Figur ist der „Feuerreiter“, der wie ein Vorbote des Unglücks erscheint. Bereits im ersten Vers wird sein Auftauchen mit Unheil verknüpft. Seine rote Mütze und sein plötzliches Verschwinden lassen ihn wie ein Wesen zwischen den Welten erscheinen. Der rote Hahn, ein altes Symbol für Feuer, wird hier personifiziert – als habe der Reiter eine unheimliche Verbindung zum Brand selbst. Die Wiederholung des Refrains „Hinterm Berg / Brennt es in der Mühle“ erzeugt dabei einen unaufhaltsamen Rhythmus und verstärkt die Spannung und Dramatik des Geschehens.
Die Sprache des Gedichts ist lebendig und expressiv: Bilder wie das „rippendürre Tier“ oder der „Feind im Höllenschein“ malen ein apokalyptisches Szenario. Der Reiter wirkt wie besessen oder gar dämonisch, eine Figur, die mehr mit dem Feuer als mit den Menschen verbunden ist. Dass er „mit des heilgen Kreuzes Span / freventlich die Glut besprochen“ hat, lässt auf einen Pakt oder zumindest ein gefährliches Spiel mit dämonischen Kräften schließen. Seine Verbindung zum Feuer wird ihm schließlich zum Verhängnis.
Das Ende des Gedichts schlägt einen gespenstischen Ton an: Erst verschwindet der Reiter, dann findet man Jahre später nur noch sein Gerippe samt Mütze aufrecht auf dem Skelettpferd im Keller der Mühle – als hätte er nie aufgehört zu reiten. Mit dem letzten Bild, wie alles zu Asche zerfällt, schließt das Gedicht in tiefer Symbolik über Schuld, Strafe und Vergänglichkeit.
„Der Feuerreiter“ vereint Elemente der Schauergeschichte mit klassischen Balladenmitteln wie Wiederholung, dramatischem Aufbau und dichter Bildsprache. Es handelt sich um ein meisterhaftes Beispiel für Mörikes Fähigkeit, Atmosphäre und erzählerische Spannung mit psychologischer Tiefe zu verbinden. Die Figur des Feuerreiters bleibt ein rätselhafter, eindrucksvoller Mythos zwischen Mahnung, Wahn und übernatürlicher Macht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.