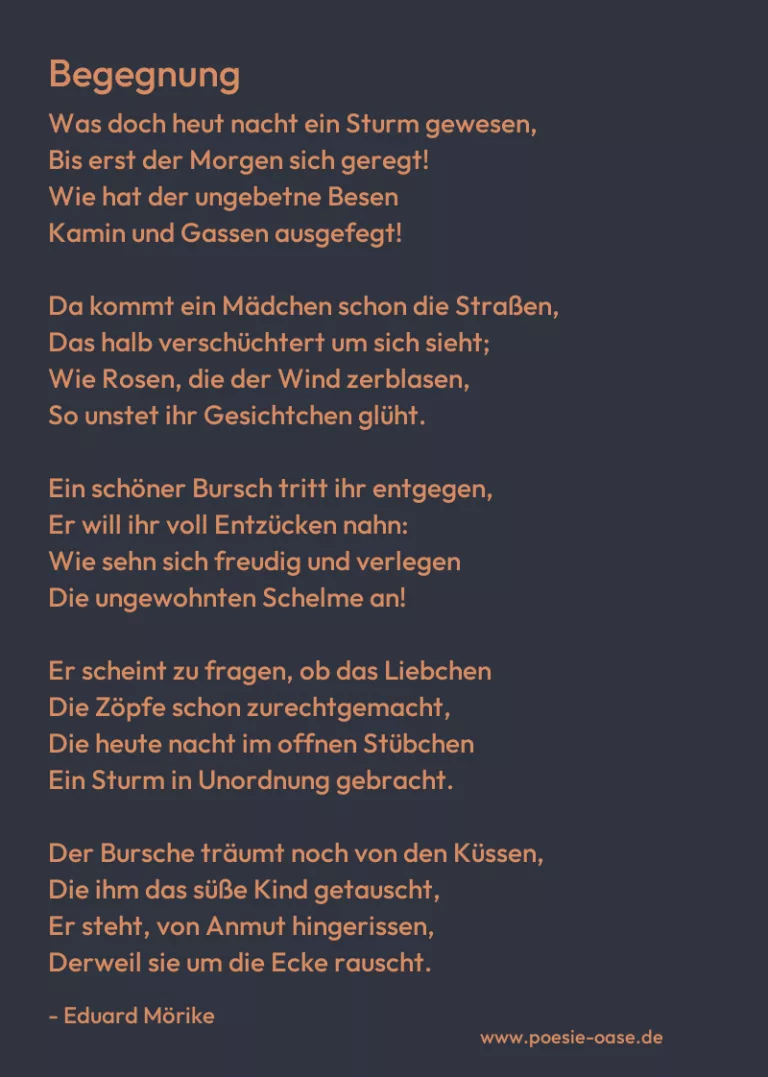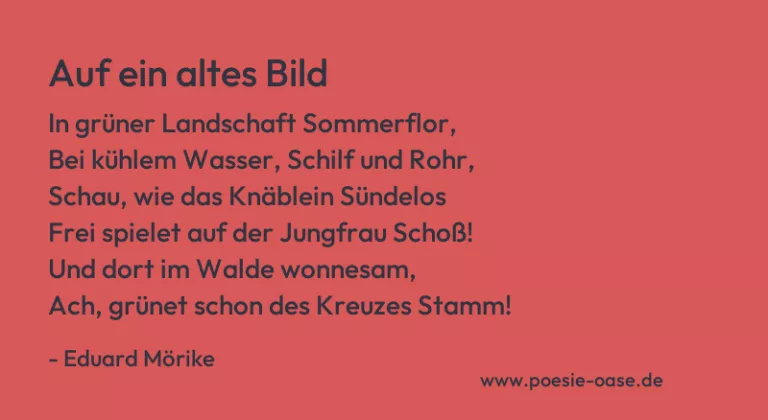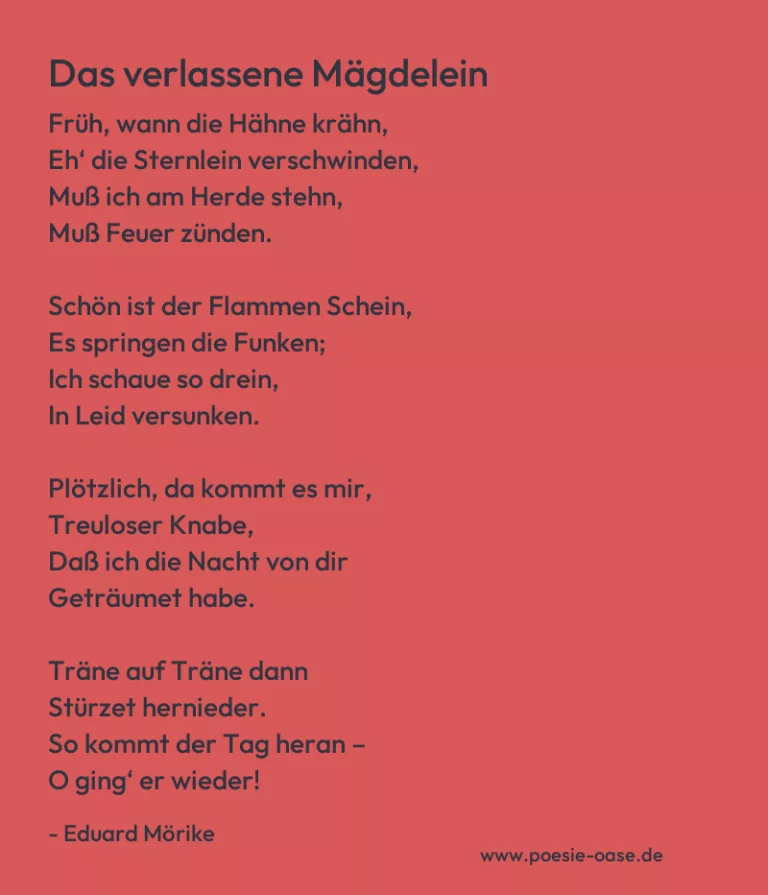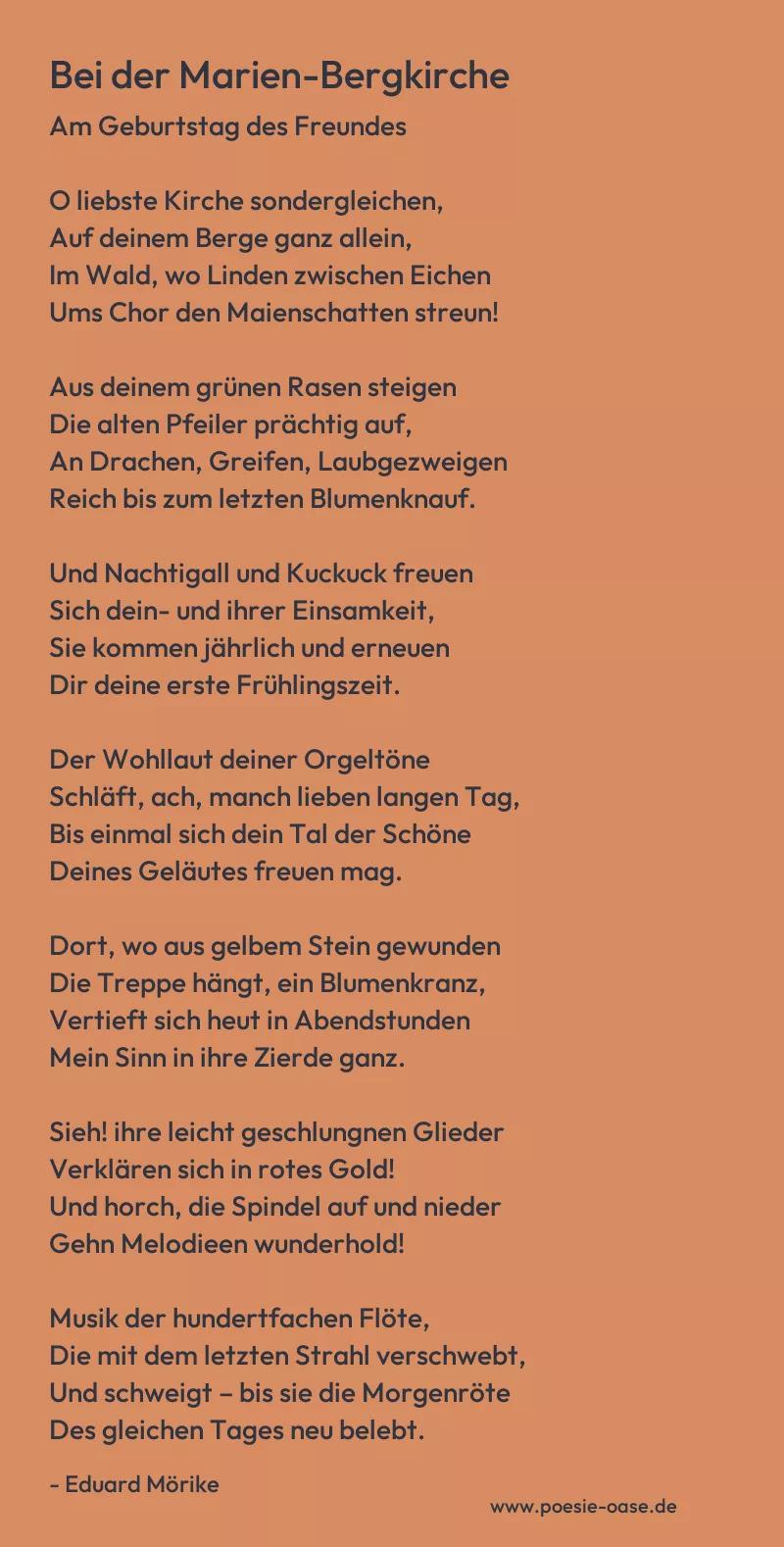Berge & Täler, Blumen & Pflanzen, Emotionen & Gefühle, Feiern, Geburtstag, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Himmel & Wolken, Märchen & Fantasie, Natur, Religion, Sagen
Bei der Marien-Bergkirche
Am Geburtstag des Freundes
O liebste Kirche sondergleichen,
Auf deinem Berge ganz allein,
Im Wald, wo Linden zwischen Eichen
Ums Chor den Maienschatten streun!
Aus deinem grünen Rasen steigen
Die alten Pfeiler prächtig auf,
An Drachen, Greifen, Laubgezweigen
Reich bis zum letzten Blumenknauf.
Und Nachtigall und Kuckuck freuen
Sich dein- und ihrer Einsamkeit,
Sie kommen jährlich und erneuen
Dir deine erste Frühlingszeit.
Der Wohllaut deiner Orgeltöne
Schläft, ach, manch lieben langen Tag,
Bis einmal sich dein Tal der Schöne
Deines Geläutes freuen mag.
Dort, wo aus gelbem Stein gewunden
Die Treppe hängt, ein Blumenkranz,
Vertieft sich heut in Abendstunden
Mein Sinn in ihre Zierde ganz.
Sieh! ihre leicht geschlungnen Glieder
Verklären sich in rotes Gold!
Und horch, die Spindel auf und nieder
Gehn Melodieen wunderhold!
Musik der hundertfachen Flöte,
Die mit dem letzten Strahl verschwebt,
Und schweigt – bis sie die Morgenröte
Des gleichen Tages neu belebt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
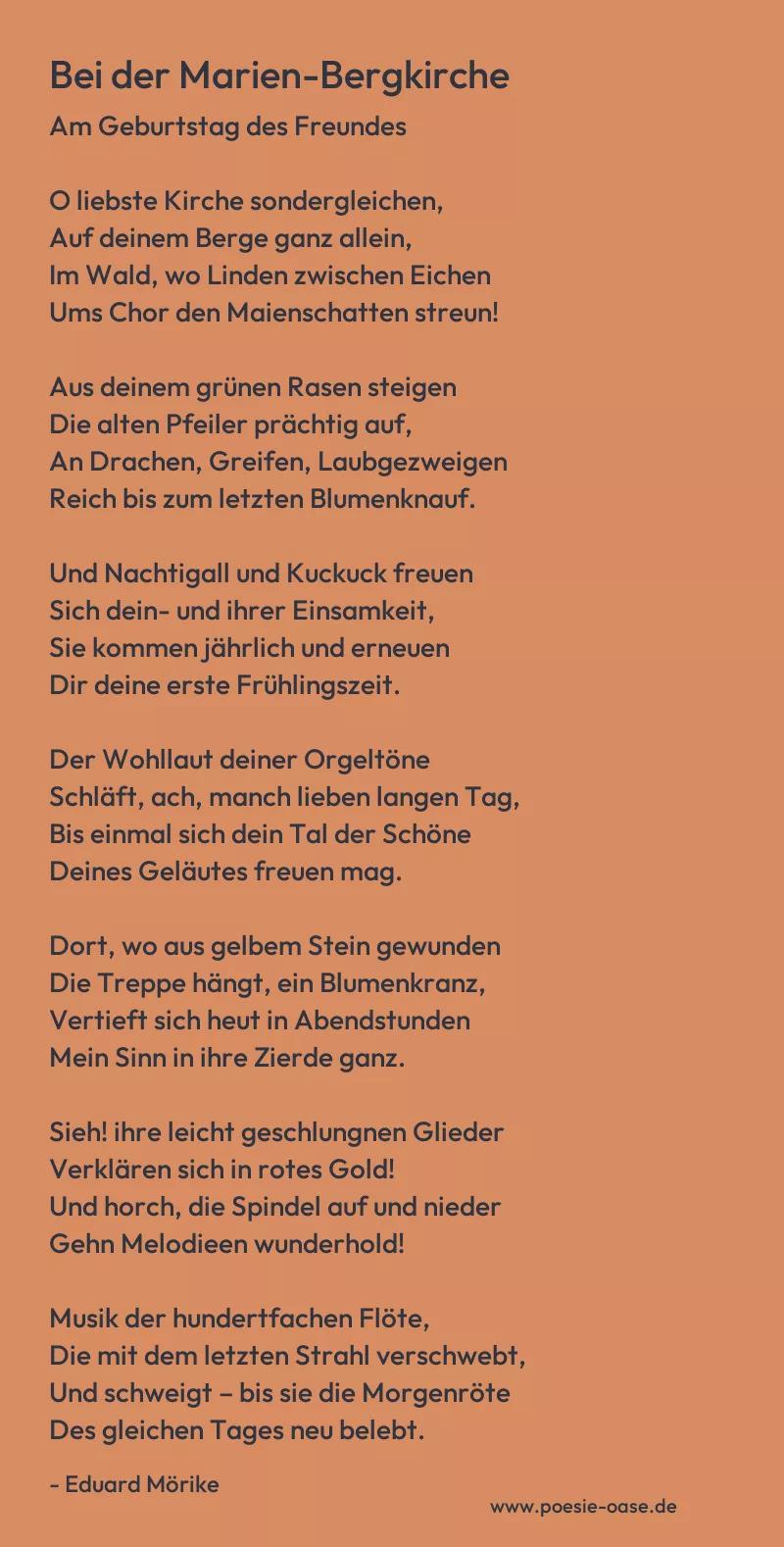
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Bei der Marien-Bergkirche“ von Eduard Mörike beschreibt eine meditative und naturverbundene Betrachtung einer Kirche, die durch ihre Abgeschiedenheit und Schönheit eine besonders tiefgehende Wirkung auf den lyrischen Sprecher ausübt. Die Kirche wird als „liebste Kirche sondergleichen“ dargestellt, was ihre Einzigartigkeit und spirituelle Bedeutung unterstreicht. Sie steht auf einem Berg, „ganz allein“, umgeben von einer Naturkulisse aus Linden, Eichen und Maienschatten, die dem Ort eine friedliche, fast heilige Atmosphäre verleihen.
Die Bildsprache des Gedichts verbindet Architektur und Natur miteinander. Die „alten Pfeiler“ der Kirche steigen „prächtig“ aus dem „grünen Rasen“ empor, und Drachen, Greifen sowie Laubzweige verzieren den Bau, was eine Verbindung zwischen mystischen, historischen und natürlichen Elementen herstellt. Diese Bilder sprechen von einer tiefen Verwurzelung in der Geschichte und der Natur und betonen die Harmonie, die zwischen dem menschlichen Bauwerk und seiner natürlichen Umgebung existiert.
Die Verse über die Vögel, insbesondere die „Nachtigall und Kuckuck“, die jedes Jahr zurückkehren, um der Einsamkeit der Kirche neue Frühlingsfreuden zu bringen, verstärken den Eindruck eines zyklischen, sich immer wieder erneuernden Lebens. Diese Vögel, die den Frühling einläuten, symbolisieren die ewige Erneuerung der Natur und das fortwährende Leben, das sich in der Kirche und ihrer Umgebung widerspiegelt. Die „Wohllaut der Orgeltöne“ wird als etwas seltenes und Schönes beschrieben, das „manch lieben langen Tag schläft“, was auf die stille, aber tiefgründige Wirkung der Musik und der Atmosphäre der Kirche hinweist.
In der letzten Strophe nimmt das Gedicht eine besonders meditative Wendung. Der lyrische Sprecher vertieft sich in die Betrachtung der „gelben Stein“-Treppe, die „leicht geschlungene Glieder“ hat und in „rotes Gold“ verklärt wird. Diese Bilder von Schönheit und Verwandlung tragen eine tief symbolische Bedeutung, die den Übergang von der physischen Welt in eine höhere, spirituelle Ebene widerspiegeln. Die „Spindel“ und die „Melodieen“, die in einer „hundertfachen Flöte“ zu hören sind, erzeugen ein Bild von Musik als einer transzendierenden Kraft, die sich in den Tag und die Nacht einfügt und bis zum nächsten Morgen weiterklingt.
Mörikes Gedicht ist eine poetische Hommage an die Verbindung von Natur, Architektur und Spiritualität, die in der Marien-Bergkirche ihren Ausdruck findet. Durch die Betrachtung dieser Kirche als einen Ort der Erneuerung und der stillen Schönheit vermittelt das Gedicht ein Gefühl der Harmonie und des Friedens, das sowohl die natürliche als auch die spirituelle Welt umfasst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.