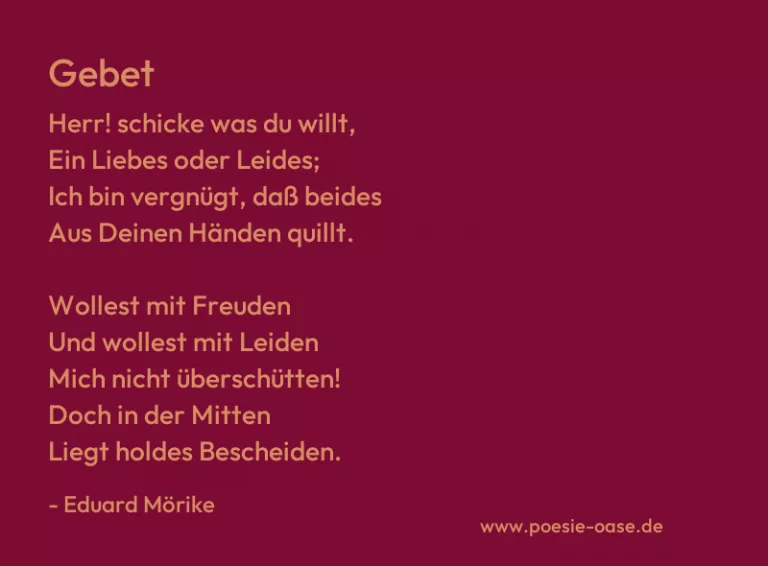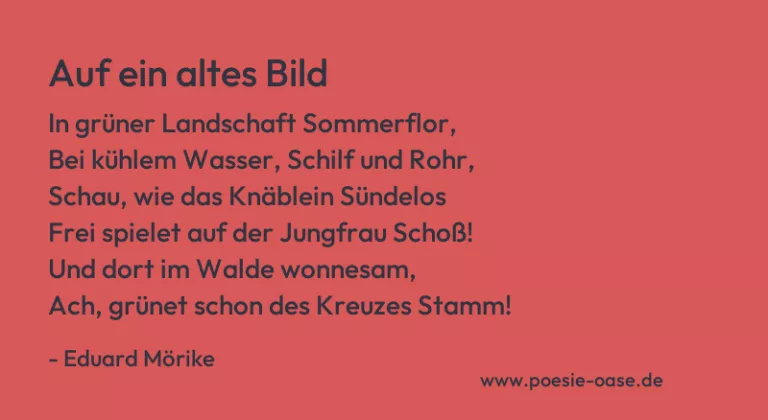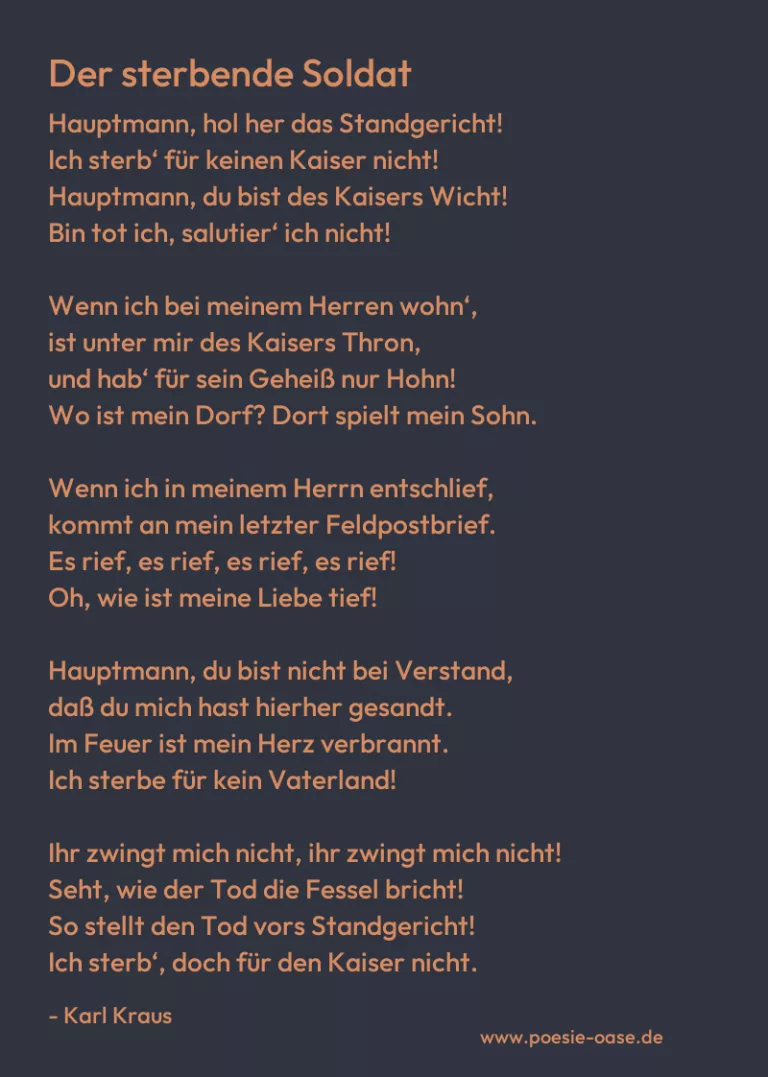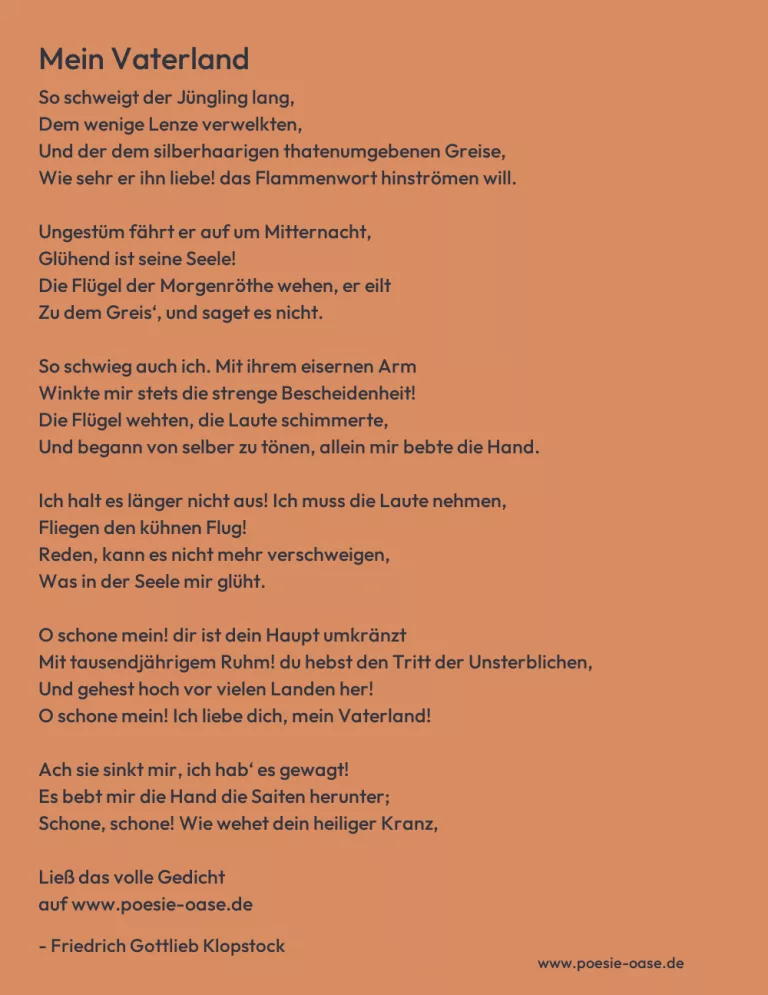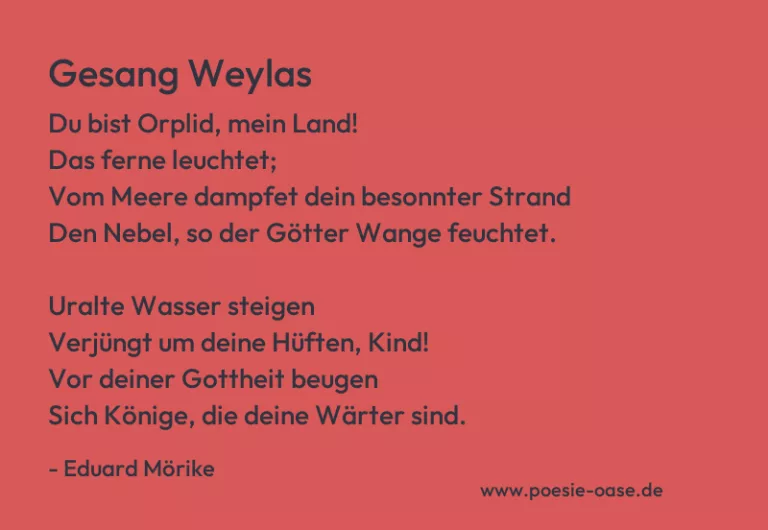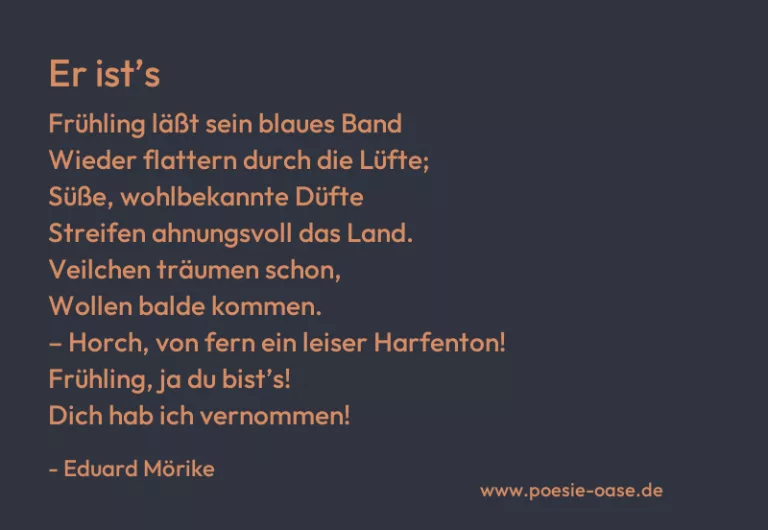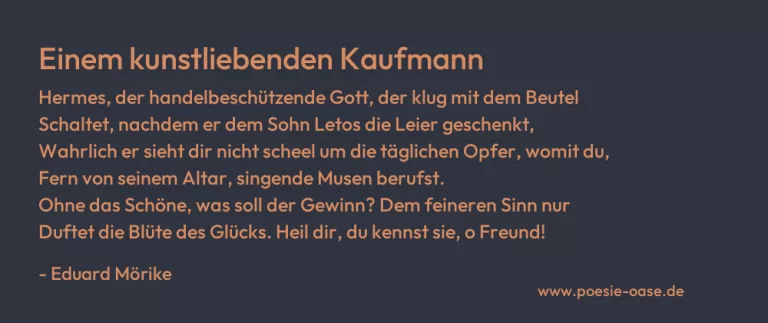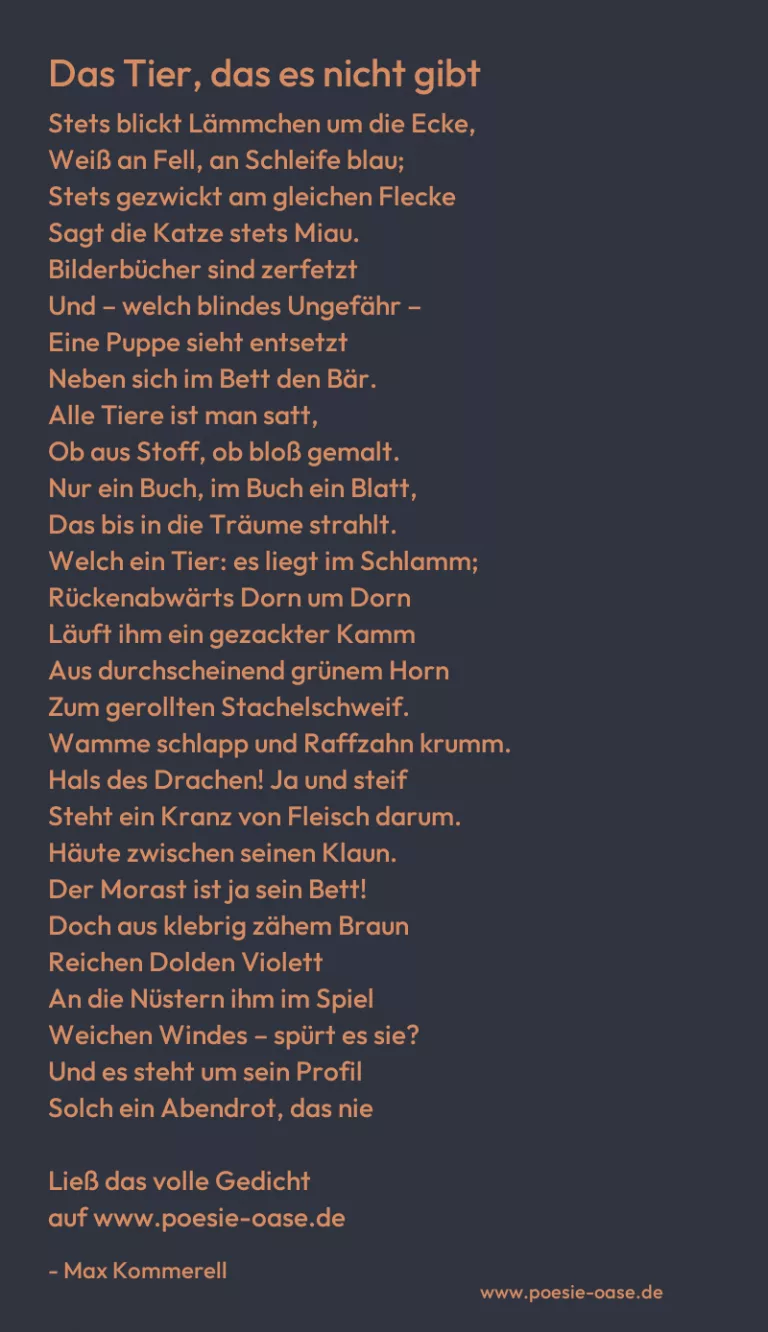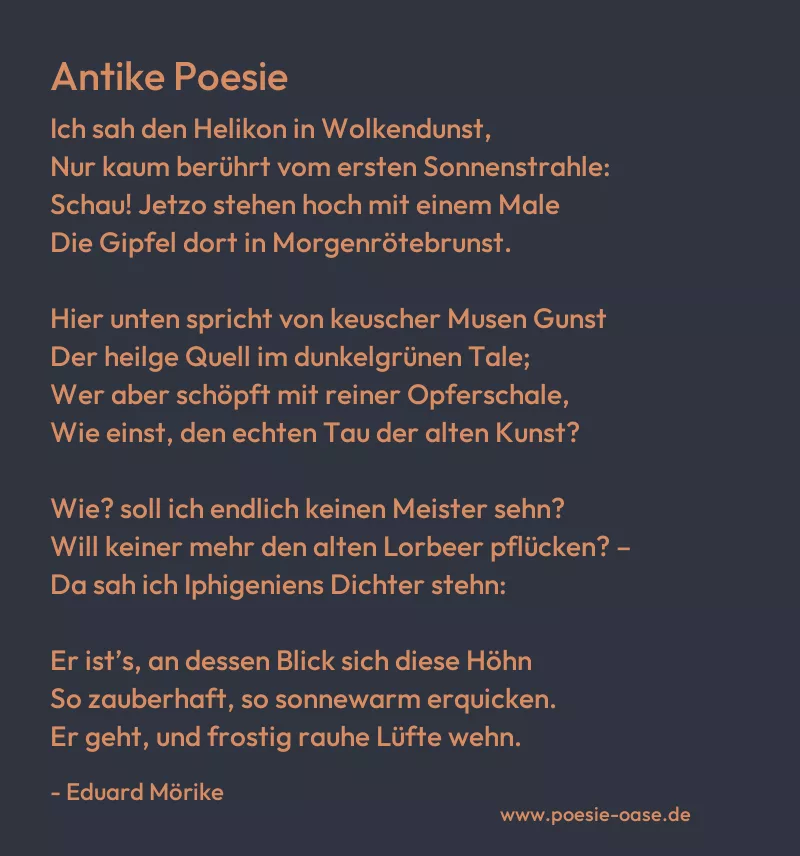Antike Poesie
Ich sah den Helikon in Wolkendunst,
Nur kaum berührt vom ersten Sonnenstrahle:
Schau! Jetzo stehen hoch mit einem Male
Die Gipfel dort in Morgenrötebrunst.
Hier unten spricht von keuscher Musen Gunst
Der heilge Quell im dunkelgrünen Tale;
Wer aber schöpft mit reiner Opferschale,
Wie einst, den echten Tau der alten Kunst?
Wie? soll ich endlich keinen Meister sehn?
Will keiner mehr den alten Lorbeer pflücken? –
Da sah ich Iphigeniens Dichter stehn:
Er ist’s, an dessen Blick sich diese Höhn
So zauberhaft, so sonnewarm erquicken.
Er geht, und frostig rauhe Lüfte wehn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
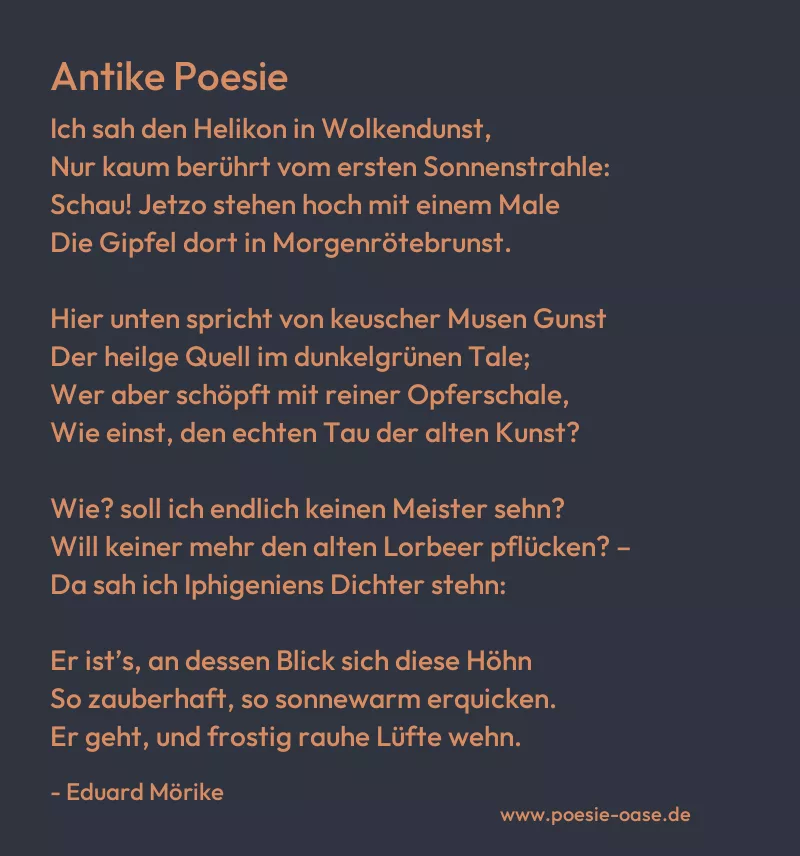
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Antike Poesie“ von Eduard Mörike thematisiert die Suche nach der Inspiration und der Weisheit der antiken Kunst sowie die Sehnsucht nach einem idealisierten künstlerischen Zustand. Zu Beginn wird der „Helikon“ – der sagenhafte Berg der Musen in der griechischen Mythologie – in einem „Wolkendunst“ beschrieben, nur „kaum berührt vom ersten Sonnenstrahle“. Diese Beschreibung erzeugt ein Bild der Unklarheit und des Übergangs, in dem der „Helikon“ noch nicht in voller Klarheit und Schönheit erstrahlt, was auf das bevorstehende Erwachen der Kunst und Inspiration hinweist. Der „erste Sonnenstrahl“ könnte als Metapher für den Moment der Erleuchtung und des kreativen Aufbruchs verstanden werden.
Die „Gipfel“ des Berges erstrahlen dann in der „Morgenrötebrunst“, was die vollkommene Erleuchtung und den Triumph der Inspiration symbolisiert. Der „heilge Quell“ im „dunkelgrünen Tale“, der von „keuscher Musen Gunst“ spricht, verweist auf den Ursprung der künstlerischen Kreativität und die Reinheit der antiken Kunst. Doch die Frage, die Mörike stellt, ist, wer heute noch in der Lage ist, den „echten Tau der alten Kunst“ zu schöpfen. Diese Frage deutet auf die Entfremdung der modernen Kunst von ihren antiken Wurzeln hin und die Sehnsucht nach der Reinheit und der Tiefe der klassischen Kunsttradition.
Der Sprecher fragt sich, warum es keinen „Meister“ mehr gibt, der „den alten Lorbeer pflücken“ kann – ein Hinweis auf den Verlust der Fähigkeit, wahre Kunst und Weisheit zu erschaffen. Diese Klage nach dem Fehlen eines würdigen Nachfolgers für die alten Meister verstärkt die Idee, dass die moderne Kunst nicht mehr die gleiche Tiefe und Erhabenheit erreicht wie die klassische. Doch dann erscheint die Figur des „Iphigeniens Dichters“, der als der wahre Meister erkannt wird. Iphigenie, eine Figur aus der griechischen Tragödie, wird hier als Symbol für die Kunst und den Dichter dargestellt, der in der Lage ist, die „Höhen“ des Wissens und der Kunst zu erwecken. Dieser Dichter bringt die „zauberhafte“ und „sonnewarme“ Erleuchtung und lässt die „Höhen“ des Helikon erblühen.
Am Ende des Gedichts, wenn der Dichter weitergeht, wehen „frostig rauhe Lüfte“, was eine Veränderung in der Atmosphäre und möglicherweise das Ende der poetischen Erleuchtung darstellt. Diese kalte, raue Brise könnte das Fehlen von wahrer künstlerischer Inspiration in der modernen Welt symbolisieren, die Mörike in seinem Gedicht beklagt. Der Dichter geht, und mit ihm verschwindet die warme, lebendige Inspiration, was die Rückkehr der Kälte und des Absterbens der Kunst andeutet. Mörike schafft hier ein Bild von verlorener Kunst und der Sehnsucht nach der Rückkehr zu einer wahren, klassischen Quelle der Inspiration und des künstlerischen Schaffens. Das Gedicht ist eine Meditation über den Verlust der poetischen Reinheit und die Schwierigkeit, in der modernen Welt eine Verbindung zur alten, erhabenen Kunst herzustellen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.