Angenehmes Frühlingskindchen,
Kleines Taubenhyazinthchen,
Deiner Farb und Bildung Zier
Zeiget mit Verwunderung mir
Von der bildenden Natur
eine neue Schönheitsspur.
An des Stengels blauer Spitzen
Sieht man, wenn man billig sieht,
Deiner sonderbaren Blüt
Kleine blaue Kugeln sitzen,
Dran, so lange sich ihr Blatt
Noch nicht aufgeschlossen hat,
Wie ein Purpurstern sie schmücken,
Man nicht sonder Lust erblicket.
Aber wie von ungefähr
Meine Blicke hin und her
Auf die offnen Blumen liefen,
Konnt ich in den blauen Tiefen
Wie aus himmelblauen Höhen
Silberweiße Sternchen sehen,
Die in einer blauen Nacht,
So sie rings bedeckt, im Dunkeln
Mit dadurch erhöhter Pracht
Noch um desto heller funkeln.
Ihr so zierliches Gepränge,
Ihre Nettigkeit und Menge,
Die die blauen Tiefen füllt,
Schiene mir des Himmels Bild,
Welches meine Seele rührte
Und durch dieser Sternen Schein,
Die so zierlich, rein und klein,
Mich zum Herrn der Sterne führte,
Dessen unumschränkte Macht
aller Himmel tiefe Meere,
Aller Welt- und Sonnen Heere
Durch ein Wort hervorgebracht;
Dem es ja so leicht, die Pracht
In den himmlischen Gefilden
Als die Sternchen hier zu bilden.
Durch dein sternenförmig Wesen
Gibst du mir, beliebte Blume,
ein′ Erinnerung zu lesen,
Dass wir seiner nicht vergessen,
Sondern in den schönen Werken
Seine Gegenwart bemerken,
Seine weise Macht ermessen
Und sie wie in jenen Höhen
So auf Erden auch zu sehen.
Die Traubenhyazinthe
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
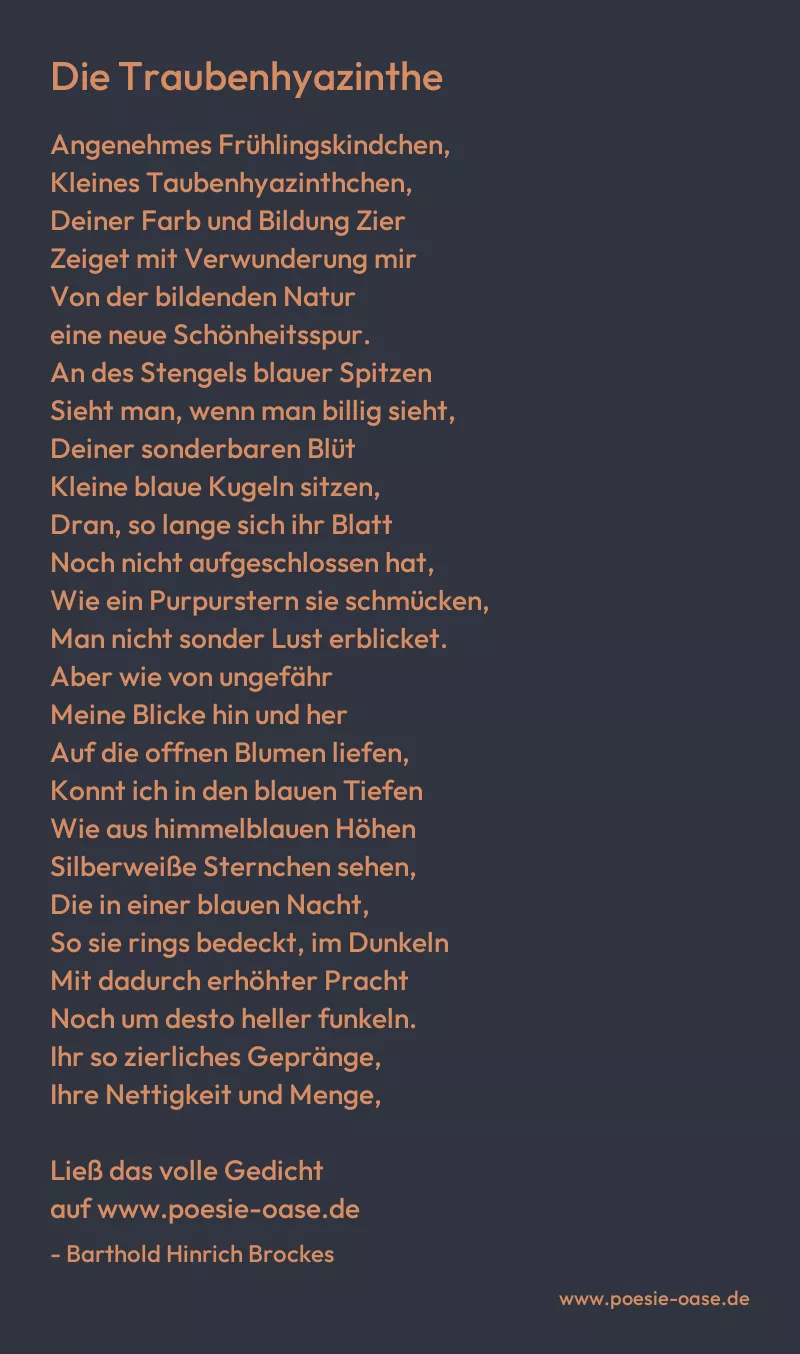
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Traubenhyazinthe“ von Barthold Hinrich Brockes ist eine poetische Ode an die Schönheit und göttliche Schöpfung, die in der kleinen Traubenhyazinthe offenbart wird. Es beginnt mit der direkten Ansprache der Blume als „angenehmes Frühlingskindchen“, wobei sofort eine liebevolle und bewundernde Haltung des Dichters erkennbar wird. Die anfängliche Beschreibung konzentriert sich auf die ästhetischen Merkmale der Pflanze, insbesondere auf die blaue Farbe, die als „Zier“ und „Schönheitsspur“ gelobt wird. Der Dichter betrachtet die Blüte als ein Wunder der Natur, das seine Bewunderung weckt und ihn dazu anregt, über die Schönheit der Schöpfung nachzudenken.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft die Beschreibung und geht auf die Details der Blüten ein. Brockes beschreibt die kleinen, blauen Kugeln an den Spitzen des Stängels, die von „Purpurstern“ geschmückt werden. Der Übergang zu den „silberweißen Sternchen“ im Inneren der geöffneten Blüten ist von besonderer Bedeutung. Diese Sternchen werden mit den Sternen am Himmel verglichen, was eine deutliche Verbindung zwischen der irdischen Blume und dem himmlischen Reich herstellt. Der Dichter scheint in der Traubenhyazinthe eine Miniaturversion des Himmels zu sehen, was seine Bewunderung und Ehrfurcht noch verstärkt.
Die zentrale Aussage des Gedichts liegt in der Verknüpfung der irdischen Schönheit der Blume mit der göttlichen Schöpfung. Durch die Betrachtung der Traubenhyazinthe fühlt sich der Dichter an den Schöpfergott erinnert. Die „zierlichen, reinen und kleinen“ Sternchen der Blume führen ihn zum „Herrn der Sterne“, dessen unendliche Macht die gesamte Welt hervorgebracht hat. Die Blume dient als ein Sinnbild der göttlichen Gegenwart und als ein Zeichen der allgegenwärtigen Schöpfungskraft. Brockes vermittelt die Botschaft, dass Gott sowohl in den „himmlischen Gefilden“ als auch in den einfachen Dingen der Erde, wie der Traubenhyazinthe, zu finden ist.
Das Gedicht endet mit einer Aufforderung, die Schönheit der Blume als eine Erinnerung an Gott zu betrachten. Die Traubenhyazinthe soll uns lehren, die Gegenwart Gottes in den Werken der Schöpfung zu erkennen und seine weise Macht zu würdigen. Der Dichter verbindet Naturbeobachtung mit religiöser Kontemplation und zeigt, wie die Betrachtung der Schönheit der Welt zu einer Vertiefung des Glaubens führen kann. Die Blume wird somit zu einem Symbol der Hoffnung und der Inspiration, die uns dazu anregen soll, die Spuren Gottes überall zu erkennen und zu schätzen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
