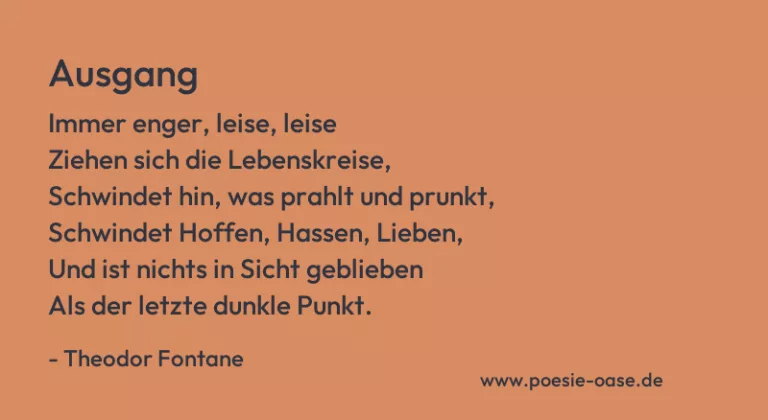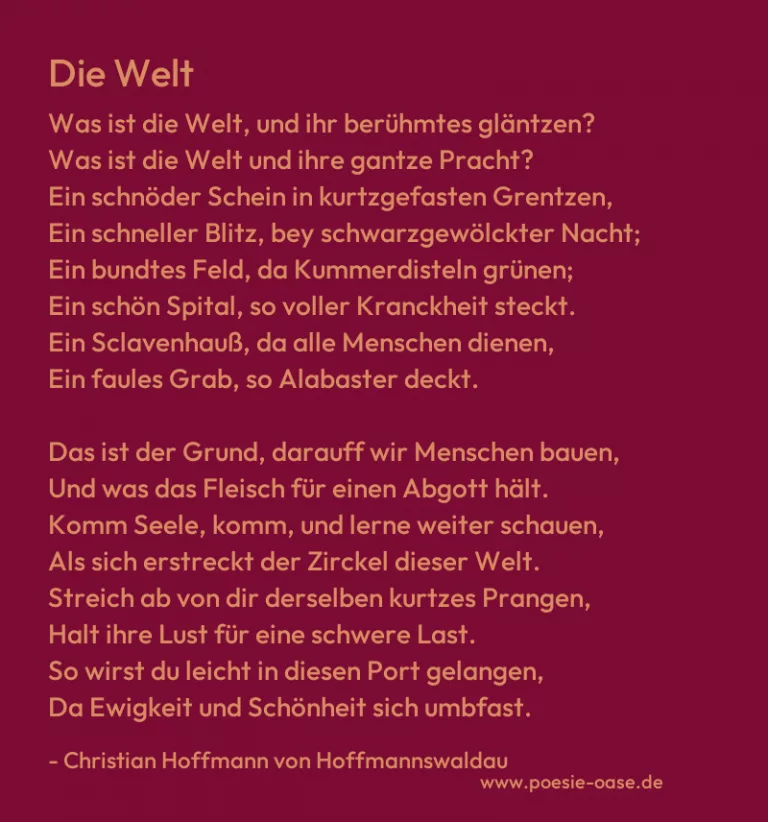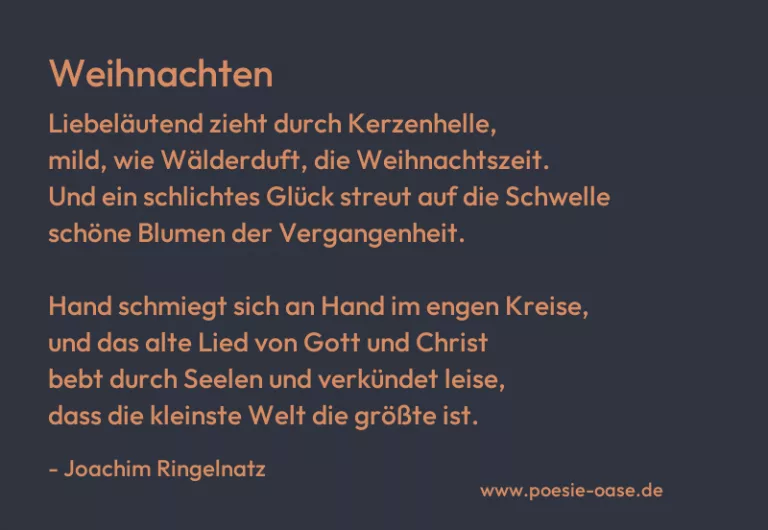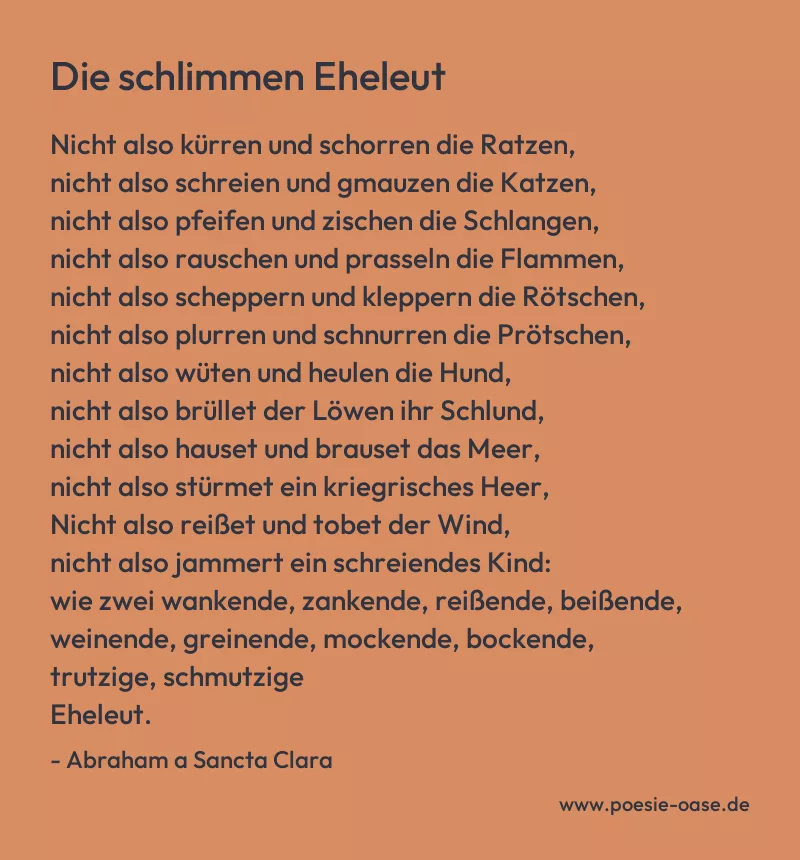Die schlimmen Eheleut
Nicht also kürren und schorren die Ratzen,
nicht also schreien und gmauzen die Katzen,
nicht also pfeifen und zischen die Schlangen,
nicht also rauschen und prasseln die Flammen,
nicht also scheppern und kleppern die Rötschen,
nicht also plurren und schnurren die Prötschen,
nicht also wüten und heulen die Hund,
nicht also brüllet der Löwen ihr Schlund,
nicht also hauset und brauset das Meer,
nicht also stürmet ein kriegrisches Heer,
Nicht also reißet und tobet der Wind,
nicht also jammert ein schreiendes Kind:
wie zwei wankende, zankende, reißende, beißende,
weinende, greinende, mockende, bockende,
trutzige, schmutzige
Eheleut.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
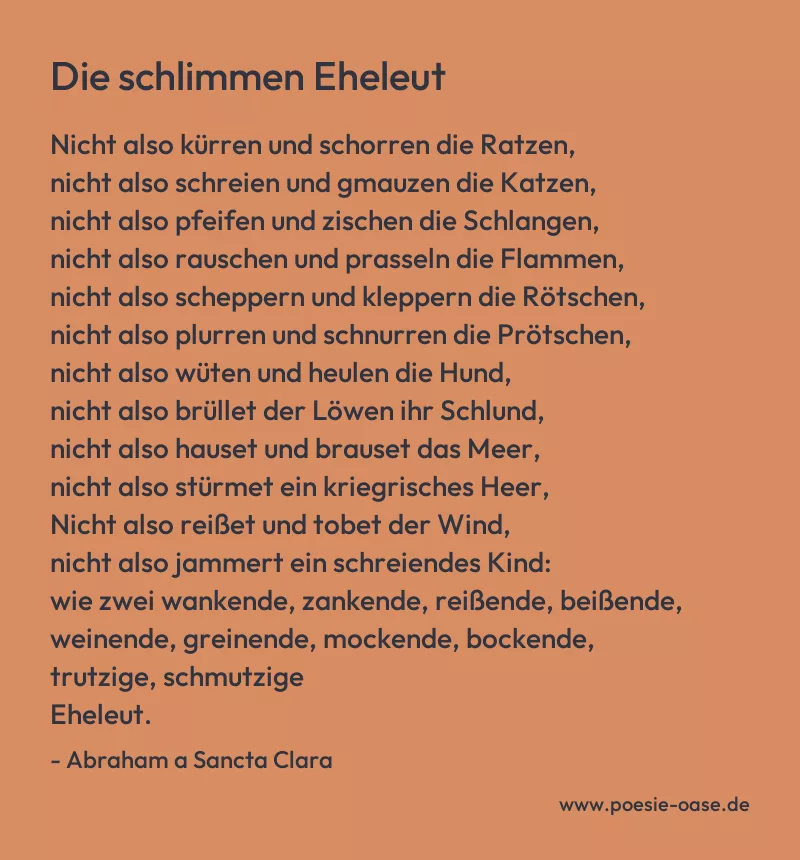
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die schlimmen Eheleut“ von Abraham a Sancta Clara präsentiert eine drastische und humorvolle Satire auf eheliche Konflikte. Es beginnt mit einer Reihe von negativen Vergleichen, die darauf abzielen, die Intensität und Hässlichkeit des Streitens zwischen Eheleuten zu veranschaulichen. Durch die Verwendung einer Liste von unappetitlichen und unangenehmen Naturerscheinungen und Tiergeräuschen wird der Leser in eine Welt der Hässlichkeit und des Chaos eingeführt. Der Autor vergleicht das Streiten der Eheleute mit den Geräuschen und Bewegungen von Ratten, Katzen, Schlangen, Flammen, und anderen unschönen Phänomenen.
Der Clou des Gedichts liegt in der Steigerung und schließlich in der Pointe. Nach all den Vergleichen, die die Hässlichkeit des ehelichen Streits betonen, kulminiert das Gedicht in einer Reihe von Adjektiven, die das Verhalten der streitenden Eheleute beschreiben: „wankende, zankende, reißende, beißende, weinende, greinende, mockende, bockende, trutzige, schmutzige“. Diese Aufzählung von negativen Eigenschaften verdichtet das Bild der Eheleute zu einer Karikatur, die gleichzeitig komisch und erschreckend wirkt. Das Gedicht übertreibt bewusst, um eine deutliche Botschaft zu vermitteln.
Die Verwendung von Alliterationen wie „schreien und gmauzen“, „pfeifen und zischen“ und „scheppern und kleppern“ verstärkt den rhythmischen und fast musikalischen Charakter des Gedichts, was den Effekt des Geplänkels und der Unaufhörlichkeit des Streits unterstreicht. Diese sprachlichen Mittel tragen dazu bei, eine lebhafte und denkwürdige Szene zu schaffen. Die Verwendung von teils altertümlicher Sprache und ungewöhnlichen Wörtern wie „Rötschen“ und „Prötschen“ verleiht dem Gedicht eine zusätzliche Note von Humor und Exzentrik.
Die Satire in diesem Gedicht dient nicht nur der Unterhaltung, sondern auch einer tiefgreifenden Kritik an der Ehe. Der Autor prangert die hässlichen Seiten des Zusammenlebens an und entlarvt die Ehekrisen, die durch Streitereien und Konflikte entstehen. Indem er die Eheleute mit Tieren und Naturphänomenen vergleicht, entindividualisiert er sie und reduziert sie auf ihre primitivsten Verhaltensweisen, um die Absurdität und Hässlichkeit des Streits zu betonen. Das Gedicht ist somit eine Warnung vor den Fallstricken einer konfliktreichen Beziehung und gleichzeitig eine humorvolle Betrachtung menschlicher Schwächen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.