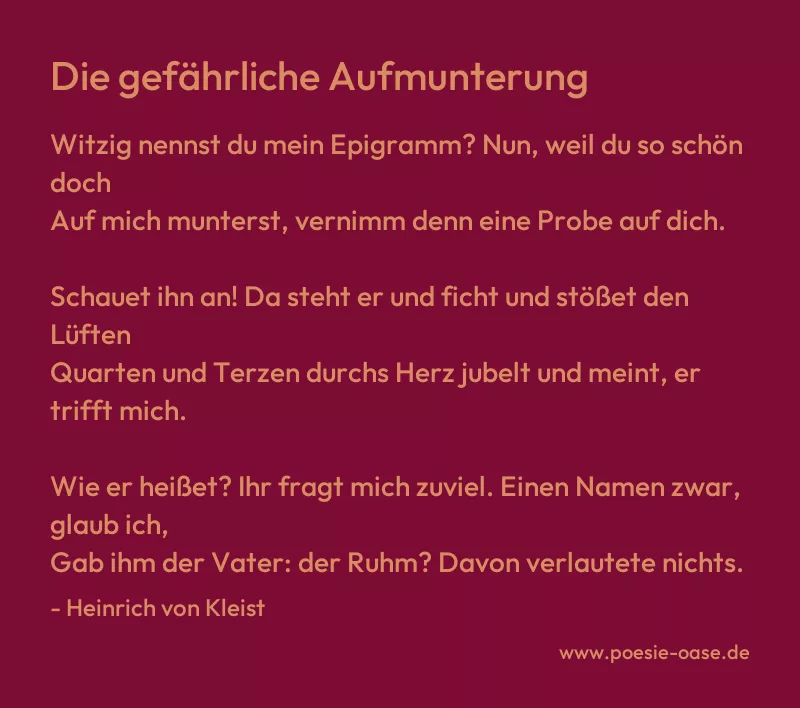Die gefährliche Aufmunterung
Witzig nennst du mein Epigramm? Nun, weil du so schön doch
Auf mich munterst, vernimm denn eine Probe auf dich.
Schauet ihn an! Da steht er und ficht und stößet den Lüften
Quarten und Terzen durchs Herz jubelt und meint, er trifft mich.
Wie er heißet? Ihr fragt mich zuviel. Einen Namen zwar, glaub ich,
Gab ihm der Vater: der Ruhm? Davon verlautete nichts.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
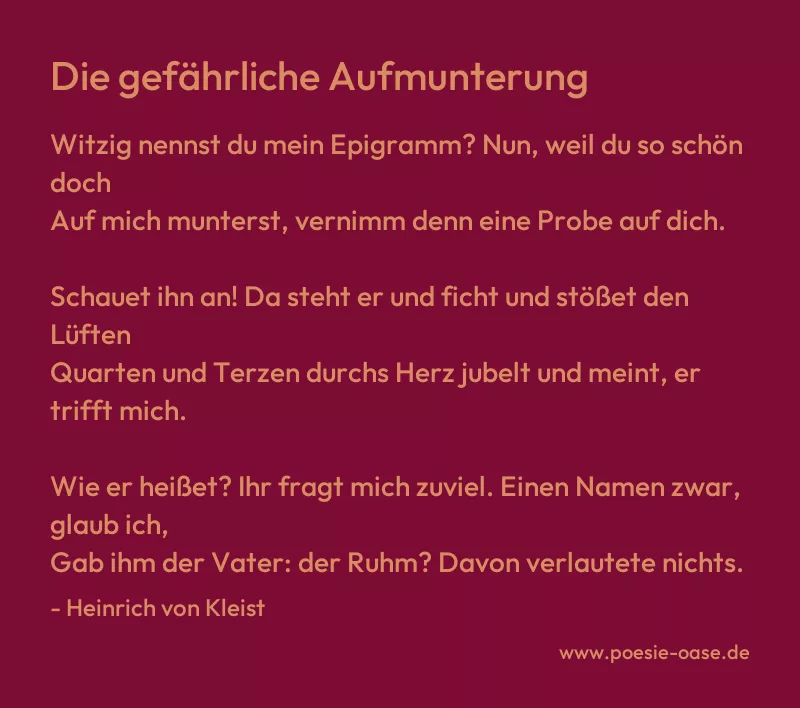
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die gefährliche Aufmunterung“ von Heinrich von Kleist ist eine bissige Reaktion auf einen Gesprächspartner, der das vorhergehende Werk des Dichters als „witzig“ bezeichnet hat. Es offenbart eine Mischung aus Ironie, Selbstbewusstsein und Kritik an der oberflächlichen Wahrnehmung des Gegenübers. Der Autor nutzt die Gelegenheit, um seinen Kritiker zu entlarven und gleichzeitig die eigene Kunstfertigkeit zu betonen.
Der erste Teil des Gedichts ist durch eine direkte Ansprache gekennzeichnet: „Witzig nennst du mein Epigramm?“ Dies deutet auf einen Dialog hin, in dem der Dichter nun die Reaktion des anderen kommentiert. Die ironische Haltung des Dichters wird durch die anschließende Aufforderung „vernimm denn eine Probe auf dich“ unterstrichen. Hier wird deutlich, dass Kleist nicht nur die Kritik ablehnt, sondern auch eine Gegenprobe liefert, um die eigene Kunst zu verteidigen. Der Dichter stellt seinen Kritiker vor und weist ihn auf dessen Unfähigkeit hin, die Tiefe und den Wert des Werkes zu erkennen.
Der zweite Teil des Gedichts enthält eine verächtliche Beschreibung des Kritikers. Die bildhafte Darstellung, in der der Kritiker wie ein Fechter „Quarten und Terzen durchs Herz jubelt“, zeigt Kleists Spott. Der Kritiker wird als jemand dargestellt, der sich in oberflächlichen Übungen verliert und dabei die wahre Kunstfertigkeit verfehlt. Durch die rhetorische Frage „Wie er heißet? Ihr fragt mich zuviel“ wird die Bedeutungslosigkeit des Kritikers und seiner Meinung betont. Die letzte Zeile deutet an, dass dem Kritiker der Ruhm, also eine Anerkennung seiner Leistung, verwehrt wird, was die Ablehnung der Kritik noch verstärkt.
Die Stärke des Gedichts liegt in der Kombination aus Ironie, Selbstbehauptung und einer subtilen Kritik am oberflächlichen Verständnis von Kunst. Kleist nutzt geschickt seine Sprachgewalt, um den Kritiker zu entlarven und gleichzeitig die eigene Position zu stärken. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Reaktion auf eine bestimmte Kritik, sondern auch eine Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Wert und der Bedeutung von Kunst und Kritik. Kleist stellt klar, dass wahre Kunst tiefgründiger ist, als es der Kritiker zu erkennen vermag.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.