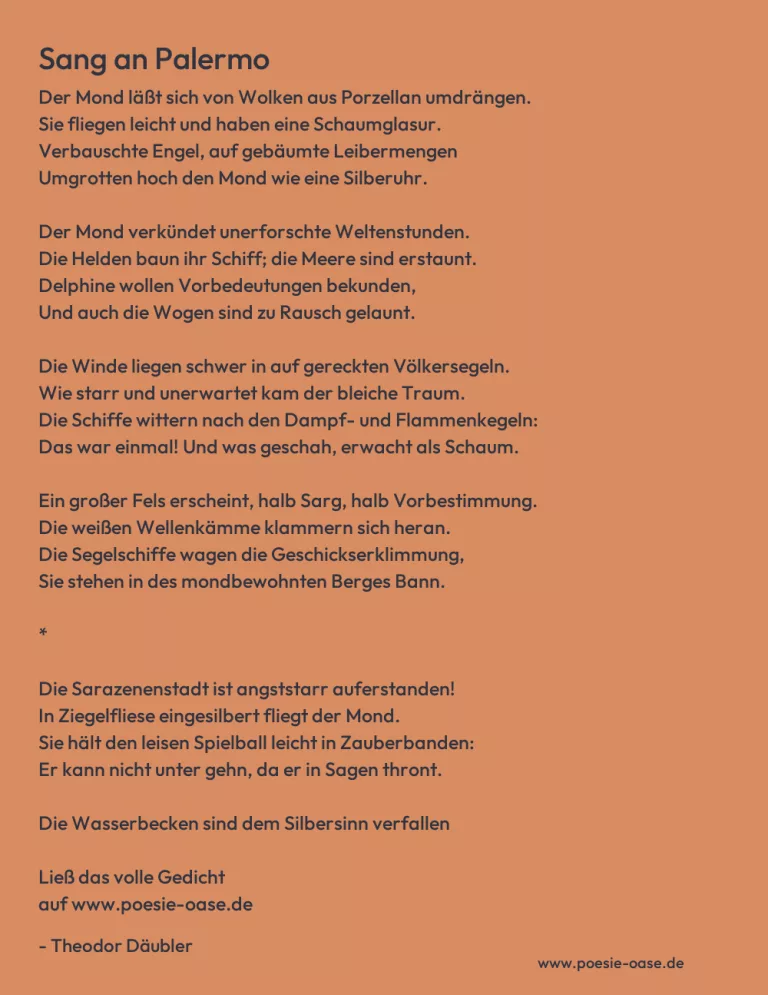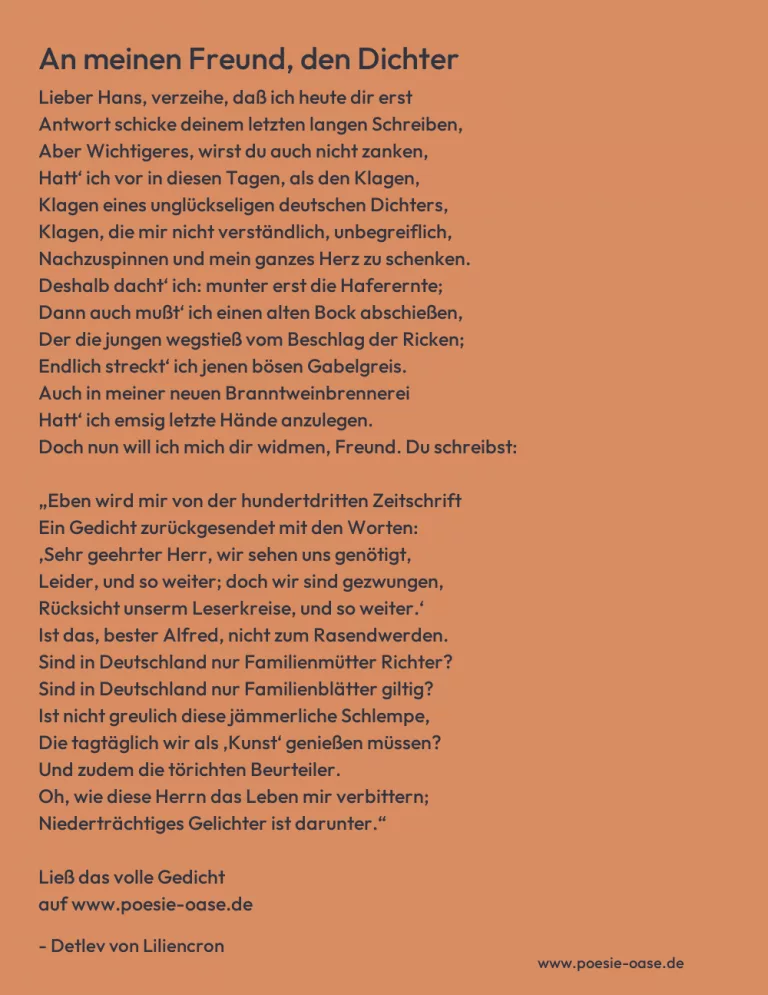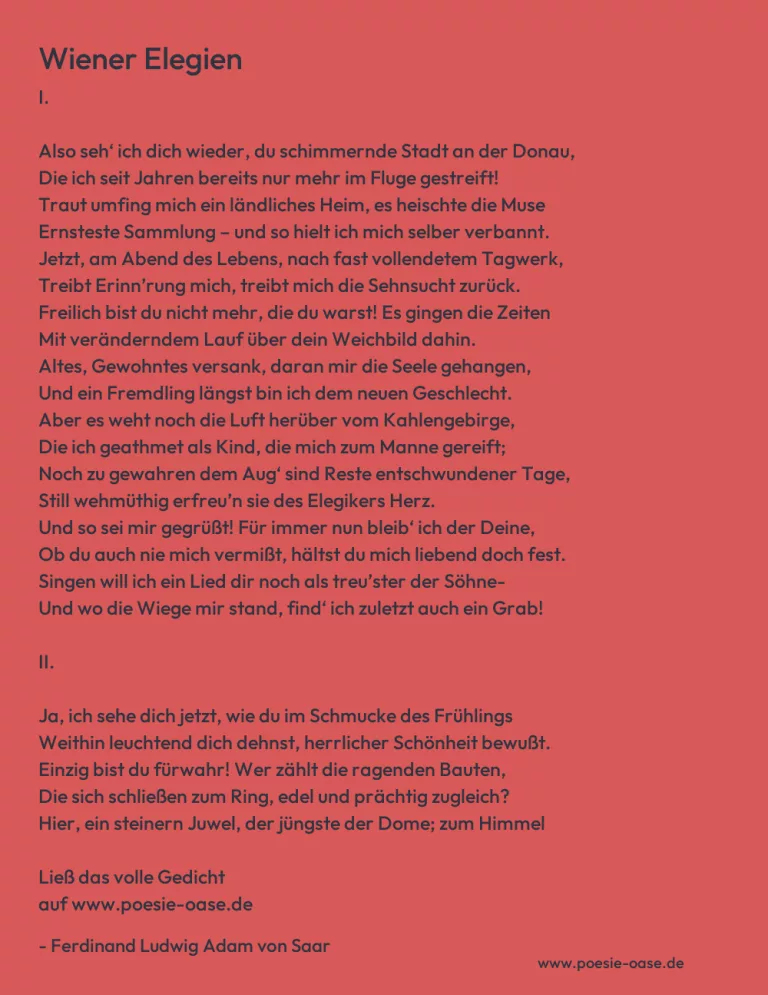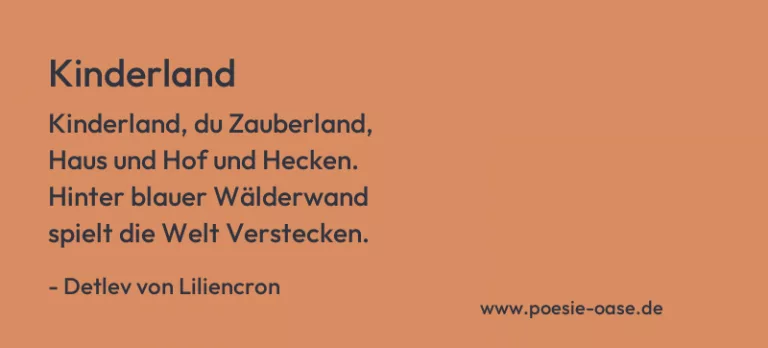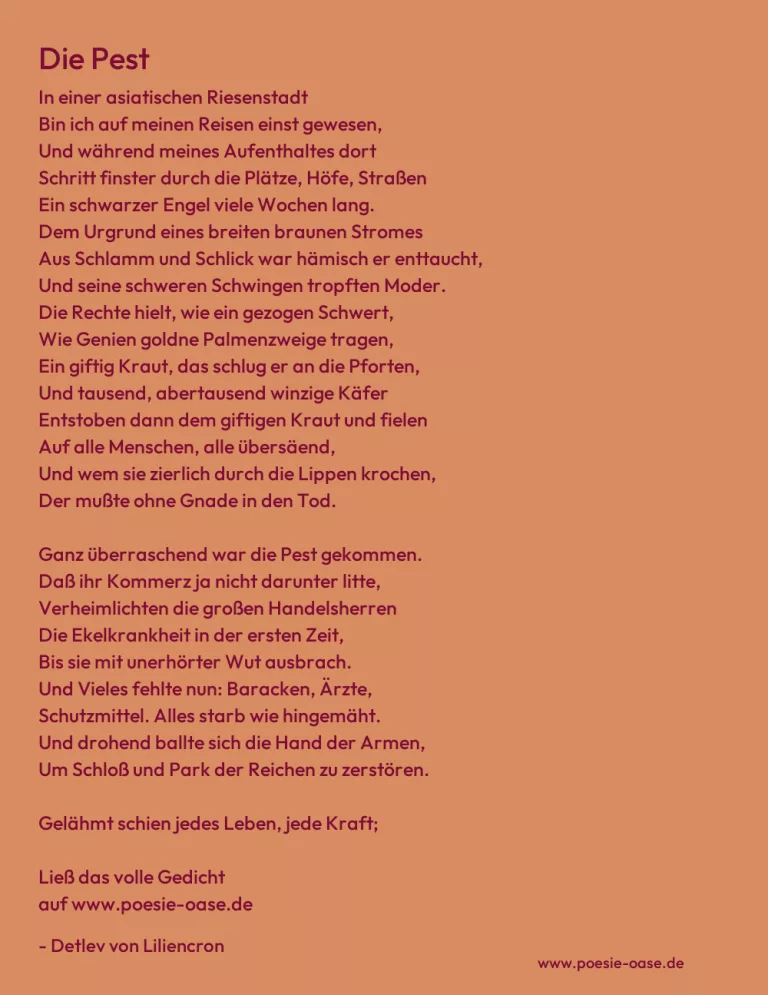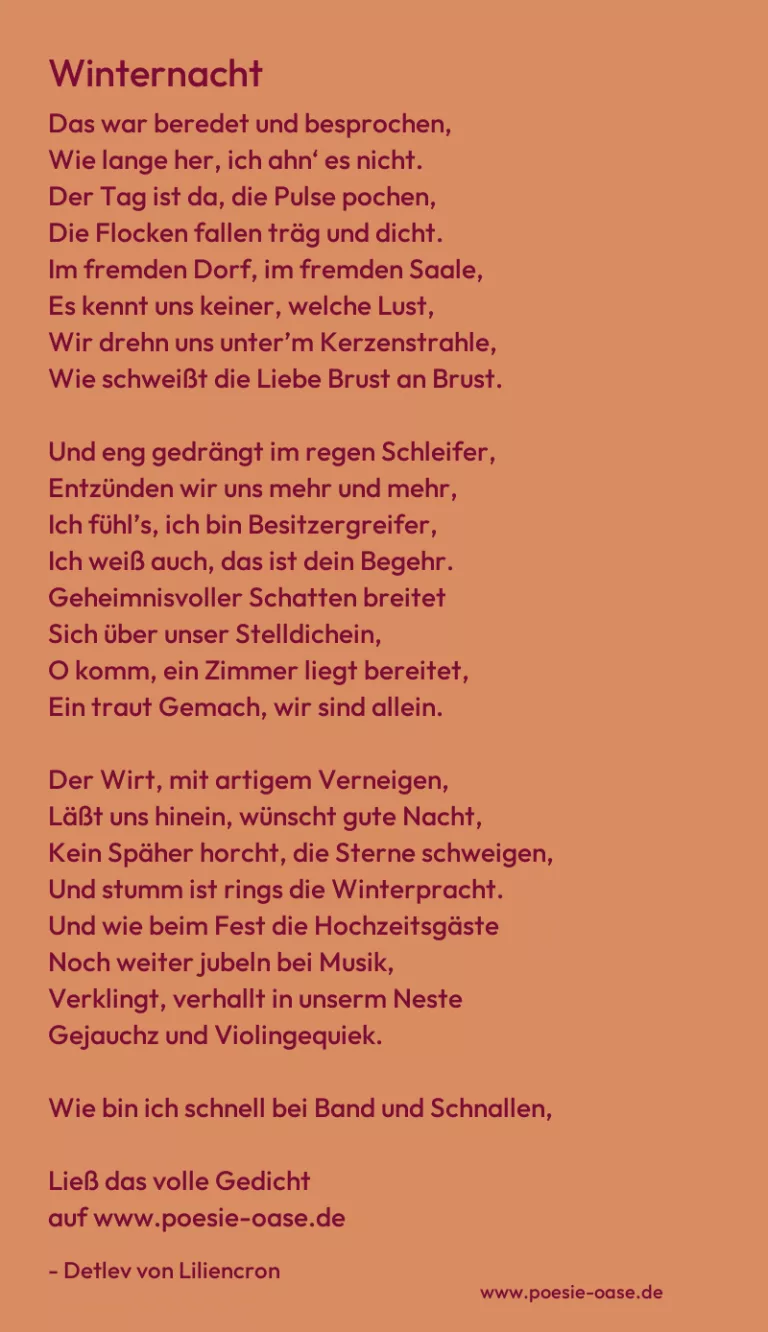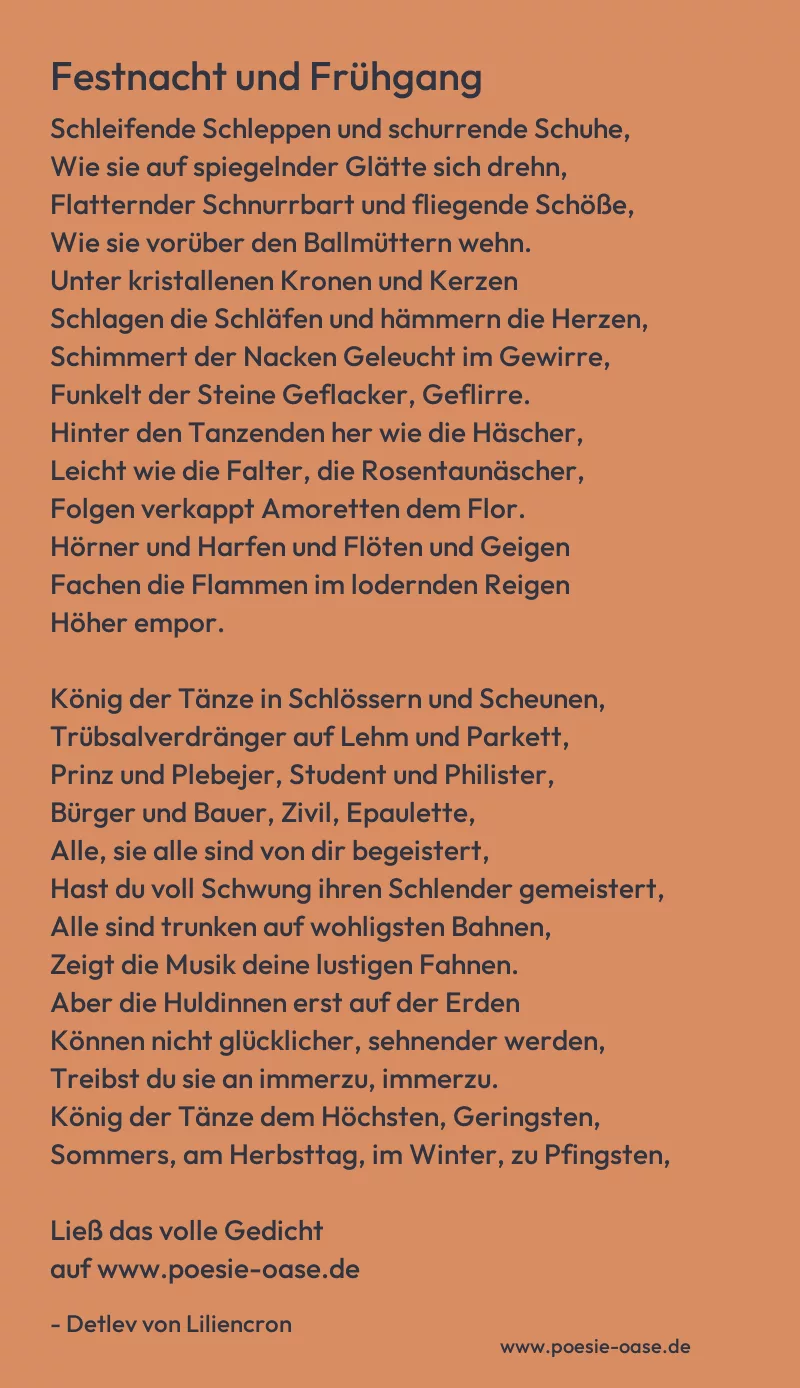Schleifende Schleppen und schurrende Schuhe,
Wie sie auf spiegelnder Glätte sich drehn,
Flatternder Schnurrbart und fliegende Schöße,
Wie sie vorüber den Ballmüttern wehn.
Unter kristallenen Kronen und Kerzen
Schlagen die Schläfen und hämmern die Herzen,
Schimmert der Nacken Geleucht im Gewirre,
Funkelt der Steine Geflacker, Geflirre.
Hinter den Tanzenden her wie die Häscher,
Leicht wie die Falter, die Rosentaunäscher,
Folgen verkappt Amoretten dem Flor.
Hörner und Harfen und Flöten und Geigen
Fachen die Flammen im lodernden Reigen
Höher empor.
König der Tänze in Schlössern und Scheunen,
Trübsalverdränger auf Lehm und Parkett,
Prinz und Plebejer, Student und Philister,
Bürger und Bauer, Zivil, Epaulette,
Alle, sie alle sind von dir begeistert,
Hast du voll Schwung ihren Schlender gemeistert,
Alle sind trunken auf wohligsten Bahnen,
Zeigt die Musik deine lustigen Fahnen.
Aber die Huldinnen erst auf der Erden
Können nicht glücklicher, sehnender werden,
Treibst du sie an immerzu, immerzu.
König der Tänze dem Höchsten, Geringsten,
Sommers, am Herbsttag, im Winter, zu Pfingsten,
Walzer, bist du.
Und mit dem schönsten, dem fröhlichsten Mädchen
Walz ich heut abend zum andern Mal schon,
Eben erst traf sie mein leuchtendes Auge,
Und meine Seele hob hoch sie zu Thron.
Aus der Umgürtelung enger Verkettung
Laß ich nicht locker, hier ist keine Rettung,
Und ich verspüre so holdes Entzücken,
Muß ihr das Händchen ganz sanftiglich drücken.
Bin ich im Himmel, ich fühl ihre Finger
Zärtlicher spannen, die Seligkeitsbringer,
Und meine Liebe nimmt stürmisch Besitz.
Als ich mich endlich am Platz ihr verbeuge,
Schlug aus den Wimpern ihr, bündiger Zeuge,
Zündender Blitz.
Kehraus und Ende, der Braus ist vorüber,
Und es entleert sich allmählich der Saal,
Letztes Gutnacht, Durcheinander und Trinkgeld
Schon in Kapuzen und Mänteln und Shawl.
Schläfrige Kutscher, die gähnend sich recken,
Rasch von den Pferden gezogene Decken,
Licht und Laternen und Räumen und Rufen,
Niederwärtssteigen auf marmornen Stufen.
Nur meine Tänzerin fand nicht den Wagen,
Hab ich ihr gleich meinen Schutz angetragen,
Hüllte sie ein in den leichtesten Pelz.
Ach, das Figürchen im Zobel zu schauen,
Sonniger Maitag im Gletschertrachtgrauen,
Jugend und Schmelz.
Wir wandern durch die stumme Nacht,
Der Tamtam ist verklungen,
Du schmiegst an meine Brust dich an,
Ich halte dich umschlungen.
Und wo die dunklen Ypern stehn,
Ernst wie ein schwarz Gerüste,
Da fand ich deinen kleinen Mund,
Die rote Perlenküste.
Und langsam sind wir weiter dann,
Weiß ich’s, wohin gegangen.
Ein hellblau Band im Morgen hing,
Der Tag hat angefangen.
Um Ostern war’s, der Frühling will
Den letzten Frost entthronen,
Du pflücktest einen Kranz für mich
Von weißen Anemonen.
Den legtest du mir um die Stirn,
Die Sonne kam gezogen
Und hat dir blendend um dein Haupt
Ein Diadem gebogen.
Du lehntest dich auf meinen Arm,
Wir träumten ohn‘ Ermessen.
Die Menschen all im Lärm der Welt,
Die hatten wir vergessen.