Nur die Meute, fürcht ich, die wird in W … mit Glück nicht
Heulen, Lieber; den Lärm setz ich, vergönn, in Musik.
Der Theater-Bearbeiter der Penthesilea
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
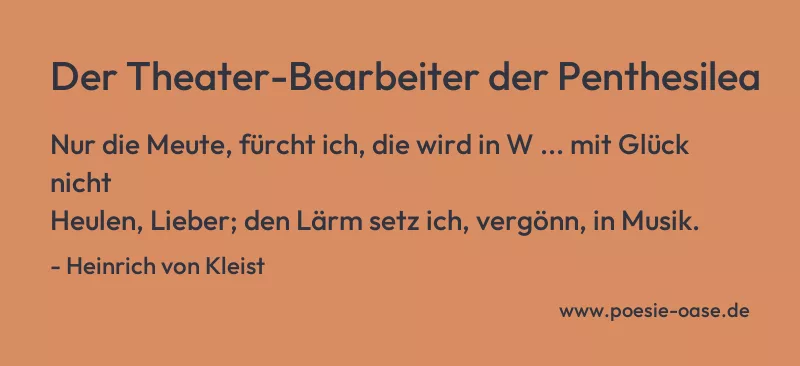
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Theater-Bearbeiter der Penthesilea“ von Heinrich von Kleist ist eine sehr kurze, knappe Aussage, die sich auf die Rezeption von Kleists Drama „Penthesilea“ bezieht. Es drückt eine Befürchtung und einen Wunsch aus, der sich auf die Reaktion des Publikums bezieht.
Der erste Vers gibt die Befürchtung des Dichters wieder. Kleist befürchtet, dass das Publikum, metaphorisch als „Meute“ bezeichnet, das Stück nicht verstehen oder würdigen wird. Die „Meute“ steht hier für die Masse der Zuschauer, die möglicherweise nicht in der Lage ist, die komplexen und ungewöhnlichen Elemente von „Penthesilea“ zu erfassen. Die Befürchtung, dass die „Meute“ „mit Glück nicht heulen“ wird, deutet darauf hin, dass Kleist eine negative Reaktion des Publikums erwartet, entweder in Form von Unverständnis, Ablehnung oder gar Spott.
Der zweite Vers bringt den Wunsch des Dichters zum Ausdruck. Kleist wünscht sich, dass er den „Lärm“ (vermutlich die mögliche negative Reaktion des Publikums) in „Musik“ verwandeln kann. Die Metapher der „Musik“ steht hier für eine künstlerische Transformation und eine höhere Form der Rezeption. Kleist hofft, dass er die Kritik und das Unverständnis in etwas Schönes, Kunstvolles und letztlich Positives umwandeln kann. Dies deutet auf ein tiefes Vertrauen in die künstlerische Qualität seines Werkes und ein Bemühen um einen umfassenderen, tieferen Zugang zu dessen Bedeutung hin.
Die Kürze des Gedichts und die konzentrierte Sprache unterstreichen die Intensität von Kleists Befürchtung und seinem Wunsch. Die Verwendung von nur zwei Versen ist typisch für Kleists Stil, der oft von Prägnanz und dichter, fast dramatischer Gestaltung geprägt ist. Die Wahl der Worte „Meute“ und „Musik“ verstärkt die Kontraste und die Ambitionen des Dichters. Kleist ist sich der Schwierigkeit seines Werkes bewusst, vertraut aber gleichzeitig auf seine künstlerische Fähigkeit, die Herausforderungen der Rezeption zu überwinden und Kunst zu schaffen, die über die unmittelbare Reaktion des Publikums hinaus Bestand hat.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
