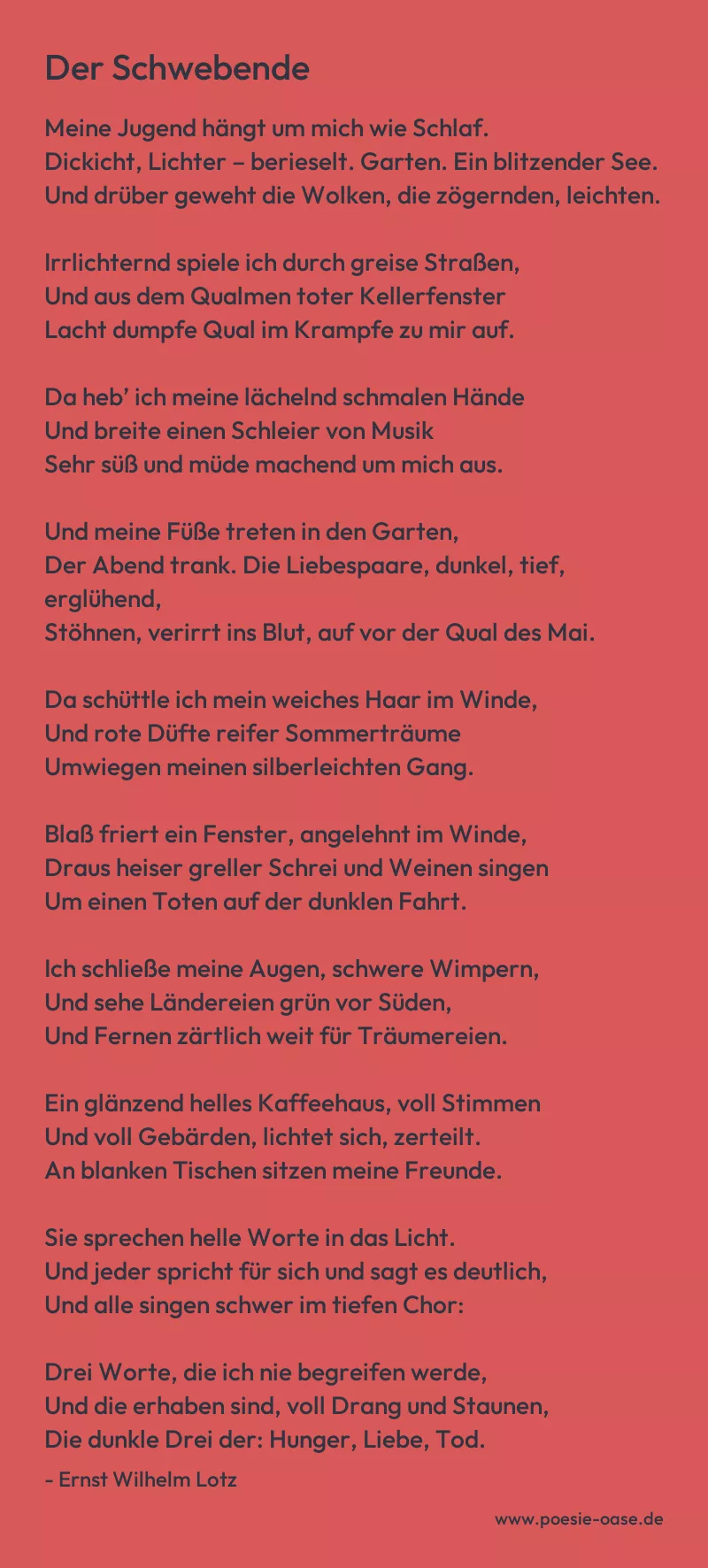Meine Jugend hängt um mich wie Schlaf.
Dickicht, Lichter – berieselt. Garten. Ein blitzender See.
Und drüber geweht die Wolken, die zögernden, leichten.
Irrlichternd spiele ich durch greise Straßen,
Und aus dem Qualmen toter Kellerfenster
Lacht dumpfe Qual im Krampfe zu mir auf.
Da heb’ ich meine lächelnd schmalen Hände
Und breite einen Schleier von Musik
Sehr süß und müde machend um mich aus.
Und meine Füße treten in den Garten,
Der Abend trank. Die Liebespaare, dunkel, tief, erglühend,
Stöhnen, verirrt ins Blut, auf vor der Qual des Mai.
Da schüttle ich mein weiches Haar im Winde,
Und rote Düfte reifer Sommerträume
Umwiegen meinen silberleichten Gang.
Blaß friert ein Fenster, angelehnt im Winde,
Draus heiser greller Schrei und Weinen singen
Um einen Toten auf der dunklen Fahrt.
Ich schließe meine Augen, schwere Wimpern,
Und sehe Ländereien grün vor Süden,
Und Fernen zärtlich weit für Träumereien.
Ein glänzend helles Kaffeehaus, voll Stimmen
Und voll Gebärden, lichtet sich, zerteilt.
An blanken Tischen sitzen meine Freunde.
Sie sprechen helle Worte in das Licht.
Und jeder spricht für sich und sagt es deutlich,
Und alle singen schwer im tiefen Chor:
Drei Worte, die ich nie begreifen werde,
Und die erhaben sind, voll Drang und Staunen,
Die dunkle Drei der: Hunger, Liebe, Tod.