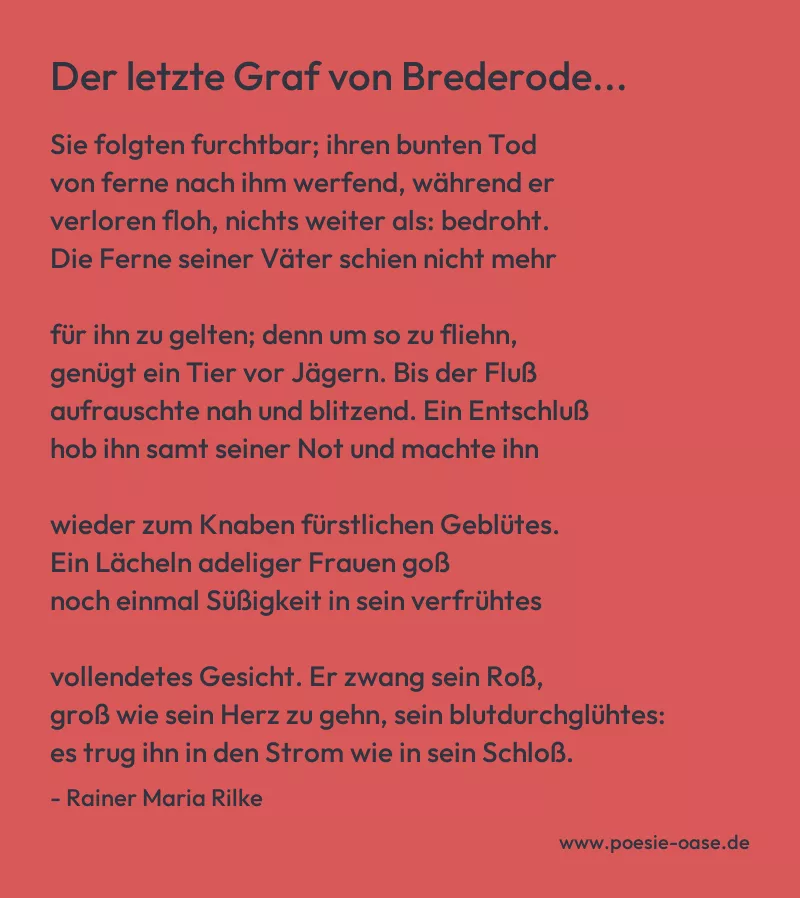Der letzte Graf von Brederode…
Sie folgten furchtbar; ihren bunten Tod
von ferne nach ihm werfend, während er
verloren floh, nichts weiter als: bedroht.
Die Ferne seiner Väter schien nicht mehr
für ihn zu gelten; denn um so zu fliehn,
genügt ein Tier vor Jägern. Bis der Fluß
aufrauschte nah und blitzend. Ein Entschluß
hob ihn samt seiner Not und machte ihn
wieder zum Knaben fürstlichen Geblütes.
Ein Lächeln adeliger Frauen goß
noch einmal Süßigkeit in sein verfrühtes
vollendetes Gesicht. Er zwang sein Roß,
groß wie sein Herz zu gehn, sein blutdurchglühtes:
es trug ihn in den Strom wie in sein Schloß.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
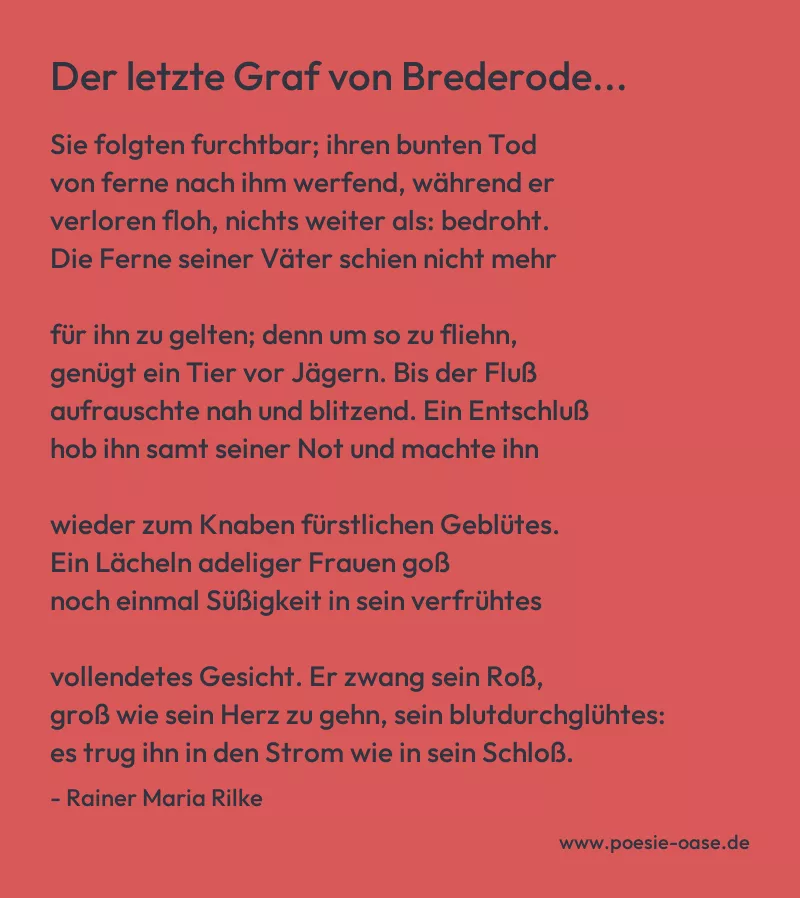
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der letzte Graf von Brederode“ von Rainer Maria Rilke beschreibt die dramatischen letzten Momente eines Mannes, der verzweifelt versucht, seinem Schicksal zu entkommen. Die Verwendung von Adjektiven wie „furchtbar“ und „bedroht“ in den ersten Zeilen etabliert sofort eine Atmosphäre der Gefahr und des unaufhaltsamen Verfolgt-Werdens. Der Graf flieht, nicht mehr würdig der Geschichte seiner Vorfahren, sondern reduziert auf die Instinkte eines Tieres, das vor Jägern flieht. Rilke vermittelt hier ein Gefühl der Entwurzelung und des Verlusts der Identität.
Die zweite Strophe markiert einen Wendepunkt. Der Fluss, der zunächst als Bedrohung erscheint, wird zur Rettung. Der Graf trifft eine Entscheidung, die ihn, trotz der erlittenen Not, in seine Kindheit und in die Welt seines Geblüts zurückversetzt. Der „blitzend[e]“ Fluss deutet auf einen Moment der Erkenntnis und des Entschlusses hin, der durch das „Lächeln adeliger Frauen“ verstärkt wird. Diese Passage impliziert, dass der Graf sich in seiner letzten Stunde auf seine Herkunft und seinen Stand besinnt.
In der dritten Strophe wird das finale Handeln des Grafen geschildert. Das Gedicht kulminiert in der Hingabe an den Tod, der als Rückkehr in das „Schloß“ interpretiert werden kann. Das Ross, ein Symbol für Stärke und Adel, wird zum Werkzeug des Untergangs, doch auch der Befreiung. Die Beschreibung „blutdurchglühtes“ Herz verstärkt die Dramatik und die Intensität der Emotionen, die den Grafen in seinen letzten Augenblicken leiten.
Rilkes Sprache ist von bildhafter Kraft geprägt, die eine dichte Atmosphäre schafft. Das Gedicht ist ein Beispiel für die Art, wie Rilke die Themen Tod, Verlust und Identität in seinen Werken verhandelt. Die knappe, aber eindringliche Darstellung der Ereignisse erzeugt beim Leser eine tiefgreifende Emotion und lädt zur Reflexion über die menschliche Existenz und die Macht des Schicksals ein. Das Gedicht wirft Fragen nach Ehre, Stolz und der Akzeptanz des eigenen Todes auf, während es zugleich die Schönheit des Untergangs in Szene setzt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.