Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier?
Bleib, trotziger Jäger, in deinem Revier!
Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich,
Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes, für mich,
Und willst du das zärtliche Rehlein sehn,
So laß deine Büchsen im Walde stehn,
Und laß deine klaffenden Hunde zu Haus,
Und laß auf dem Horne den Saus und Braus,
Und schere vom Kinne das struppige Haar,
Sonst scheut sich im Garten das Rehlein fürwahr.
Doch besser, du bliebest im Walde dazu
Und ließest die Mühlen und Müller in Ruh.
Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig?
Was will den das Eichhorn im bläulichen Teich?
Drum bleibe, du trotziger Jäger, im Hain,
Und laß mich mit meinen drei Rädern allein;
Und willst meinem Schätzchen dich machen beliebt,
So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrübt:
Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Hain
Und brechen in ihren Kohlgarten ein
Und treten und wühlen herum in dem Feld:
Die Eber, die schieß, du Jägerheld!
Der Jäger
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
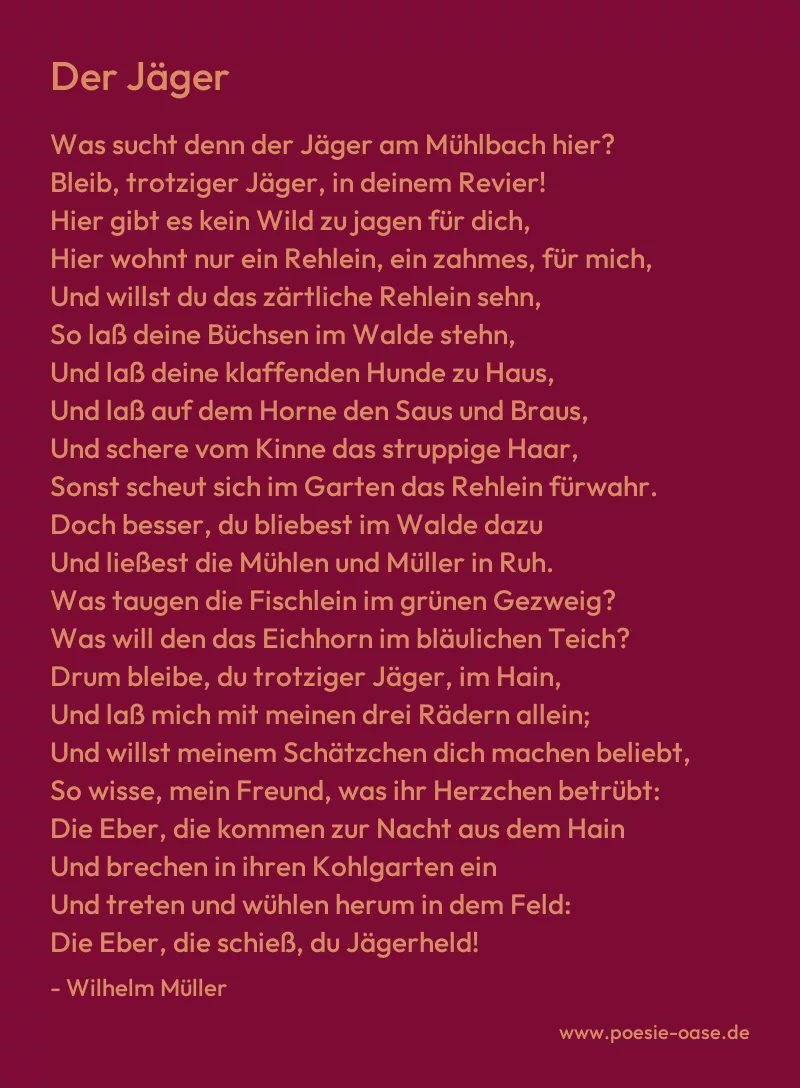
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Jäger“ von Wilhelm Müller entfaltet eine subtile und vielschichtige Auseinandersetzung mit den Themen Liebe, Besitzanspruch und der Abwehr unerwünschter Eindringlinge. Es ist ein Dialog, oder besser gesagt, eine Ansprache, in dem der Sprecher, wahrscheinlich ein Müller, den Jäger bittet, sein Revier zu verlassen und von der Annäherung an das Rehlein abzulassen.
Die zentrale Metapher ist die des Rehleins, das als Sinnbild für Zärtlichkeit und Zuneigung fungiert. Der Jäger verkörpert dabei das Eindringen von außen, die Bedrohung, die mit Gewalt und ungestümen Absichten einhergeht. Die wiederholten Aufforderungen des Müllers, den Wald zu bewahren, die Waffen zu lassen und die Hunde zu Hause zu lassen, zeugen von seinem Wunsch nach friedlicher Koexistenz und dem Schutz seines Besitzes – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne. Die subtile Wendung am Ende, in der der Jäger aufgefordert wird, die Eber zu jagen, lenkt die Aufmerksamkeit auf einen praktischen Nutzen des Jägers, der ihn in die Gemeinschaft integrieren könnte.
Die sprachliche Gestaltung des Gedichts ist bemerkenswert. Die einfache, direkte Sprache, die Verwendung von Anrede und die anschaulichen Bilder von Wald und Garten, Rehlein und Eber erzeugen eine dichte Atmosphäre. Die sanften Reime unterstreichen den Appell des Müllers, während die wiederholte Betonung des „trotzigen Jägers“ die Spannung aufbaut. Die Wahl des Wortes „trotzig“ lässt ein Gefühl von Trotz und Widerspenstigkeit im Jäger erahnen, was die mögliche Konfliktsituation zusätzlich unterstreicht. Die Erwähnung der „drei Räder“ deutet auf einen kleinen Garten und einen geringen Wohlstand hin, wodurch das schützenswerte Rehlein noch wertvoller erscheint.
Das Gedicht kann als eine Allegorie auf die Beziehung zwischen dem Einzelnen und der Außenwelt interpretiert werden. Der Müller steht für den beschützenden, liebenden Menschen, der Jäger für äußere Einflüsse, die sein Glück bedrohen. Die Bitte, die Eber zu jagen, könnte als ein Angebot der Zusammenarbeit verstanden werden, die der Jäger annehmen und so Teil des Ganzen werden kann. Müller zeigt hier die Möglichkeit der Integration und der Überwindung von Konflikten durch gemeinsame Ziele.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
