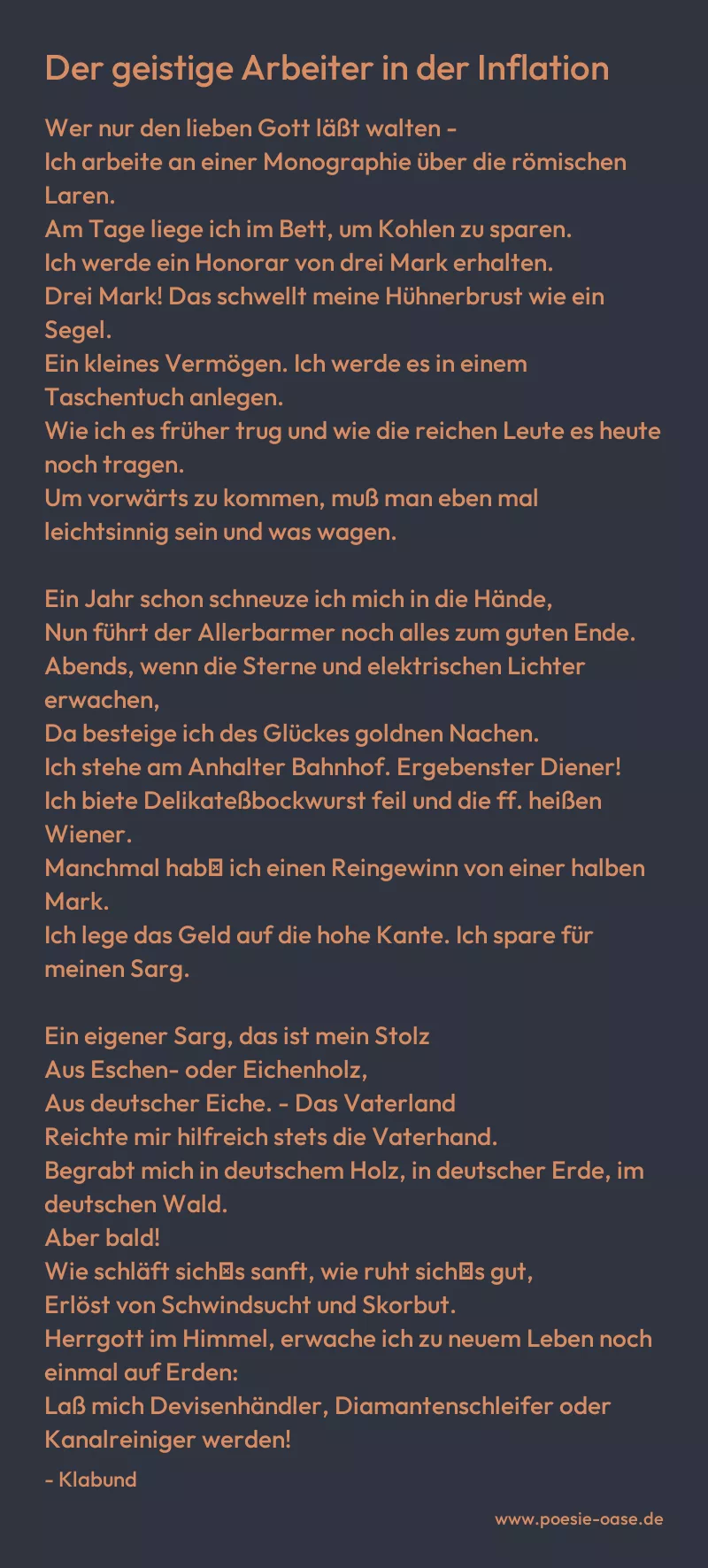Alltag, Feiertage, Geld, Götter, Märchen & Fantasie, Natur, Religion, Universum, Vergangenheit, Vergänglichkeit, Wälder & Bäume
Der geistige Arbeiter in der Inflation
Wer nur den lieben Gott läßt walten –
Ich arbeite an einer Monographie über die römischen Laren.
Am Tage liege ich im Bett, um Kohlen zu sparen.
Ich werde ein Honorar von drei Mark erhalten.
Drei Mark! Das schwellt meine Hühnerbrust wie ein Segel.
Ein kleines Vermögen. Ich werde es in einem Taschentuch anlegen.
Wie ich es früher trug und wie die reichen Leute es heute noch tragen.
Um vorwärts zu kommen, muß man eben mal leichtsinnig sein und was wagen.
Ein Jahr schon schneuze ich mich in die Hände,
Nun führt der Allerbarmer noch alles zum guten Ende.
Abends, wenn die Sterne und elektrischen Lichter erwachen,
Da besteige ich des Glückes goldnen Nachen.
Ich stehe am Anhalter Bahnhof. Ergebenster Diener!
Ich biete Delikateßbockwurst feil und die ff. heißen Wiener.
Manchmal hab′ ich einen Reingewinn von einer halben Mark.
Ich lege das Geld auf die hohe Kante. Ich spare für meinen Sarg.
Ein eigener Sarg, das ist mein Stolz
Aus Eschen- oder Eichenholz,
Aus deutscher Eiche. – Das Vaterland
Reichte mir hilfreich stets die Vaterhand.
Begrabt mich in deutschem Holz, in deutscher Erde, im deutschen Wald.
Aber bald!
Wie schläft sich′s sanft, wie ruht sich′s gut,
Erlöst von Schwindsucht und Skorbut.
Herrgott im Himmel, erwache ich zu neuem Leben noch einmal auf Erden:
Laß mich Devisenhändler, Diamantenschleifer oder Kanalreiniger werden!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
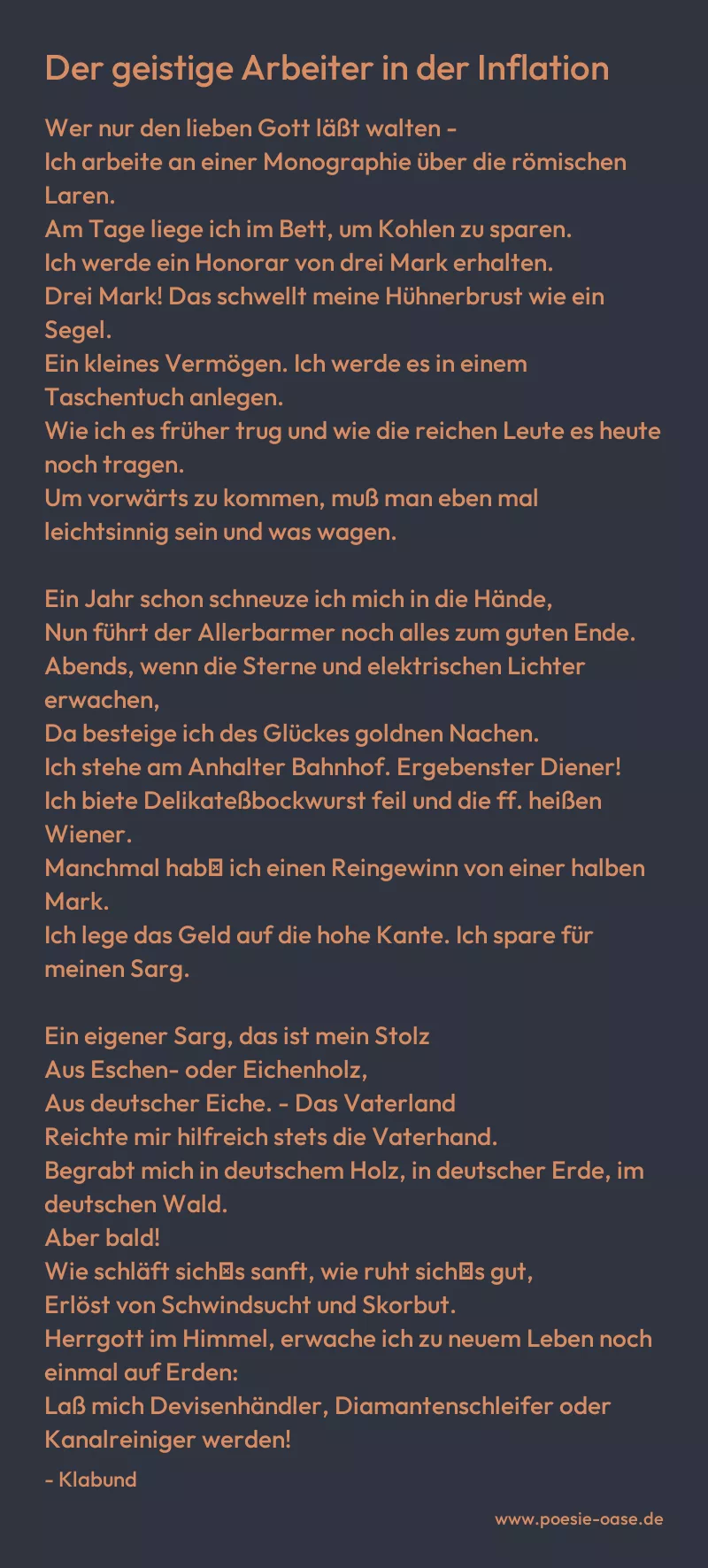
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der geistige Arbeiter in der Inflation“ von Klabund ist eine bitterböse Satire auf die Not und den wirtschaftlichen Zusammenbruch in der Weimarer Republik. Es zeigt das Elend eines Intellektuellen, der unter den Bedingungen der Inflation zu überleben versucht. Der Kontrast zwischen dem Anspruch auf geistige Arbeit und dem tatsächlichen Leben als Straßenverkäufer offenbart die Entwertung kultureller Werte und die Perspektivlosigkeit der Menschen.
Die ersten beiden Strophen beschreiben das Leben des lyrischen Ichs. Seine anfängliche Hoffnung auf eine Monographie über die römischen Laren und das bescheidene Honorar von drei Mark, das er als „Vermögen“ betrachtet, zeigen die Absurdität der wirtschaftlichen Lage. Die Metapher vom „goldnen Nachen“ des Glücks, den er abends besteigt, um Bockwurst zu verkaufen, verdeutlicht den Abstieg in die Banalität des Alltags. Der „Allerbarmer“ wird als Ironie verwendet, da sein Eingreifen eher eine Verschlimmerung der Situation bedeutet.
Die dritte Strophe, mit der Vorstellung eines eigenen Sarges, ist der Höhepunkt der Tragik. Der Sarg, der als „Stolz“ des lyrischen Ichs bezeichnet wird, symbolisiert das Ende aller Hoffnung und die Akzeptanz des Todes als einziger Erlösung. Die Betonung auf „deutschem Holz, deutscher Erde, deutschem Wald“ wirkt zynisch, da die nationalistischen Ideale des Vaterslandes mit der realen Armut und dem Leid kontrastieren. Das ironische „Aber bald!“ unterstreicht die Hoffnungslosigkeit.
Die abschließenden Zeilen offenbaren einen tiefen Wunsch nach Veränderung, der durch die resignierte Schlussfolgerung noch verstärkt wird. Die Aufzählung von Berufen wie Devisenhändler, Diamantenschleifer oder Kanalreiniger zeigt das vergebliche Hoffen auf einen Neuanfang, der jedoch unwahrscheinlich erscheint. Die Sehnsucht nach einem „neuen Leben“ ist eine Verzweiflungstat, ein Zeichen dafür, dass die Überlebensstrategien in der Inflationszeit letztendlich zum Scheitern verurteilt sind. Klabunds Gedicht ist somit eine schonungslose Abrechnung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und der Hoffnungslosigkeit des Einzelnen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.