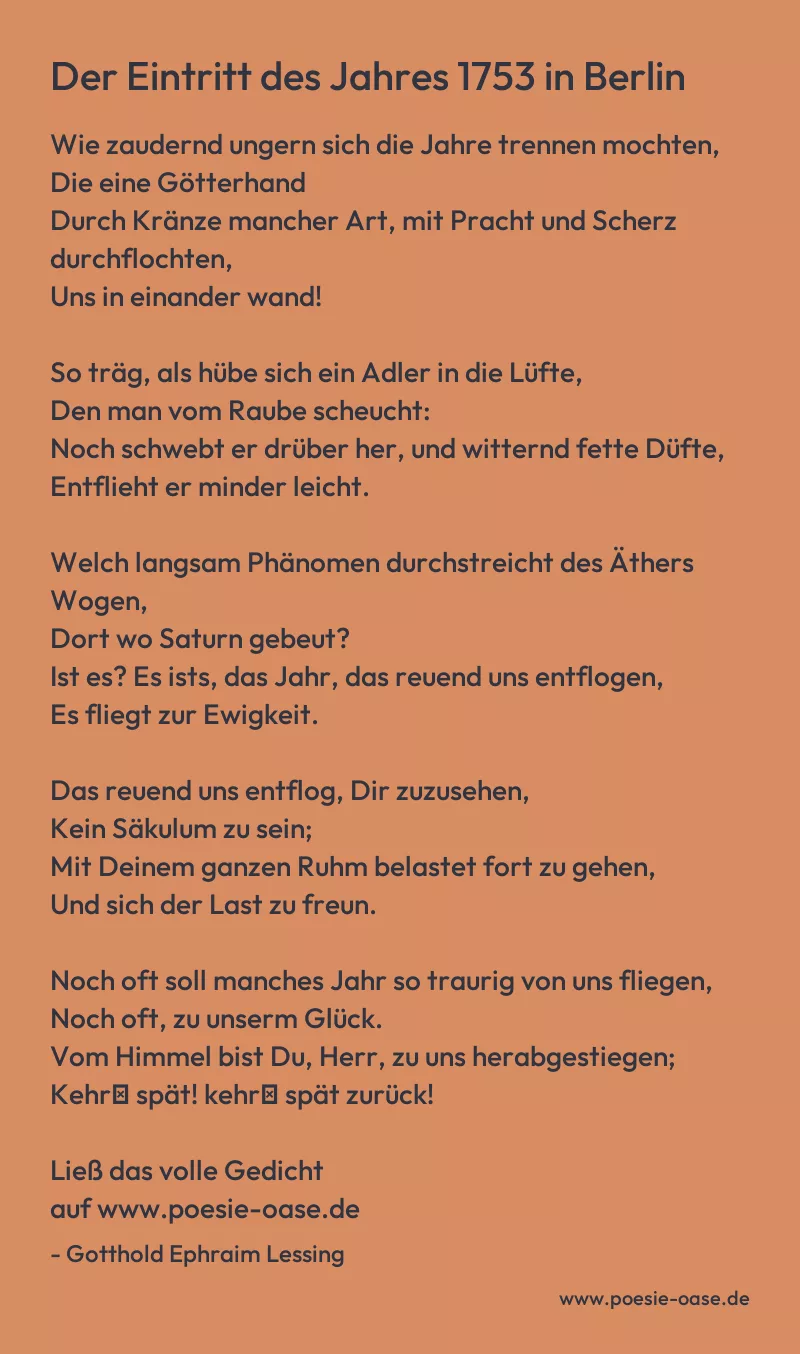Wie zaudernd ungern sich die Jahre trennen mochten,
Die eine Götterhand
Durch Kränze mancher Art, mit Pracht und Scherz durchflochten,
Uns in einander wand!
So träg, als hübe sich ein Adler in die Lüfte,
Den man vom Raube scheucht:
Noch schwebt er drüber her, und witternd fette Düfte,
Entflieht er minder leicht.
Welch langsam Phänomen durchstreicht des Äthers Wogen,
Dort wo Saturn gebeut?
Ist es? Es ists, das Jahr, das reuend uns entflogen,
Es fliegt zur Ewigkeit.
Das reuend uns entflog, Dir zuzusehen,
Kein Säkulum zu sein;
Mit Deinem ganzen Ruhm belastet fort zu gehen,
Und sich der Last zu freun.
Noch oft soll manches Jahr so traurig von uns fliegen,
Noch oft, zu unserm Glück.
Vom Himmel bist Du, Herr, zu uns herabgestiegen;
Kehr′ spät! kehr′ spät zurück!
Laß Dich noch lange, Herr, den Namen Vater reizen,
Und den: menschlicher Held!
Dort wird der Himmel zwar nach seiner Zierde geizen;
Doch hier braucht Dich die Welt.
Noch seh′ ich mich für Dich mit raschen Richteraugen
Nach einem Dichter um.
Dort einer! hier und da! Sie taugen viel, und taugen
Doch nichts für Deinen Ruhm.
Ist er nicht etwa schon, und singt noch wenig Ohren,
Weil er die Kräfte wiegt:
So werd′ er dieses Jahr, der seltne Geist, geboren,
Der diesen Kranz erfliegt.
Wenn er der Mutter dann sich leicht vom Herzen windet,
O Muse, lach′ ihn an!
Damit er Feur und Witz dem Edelmut verbindet,
Poet und Biedermann.
Hört! oder täuschen mich beliebte Rasereien?
Nein, nein, ich hör′ ihn schon.
Der Heere ziehend Lärm sind seine Melodeien,
Und jeder Ton!