O! über deinen König! ganz dir gleich,
Du glattgeschlagner Lumpen, o, sein Reich
Das Inselchen, des kärglichen Tribut
Lukull in eine Silberschüssel lud,
Gebannt in eine Perle Cäsars Hand
In der Ägypterfürstin Locken wand.
Du, zitternd vor Satrapenblicke, fahl
Wärst du zerstäubt vor seiner Augen Strahl,
Wenn langsam übers Forum im Triumph
Das Viergespann ihn rollte; hörst du dumpf,
Wie halberwachten Donner oder Spülen
Der Brandung, Pöbelwoge ziehn und wühlen,
Um die Quadriga summend, wie im Nahn
Prüft seine Stimme murrend der Orkan?
»Heil, Cäsar, Heil!« um seine kahle Stirn
Ragt Lorbeer, wie die Ficht′ um Klippenfirn;
Er lächelt, und aus seinem Lächeln fließet
Ein leise schläfernd Gift, o Roma, dir,
Sein halbgeschloßnes Auge Fäden schießet,
Ein unzerreißbar Netz. — Gebückt und stier,
Zerzausten Haares, vor den Rossen klirrt
Endloser Gallierzug, die Fesseln schleifen,
Und aus der Pöbelwelle gellt und schwirrt
Gezisch, Gejubel, Cymbelklang und Pfeifen.
Denare fliegen aus des Siegers Hand,
Ha, wie es krabbelt im Arenasand! —
Der Imperator nickt und klingelt fort.
Noch lieg′ ich unberührt im Byssusbeutel, —
Was steigt so schwarz am Kapitole dort?
Es dunkelt, dunkelt; — über Cäsars Scheitel
Ein Riesenaar mit Flügelrauschen steigt,
Die Sonne schwindet — doch ein Leuchten streicht
Um der Liktoren Beile — wieder itzt —
Sie zucken, schwenken sich — es blitzt! — es blitzt!
Der Denar
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
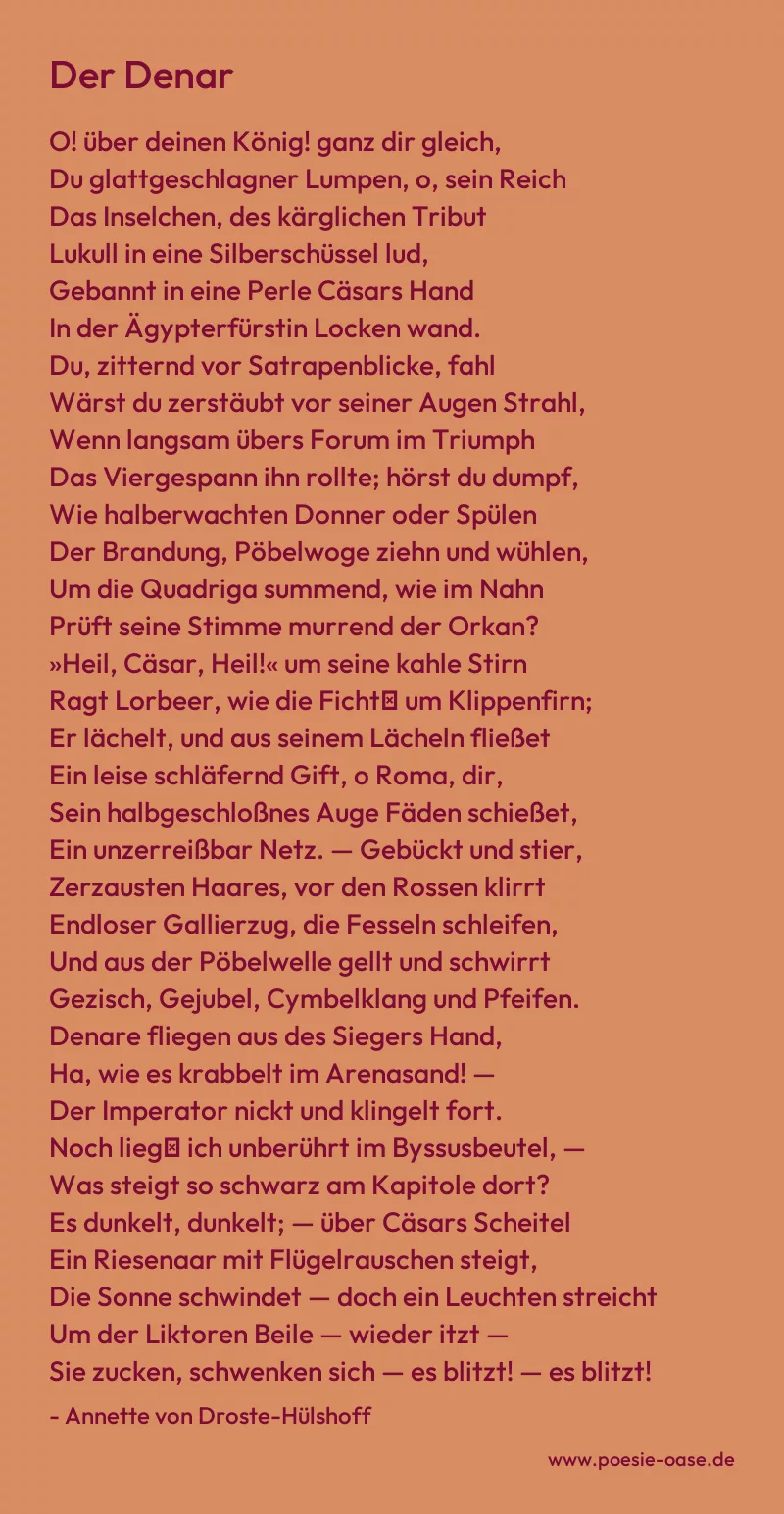
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Denar“ von Annette von Droste-Hülshoff ist eine düstere Betrachtung über Macht, Ruhm und den Untergang. Es verwendet einen Denar als allwissenden Erzähler, der die Pracht und den Verfall des römischen Reiches aus einer distanzierten, aber eindringlichen Perspektive beobachtet. Der Denar, ein einfacher Gegenstand, wird zum Zeugen historischer Ereignisse und enthüllt die korrumpierende Natur von Macht und die Vergänglichkeit menschlicher Größe.
Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung des Denars, der „ganz dir gleich“ dem König ist, was eine erste Verbindung zwischen dem Metallstück und der Machtelite herstellt. Der Denar hat das Reich, die Tributzahlung an Lukull, die Perle in Cäsars Hand und die Locken der ägyptischen Prinzessin gesehen. Die Metaphern deuten auf Reichtum, Luxus und politische Intrigen hin, die das römische Reich prägten. Die Beschreibung des Triumphs Cäsars auf dem Forum und die Reaktionen der Bevölkerung lassen ein Bild von militärischer Stärke und öffentlicher Euphorie entstehen, die aber durch einen untergründigen Ton der Vorahnung getrübt wird. Der „leise schläfernd Gift“ in Cäsars Lächeln deutet auf die innere Korruption, die den Untergang Roms vorbereitet.
Die zweite Hälfte des Gedichts intensiviert die düstere Stimmung. Die Bildsprache wird drastischer, als der Denar Zeuge der Erniedrigung der besiegten Gallier und des jubelnden Pöbels wird, der von der Pracht der Macht geblendet ist. Die „Denare fliegen“ symbolisieren die Verschwendung und den Überfluss, die mit dem Sieg einhergehen. Die plötzliche Veränderung der Szenerie, als etwas „schwarz am Kapitole dort“ aufsteigt, und die Erwähnung von „Riesenaar“ und „Flügelrauschen“ weisen auf ein drohendes Unheil hin, möglicherweise den bevorstehenden Tod Cäsars oder den Sturz des Reiches.
Das Gedicht endet mit einem abrupten und dramatischen Höhepunkt. Die „Liktoren Beile“ werden geschwungen, und es „blitzt! — es blitzt!“. Diese Bilder symbolisieren Gewalt, Zerstörung und das Ende der menschlichen Herrschaft. Die Verwendung von Ausrufezeichen und kurzen, abgehackten Sätzen verstärkt die Dramatik und den Schock des finalen Moments. Das Gedicht ist eine Reflexion über die Geschichte, die sich in einem zyklischen Kreislauf von Aufstieg und Fall wiederholt, wobei der Denar als stummer Zeuge diese ewigen Prozesse festhält.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
