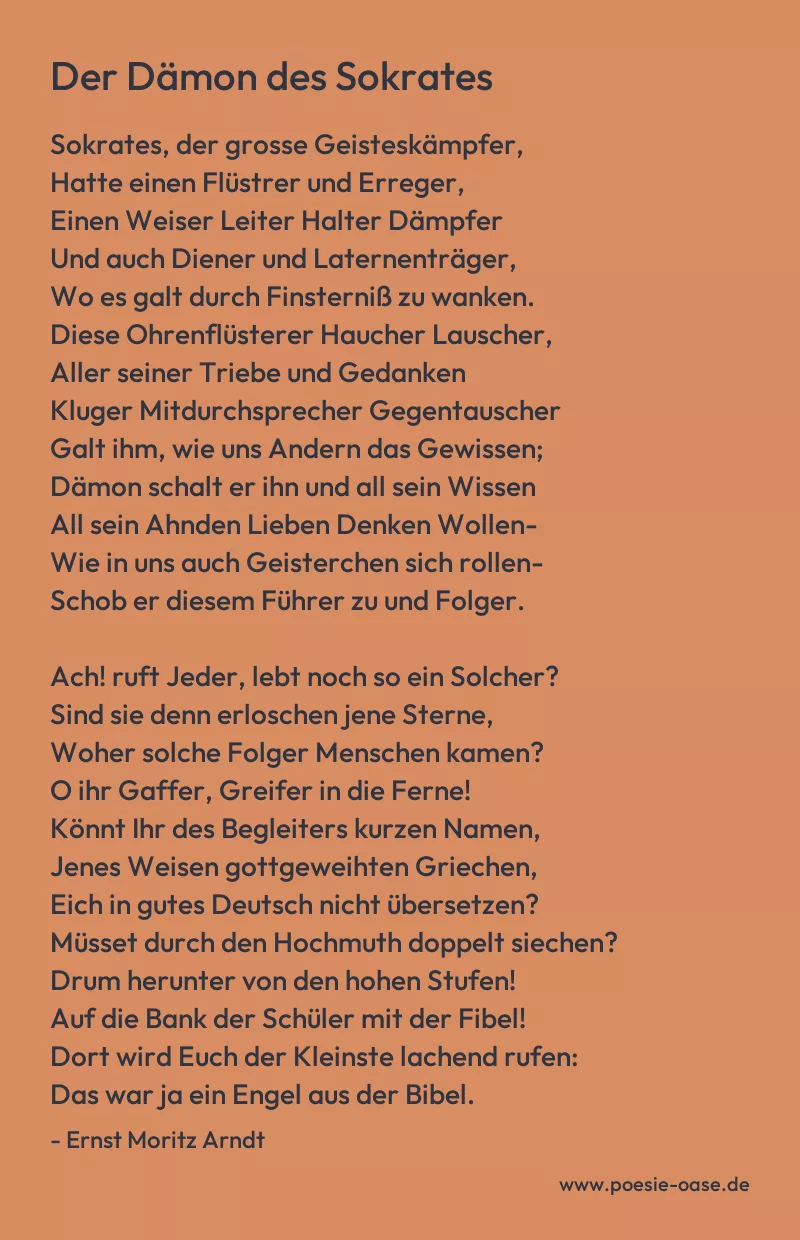Der Dämon des Sokrates
Sokrates, der grosse Geisteskämpfer,
Hatte einen Flüstrer und Erreger,
Einen Weiser Leiter Halter Dämpfer
Und auch Diener und Laternenträger,
Wo es galt durch Finsterniß zu wanken.
Diese Ohrenflüsterer Haucher Lauscher,
Aller seiner Triebe und Gedanken
Kluger Mitdurchsprecher Gegentauscher
Galt ihm, wie uns Andern das Gewissen;
Dämon schalt er ihn und all sein Wissen
All sein Ahnden Lieben Denken Wollen-
Wie in uns auch Geisterchen sich rollen-
Schob er diesem Führer zu und Folger.
Ach! ruft Jeder, lebt noch so ein Solcher?
Sind sie denn erloschen jene Sterne,
Woher solche Folger Menschen kamen?
O ihr Gaffer, Greifer in die Ferne!
Könnt Ihr des Begleiters kurzen Namen,
Jenes Weisen gottgeweihten Griechen,
Eich in gutes Deutsch nicht übersetzen?
Müsset durch den Hochmuth doppelt siechen?
Drum herunter von den hohen Stufen!
Auf die Bank der Schüler mit der Fibel!
Dort wird Euch der Kleinste lachend rufen:
Das war ja ein Engel aus der Bibel.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
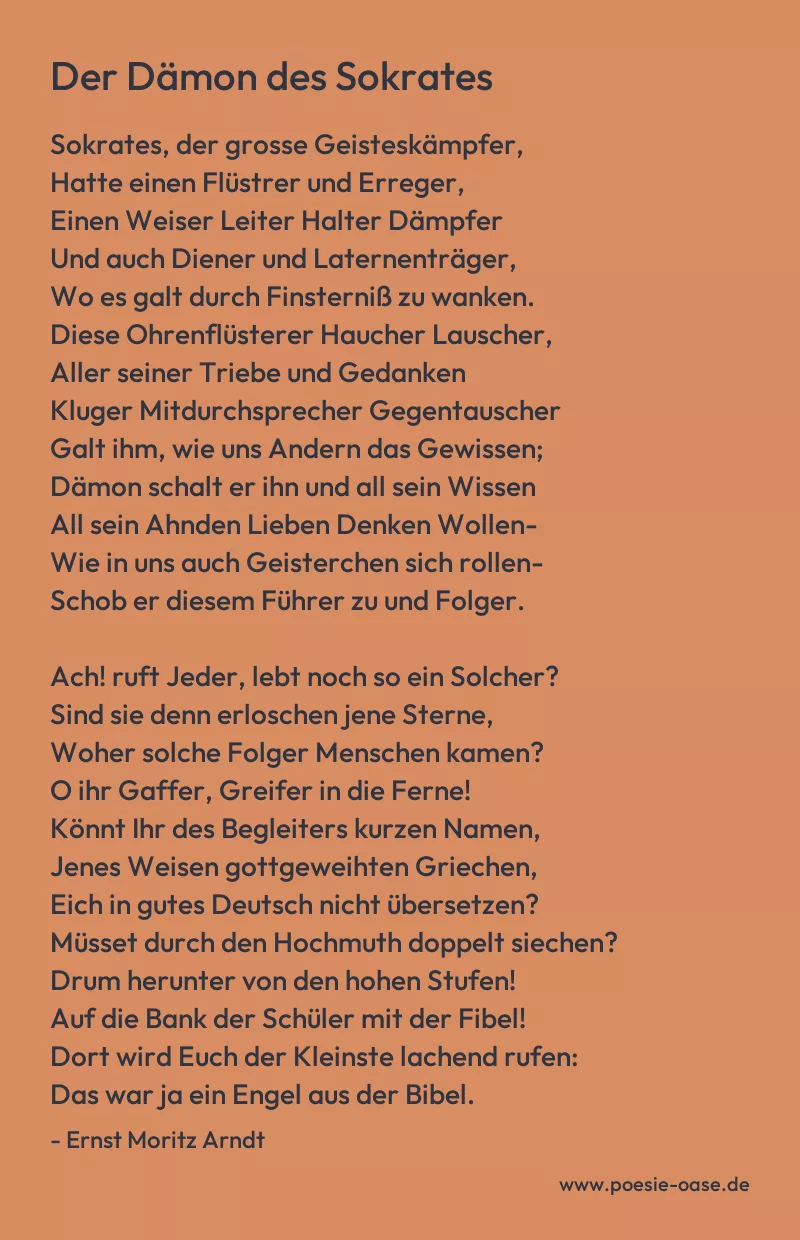
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Dämon des Sokrates“ von Ernst Moritz Arndt thematisiert die innere Stimme, die Intuition oder das Gewissen, die den berühmten Philosophen Sokrates leitete. Arndt stellt dieses innere Wesen als „Dämon“ dar, eine Figur, die Sokrates sowohl als Berater als auch als Wegweiser diente. Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung der Rolle des Dämons, der als „Flüstrer“, „Weiser“, „Diener“ und „Laternenträger“ fungierte, um Sokrates in dunklen Zeiten zu führen. Diese Metaphern unterstreichen die Funktion des Dämons als Quelle der Führung und des Schutzes.
In der zweiten Strophe vergleicht Arndt den Dämon mit dem Gewissen, das jeder Mensch besitzt, und betont, dass Sokrates all sein Wissen, Lieben, Denken und Wollen diesem „Führer“ zuschrieb. Diese Aussage hebt die Bedeutung der inneren Stimme für Sokrates hervor und deutet an, dass er sein Handeln stets von dieser Quelle der Inspiration und Weisheit leiten ließ. Die Zeile „Wie in uns auch Geisterchen sich rollen“ deutet an, dass jeder Mensch eine ähnliche innere Stimme besitzt, auch wenn sie vielleicht nicht immer gehört oder beachtet wird.
Der letzte Teil des Gedichts richtet sich an die Leser und stellt die Frage, ob solche „Engel“ noch existieren oder ob sie mit der Zeit erloschen sind. Arndt kritisiert die Leser, indem er sie als „Gaffer“ und „Greifer in die Ferne“ bezeichnet, die sich in ihrem Hochmut verirren. Er fordert sie auf, ihre hohen Ansprüche abzulegen und sich stattdessen demütig der Bildung zuzuwenden, indem er die Schüler auffordert, die „Fibel“ zu studieren. Die abschließende Zeile „Das war ja ein Engel aus der Bibel“ deutet darauf hin, dass der Dämon des Sokrates letztendlich nichts anderes ist als eine Verkörperung des göttlichen Einflusses, vergleichbar mit Engeln in der Bibel.
Die Interpretation des Gedichts verdeutlicht Arndts Botschaft, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, sich von einer inneren Stimme leiten zu lassen, und dass es wichtig ist, auf diese Intuition zu hören. Er kritisiert die Arroganz und den Hochmut derer, die sich weigern, nach innen zu schauen und die Weisheit ihrer eigenen inneren Führung anzunehmen. Durch die Verwendung des „Dämons“ als Metapher für das Gewissen und die Betonung der Bedeutung der Bildung appelliert Arndt an die Leser, sich ihrer inneren Führung zu öffnen und nach Erkenntnis zu streben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.