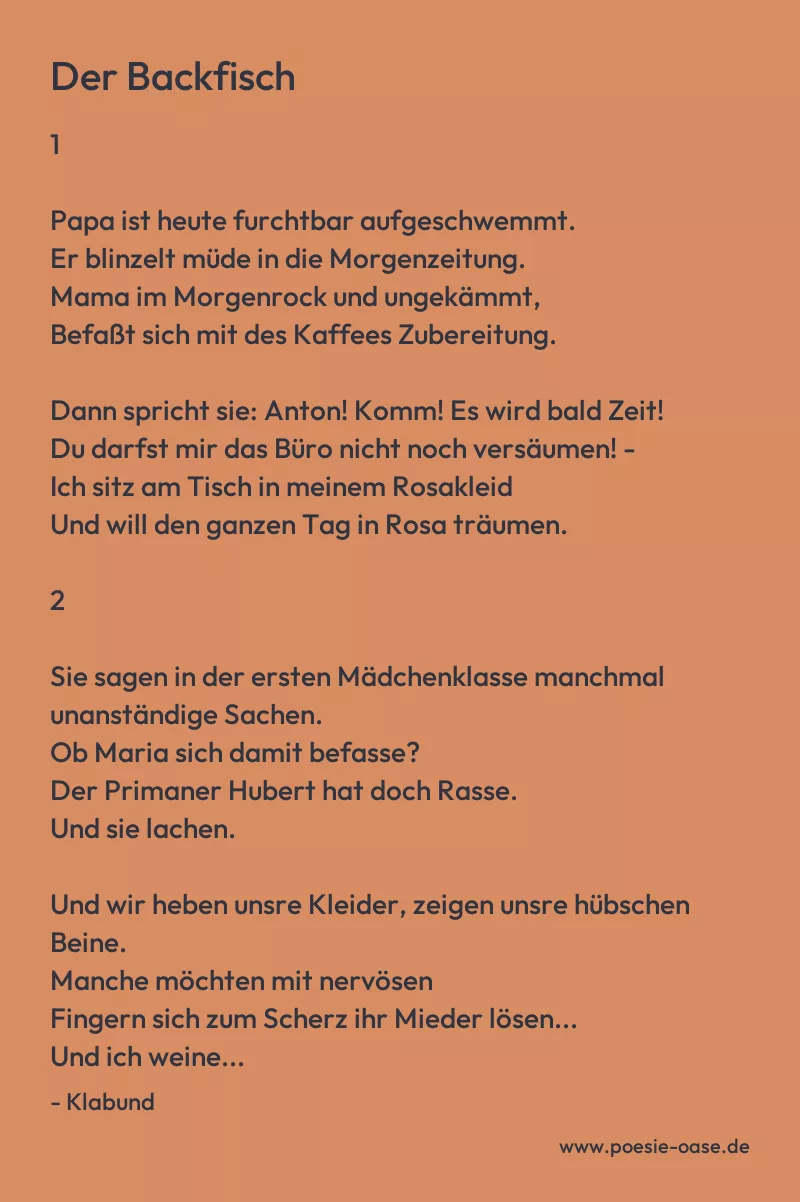Der Backfisch
1
Papa ist heute furchtbar aufgeschwemmt.
Er blinzelt müde in die Morgenzeitung.
Mama im Morgenrock und ungekämmt,
Befaßt sich mit des Kaffees Zubereitung.
Dann spricht sie: Anton! Komm! Es wird bald Zeit!
Du darfst mir das Büro nicht noch versäumen! –
Ich sitz am Tisch in meinem Rosakleid
Und will den ganzen Tag in Rosa träumen.
2
Sie sagen in der ersten Mädchenklasse manchmal unanständige Sachen.
Ob Maria sich damit befasse?
Der Primaner Hubert hat doch Rasse.
Und sie lachen.
Und wir heben unsre Kleider, zeigen unsre hübschen Beine.
Manche möchten mit nervösen
Fingern sich zum Scherz ihr Mieder lösen…
Und ich weine…
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
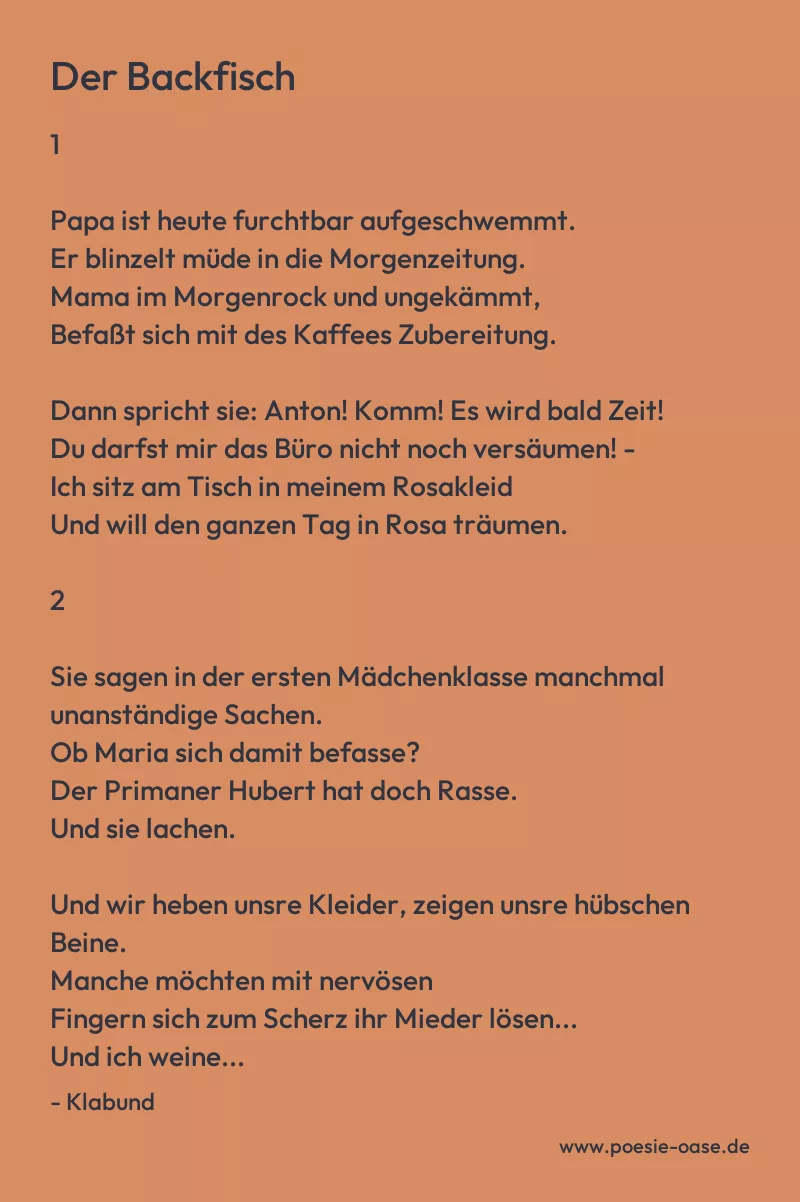
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Backfisch“ von Klabund zeichnet ein bezeichnendes Porträt eines jungen Mädchens in der Übergangsphase zur Frau, das sich in der Ambivalenz zwischen kindlicher Unbeschwertheit und den ersten Anzeichen weiblicher Selbstentdeckung wiederfindet. Der Titel selbst, „Backfisch“, bezeichnet eine junge Frau im Teenageralter und deutet bereits auf das zentrale Thema der Pubertät und der damit verbundenen Veränderungen hin.
Der erste Teil des Gedichts skizziert den Alltag der Familie, wobei die junge Protagonistin inmitten der erwachsenen Welt ihren eigenen, kindlichen Tagträumen nachhängt. Die Beschreibung des Vaters, der sich mit der Zeitung abmüht, und der Mutter, die das Frühstück zubereitet, schafft eine vertraute Kulisse. Die farbliche Präsenz des „Rosakleides“ unterstreicht die kindliche Welt der Protagonistin, in der sie sich vorstellt, den ganzen Tag in Rosa zu träumen. Dieser Teil des Gedichts etabliert den Kontrast zwischen der Welt der Erwachsenen und der inneren Gefühlswelt des jungen Mädchens.
Der zweite Teil wirft einen Blick auf die sozialen Erfahrungen der jungen Frau, insbesondere auf die Herausforderungen und Unsicherheiten, die mit der beginnenden Sexualität einhergehen. Die „unanständigen Sachen“, die in der Mädchenklasse gesprochen werden, deuten auf die Auseinandersetzung mit Tabuthemen und der eigenen Körperlichkeit hin. Die Erwähnung des „Primaner Hubert“ und die Reaktion der Mädchen, die ihre Beine zeigen, veranschaulichen die frühe Auseinandersetzung mit dem anderen Geschlecht und den eigenen Reizen. Der Kontrast zwischen dem Verhalten der anderen Mädchen und den eigenen Emotionen des lyrischen Ichs, die im „Weinen“ gipfeln, verdeutlicht die innere Zerrissenheit und die Überforderung mit den neuen Erfahrungen.
Klabunds Gedicht ist ein sensibles und nuanciertes Porträt der Pubertät, das die Zerrissenheit zwischen kindlicher Unschuld und der beginnenden sexuellen Selbstwahrnehmung einfängt. Die Sprache ist einfach und unmittelbar, was die Gefühle des jungen Mädchens authentisch und nachvollziehbar macht. Die Verwendung von Alltagselementen und die kontrastreiche Darstellung der kindlichen und erwachsenen Welten lassen das Gedicht zu einer präzisen Momentaufnahme des Erwachsenwerdens werden. Das Ende mit dem „Weinen“ verdeutlicht die Verunsicherung und die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.