Was! Du nimmst sie jetzt nicht, und warst der Dame versprochen?
Antwort: Lieber! vergib, man verspricht sich ja wohl.
Das Sprachversehen
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
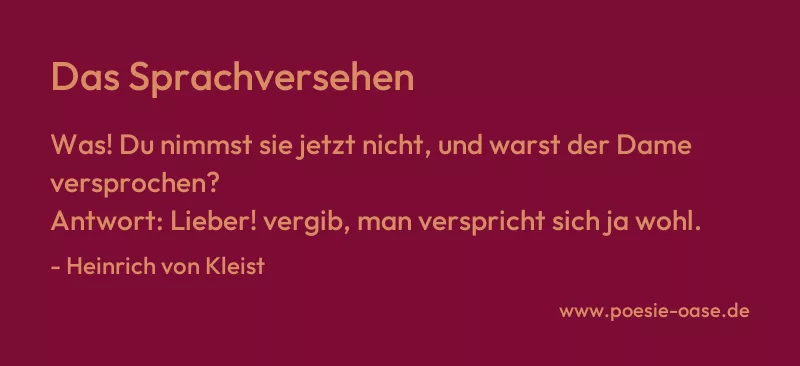
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Sprachversehen“ von Heinrich von Kleist ist ein winziges, aber höchst pointiertes Werk, das sich auf die menschliche Fehlbarkeit und die daraus resultierende Komik konzentriert. Es besteht aus nur zwei Versen, die einen Dialog zwischen zwei unbekannten Personen darstellen, der von einem überraschenden Missverständnis geprägt ist. Der Kern des Gedichts liegt in der Doppeldeutigkeit des Wortes „verspricht“, das sowohl im Sinne von „sich verloben“ als auch im Sinne von „sich versprechen“ verstanden werden kann.
Die erste Zeile, „Was! Du nimmst sie jetzt nicht, und warst der Dame versprochen?“, stellt eine Frage dar, die auf ein zuvoriges Versprechen hindeutet, vermutlich eine Verlobung. Der Sprecher ist offenbar überrascht und konfrontiert den Adressaten mit dessen scheinbar plötzlichem Sinneswandel. Die zweite Zeile, „Antwort: Lieber! vergib, man verspricht sich ja wohl.“, liefert die unerwartete Antwort. Statt die Verlobung zu verteidigen oder zu erklären, rechtfertigt sich der Adressat damit, dass er sich „versprochen“ habe, also ein sprachlicher Fehler vorliegt.
Die Ironie des Gedichts entsteht aus diesem Wortspiel und dem Kontrast zwischen Erwartung und Realität. Der Leser erwartet eine Erklärung für den Rücktritt von der Verlobung, bekommt aber stattdessen eine banale Entschuldigung für einen sprachlichen Fehler. Kleist nutzt die Knappheit des Gedichts, um die Aufmerksamkeit auf die menschliche Unzulänglichkeit zu lenken. Die banale Erklärung überdeckt auf subtile Weise die viel tiefergehende Implikation, dass ein Versprechen vielleicht doch nicht so ernst gemeint war.
Die Kürze des Gedichts trägt wesentlich zu seiner Wirkung bei. Durch die Reduktion auf das Wesentliche, lenkt Kleist die Aufmerksamkeit auf die subtilen Nuancen der Sprache und die daraus resultierenden Missverständnisse. Der Leser wird dazu angeregt, über die verborgenen Motive der Figuren nachzudenken und die Tragweite der sprachlichen Fehlleistung zu interpretieren. Das Gedicht wird so zu einer kleinen, aber feinen Studie über menschliche Kommunikation, Erwartungen und Enttäuschungen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
