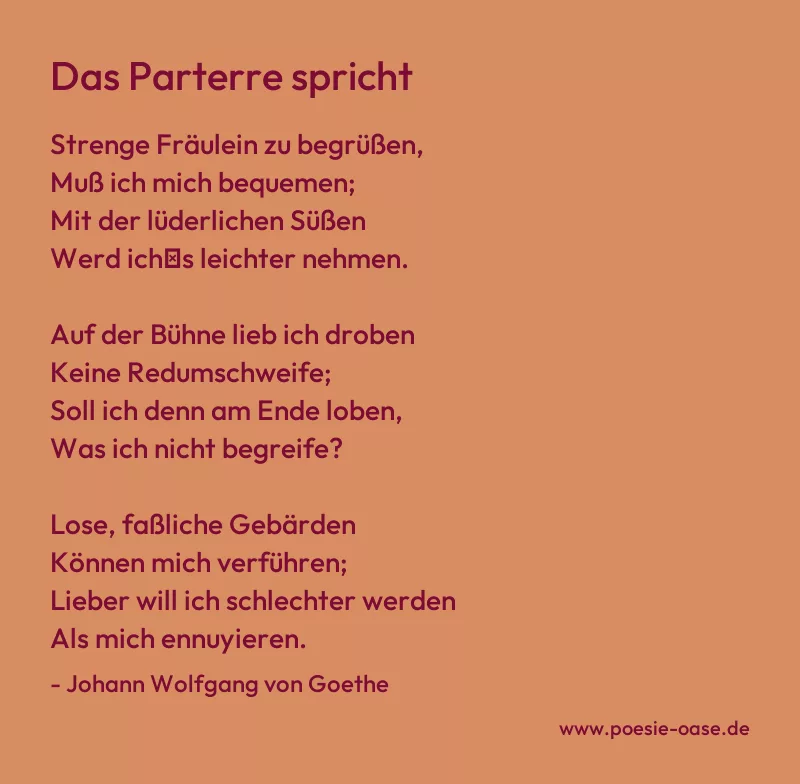Das Parterre spricht
Strenge Fräulein zu begrüßen,
Muß ich mich bequemen;
Mit der lüderlichen Süßen
Werd ich′s leichter nehmen.
Auf der Bühne lieb ich droben
Keine Redumschweife;
Soll ich denn am Ende loben,
Was ich nicht begreife?
Lose, faßliche Gebärden
Können mich verführen;
Lieber will ich schlechter werden
Als mich ennuyieren.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
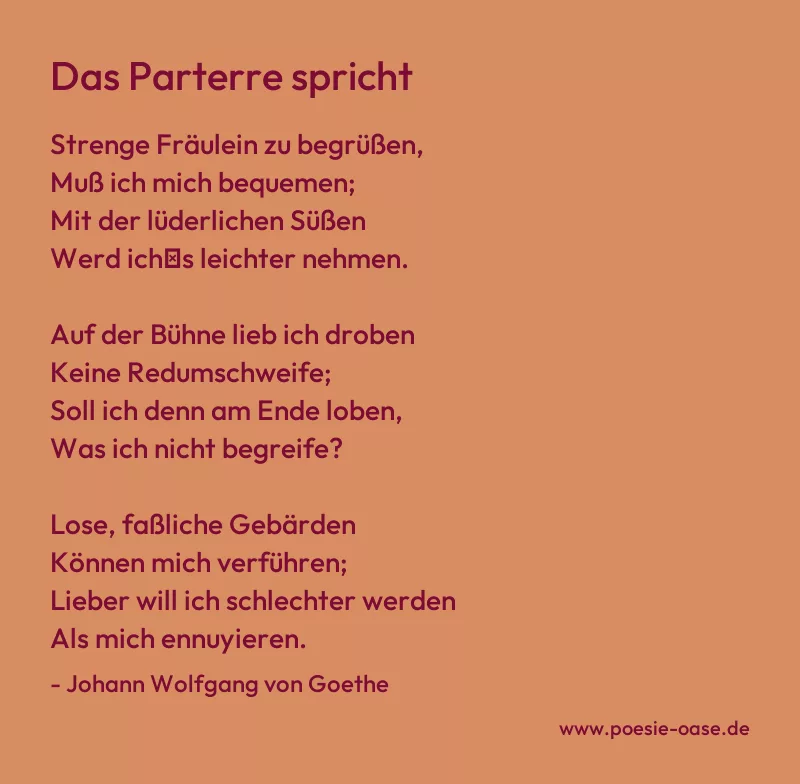
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Parterre spricht“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine ironische Betrachtung über die Geschmäcker und Erwartungen des Publikums in einem Theater. Es präsentiert die Perspektive des Parterres, also der günstigeren Sitzplätze, und lässt diese Gruppe ihr Urteil über die Aufführung kundtun. Der Ton ist locker, fast flapsig, und spiegelt die vermeintlich geringere Bildung und die direkteren Bedürfnisse der Zuschauer wider.
Die ersten beiden Strophen deuten bereits die Unterschiede in den Vorlieben an. Das Parterre bevorzugt offenbar eine gewisse Vertrautheit und Direktheit. Die „strengen Fräulein“ werden mit einer gewissen Distanz betrachtet, während die „lüderliche Süßen“ bevorzugt werden. Dies impliziert eine Präferenz für Unterhaltung, die weniger anspruchsvoll ist und keine intellektuelle Auseinandersetzung erfordert. Die Erwartungen sind klar: leichte Unterhaltung, die schnell verstanden wird, und keine komplizierten Handlungen.
Die dritte Strophe unterstreicht die Ablehnung von „Redumschweife“ und die Vorliebe für „lose, faßliche Gebärden“. Hier wird deutlich, dass das Parterre keine aufwändigen Interpretationen oder tiefgründige Dialoge wünscht. Das Verständnis der Inszenierung soll ohne großen Aufwand erfolgen. Die Bereitschaft, „schlechter zu werden“ als sich zu langweilen, ist ein starker Ausdruck der Prioritäten: Unterhaltung vor Bildung, Spaß vor tiefgründigem Verständnis.
Goethe nutzt die Ich-Perspektive des Parterres, um eine Kritik an der Kunstform zu üben und gleichzeitig die sozialen Unterschiede und die Vielfalt der Geschmäcker zu thematisieren. Das Gedicht reflektiert die Spannung zwischen Anspruch und Unterhaltung, zwischen dem Wunsch nach intellektueller Auseinandersetzung und der Sehnsucht nach leichter Zerstreuung. Es ist ein ironischer Kommentar auf die oft unterschiedlichen Erwartungen des Publikums und ein Hinweis auf die Herausforderungen, denen sich ein Autor im Theater stellen muss.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.