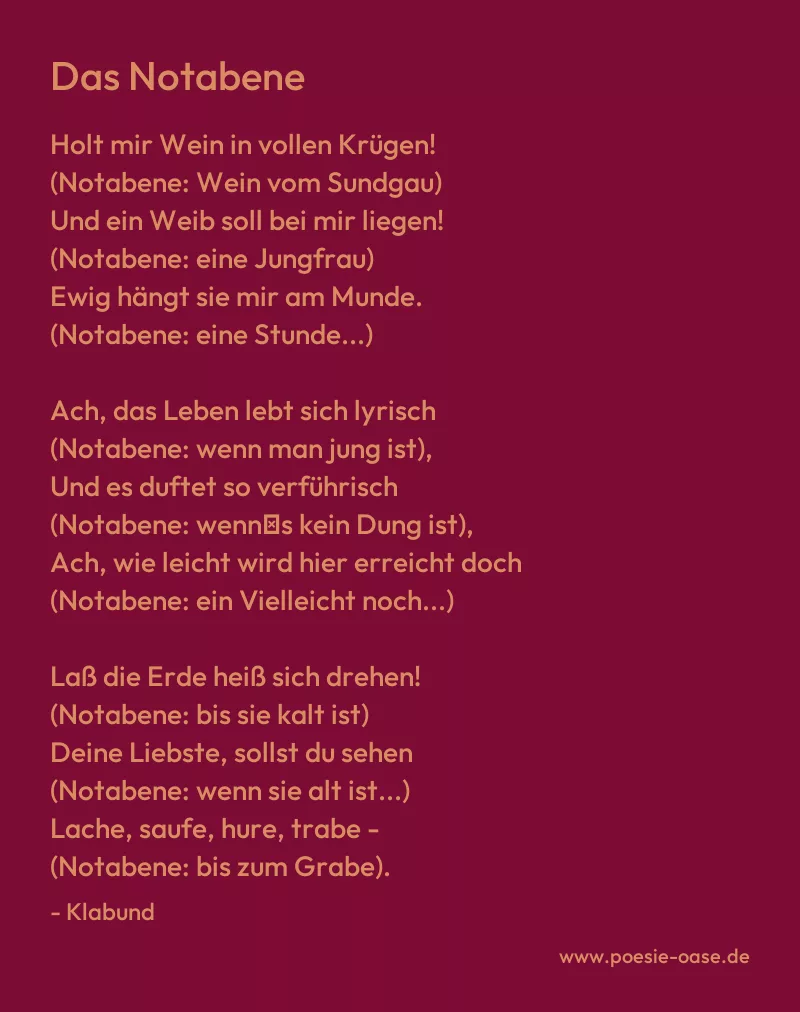Das Notabene
Holt mir Wein in vollen Krügen!
(Notabene: Wein vom Sundgau)
Und ein Weib soll bei mir liegen!
(Notabene: eine Jungfrau)
Ewig hängt sie mir am Munde.
(Notabene: eine Stunde…)
Ach, das Leben lebt sich lyrisch
(Notabene: wenn man jung ist),
Und es duftet so verführisch
(Notabene: wenn′s kein Dung ist),
Ach, wie leicht wird hier erreicht doch
(Notabene: ein Vielleicht noch…)
Laß die Erde heiß sich drehen!
(Notabene: bis sie kalt ist)
Deine Liebste, sollst du sehen
(Notabene: wenn sie alt ist…)
Lache, saufe, hure, trabe –
(Notabene: bis zum Grabe).
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
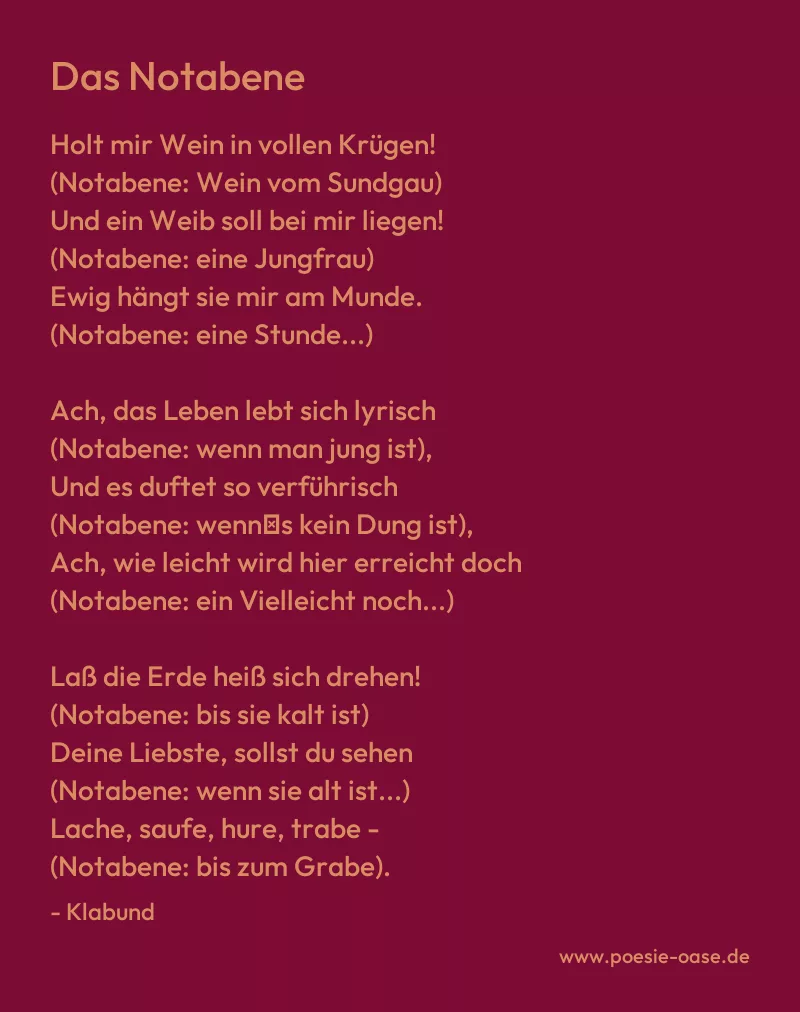
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Notabene“ von Klabund ist eine spielerische und gleichzeitig melancholische Reflexion über das Leben und seine Vergänglichkeit, verpackt in einer scheinbar leichtfertigen Form. Der Autor nutzt die Methode der Notabene (Anmerkung), um einen Kontrast zwischen den oberflächlichen Wünschen und den tieferen, oft negativen oder zumindest relativierenden Realitäten des Lebens zu erzeugen. Die Struktur des Gedichts, mit ihren kurzen, prägnanten Zeilen und den anschließenden „Notabene“-Zusätzen, verleiht ihm einen ironischen Unterton und unterstreicht die Kluft zwischen dem, was man sich wünscht, und dem, was tatsächlich ist oder was letztendlich bleibt.
Die ersten Strophen des Gedichts drücken zunächst die Sehnsucht nach sinnlichem Genuss aus: Wein, Weib und die flüchtige Erfahrung der Liebe. Die „Notabene“-Anmerkungen untergraben diese scheinbare Unbeschwertheit jedoch sofort. So wird der Wein auf eine bestimmte Herkunft reduziert („Wein vom Sundgau“), die Jungfrau nur für eine Stunde „am Munde“ festgehalten, und die „ewige“ Liebe entpuppt sich als kurzlebig. Diese Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität ist ein zentrales Thema des Gedichts und deutet auf eine tiefere Erkenntnis des Autors hin: Alles, was das Leben an Reizen bietet, ist vergänglich und begrenzt.
Die zweite Strophe greift die Idee der Jugend und der Verführung auf. „Das Leben lebt sich lyrisch“, so die Aussage, was in der Jugend oder in einem Zustand der Unbekümmertheit gelten mag. Doch die „Notabene“-Anmerkung („wenn man jung ist“) relativiert diese Aussage sofort. Ebenso wird die Verführung, das „Duften“, eingeschränkt durch die Vorstellung, dass es „kein Dung“ sein darf. Die scheinbare Leichtigkeit des Lebens, die in den folgenden Zeilen angedeutet wird, wird durch die abschließende „Notabene“ („ein Vielleicht noch…“) weiter abgeschwächt. Der Autor scheint anzudeuten, dass die Erreichbarkeit der Wünsche fragil und unsicher ist.
Die abschließende Strophe des Gedichts wendet sich der Vergänglichkeit des Lebens zu. Das „heiße Drehen der Erde“ wird durch die „Notabene“ bis zu ihrem kalten Ende relativiert. Die Liebste, die Gegenwärtigkeit der Liebe, wird durch die Erkenntnis der Alterung und des möglichen Verlustes eingeengt. Der letzte Vers, der das „Lachen, Saufen, Huren und Traben“ auffordert, endet mit der finalen „Notabene“ bis „zum Grabe“, wodurch die endgültige Begrenzung des Lebens auf das Grab und damit auf den Tod verdeutlicht wird. Klabunds Gedicht ist somit eine bittere, aber charmante Reflexion über die menschliche Existenz, ihre Freuden und ihre Grenzen. Es ist ein Spiel mit Gegensätzen, ein Tanz zwischen Lebenslust und Melancholie, und ein subtiles Eingeständnis der Vergeblichkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.