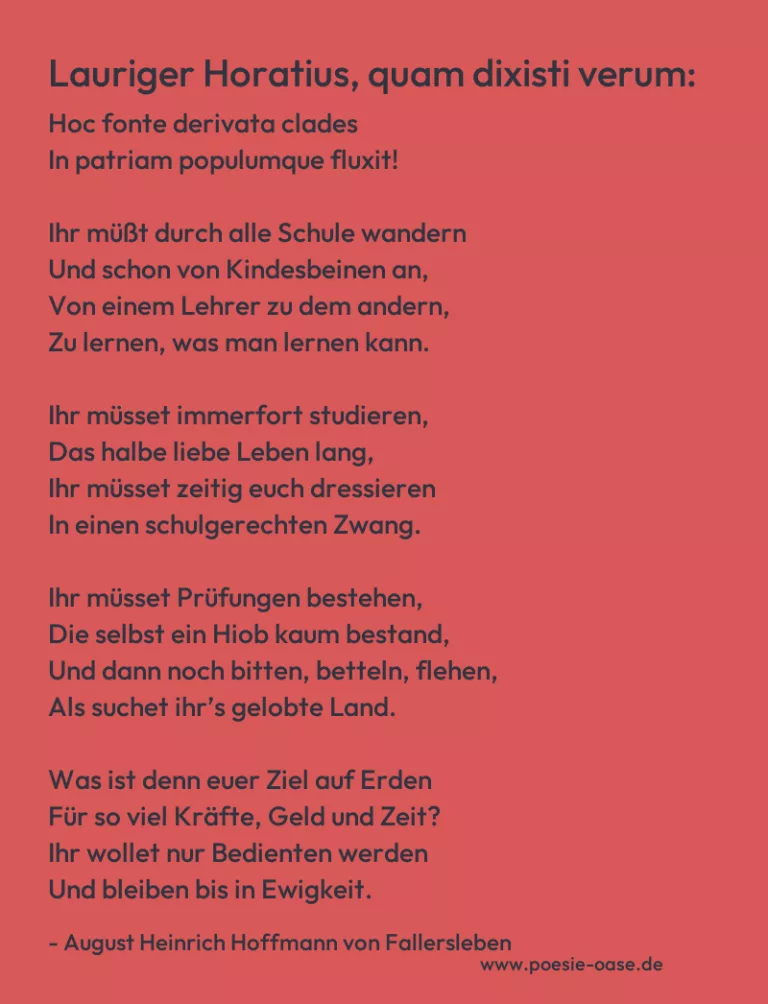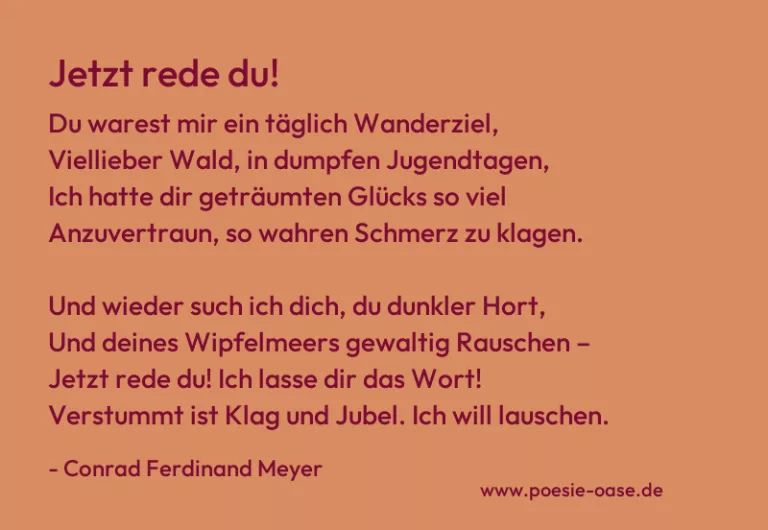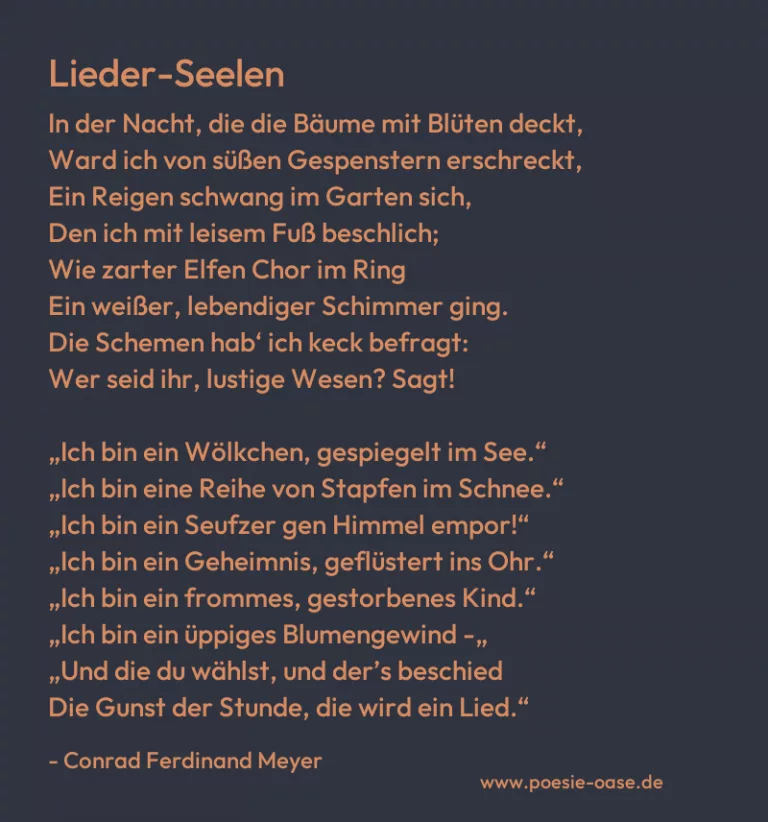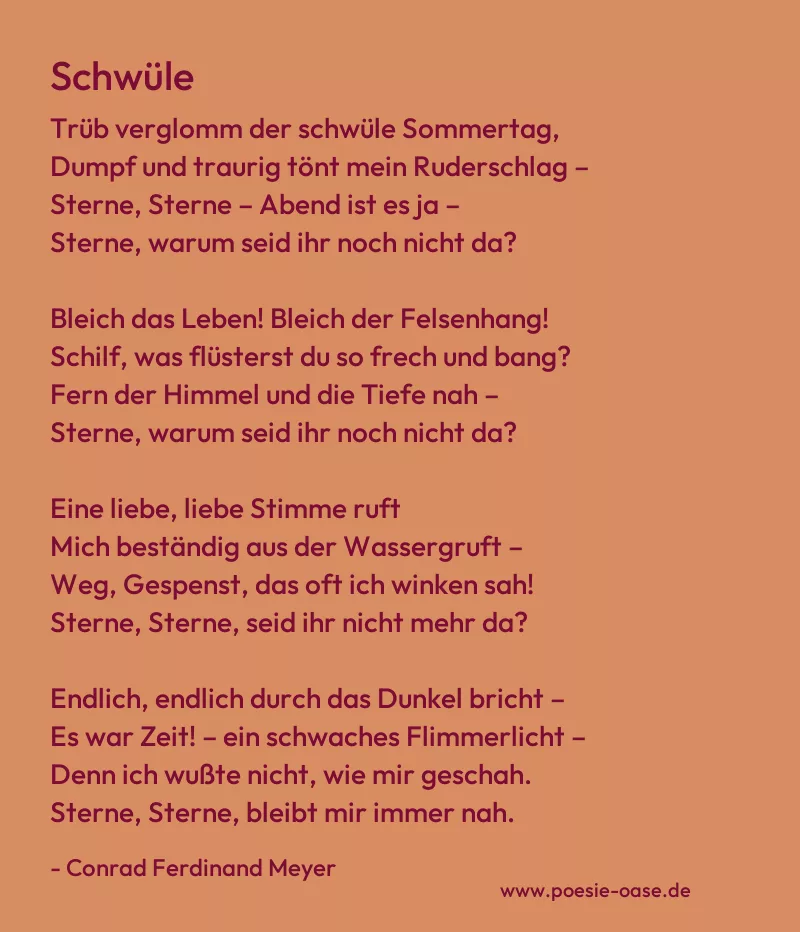Schwüle
Trüb verglomm der schwüle Sommertag,
Dumpf und traurig tönt mein Ruderschlag –
Sterne, Sterne – Abend ist es ja –
Sterne, warum seid ihr noch nicht da?
Bleich das Leben! Bleich der Felsenhang!
Schilf, was flüsterst du so frech und bang?
Fern der Himmel und die Tiefe nah –
Sterne, warum seid ihr noch nicht da?
Eine liebe, liebe Stimme ruft
Mich beständig aus der Wassergruft –
Weg, Gespenst, das oft ich winken sah!
Sterne, Sterne, seid ihr nicht mehr da?
Endlich, endlich durch das Dunkel bricht –
Es war Zeit! – ein schwaches Flimmerlicht –
Denn ich wußte nicht, wie mir geschah.
Sterne, Sterne, bleibt mir immer nah.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
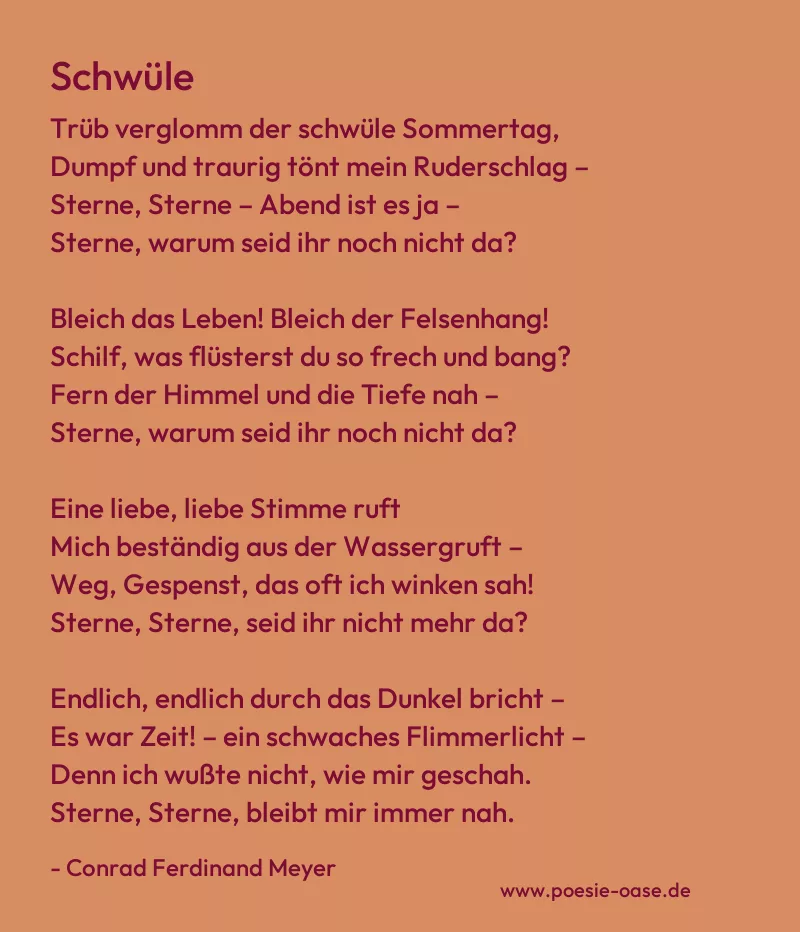
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Schwüle“ von Conrad Ferdinand Meyer zeichnet eine düstere, von Unruhe und Sehnsucht geprägte Stimmung, die sich in der Darstellung der Umgebung und der inneren Gefühlswelt des lyrischen Ichs widerspiegelt. Zu Beginn wird der „schwüle Sommertag“ beschrieben, der „trüb verglomm“, was eine beklemmende Atmosphäre erzeugt. Die „dumpf und traurig“ tönen Ruderschläge verstärken das Gefühl der Melancholie und des Zögerns. Es scheint, als ob die Zeit in diesem Moment der Unruhe stillsteht, während das lyrische Ich von den „Sternen“ spricht, die noch nicht erschienen sind. Der Ruf nach den Sternen symbolisiert eine Sehnsucht nach Licht, Orientierung und Klarheit in einer Welt, die im Dunkeln liegt.
Das Bild des „bleichen Lebens“ und des „bleichen Felsenhangs“ verstärkt die Idee von Entfremdung und innerer Leere. Die Natur, die im Gedicht dargestellt wird, scheint ebenso von einer Art blasser, geisterhafter Existenz geprägt zu sein – das „Schilf“, das „flüsterst“ und dabei sowohl „frech als auch bang“ wirkt, wirkt wie ein unheilvolles Zeichen. Der „fern der Himmel“ und die „Tiefe nah“ verweisen auf das Unheimliche und Unbestimmte, das die Nähe des lyrischen Ichs zu den Kräften der Dunkelheit und des Unbewussten anzeigt. Diese Zerrissenheit zwischen der unerreichbaren Ferne des Himmels und der bedrückenden Nähe der Tiefe verstärkt das Gefühl der inneren Zerstreuung.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird eine „liebe, liebe Stimme“ eingeführt, die das lyrische Ich aus der „Wassergruft“ ruft. Diese Stimme, die mit dem Bild eines Gespenstes verknüpft ist, scheint gleichzeitig eine Einladung und eine Bedrohung darzustellen. Die wiederholte Frage nach den Sternen – „Sterne, warum seid ihr noch nicht da?“ – verweist auf die verzweifelte Suche nach Führung und Erleuchtung in einem Zustand der Verwirrung und Angst. Die Stimme könnte eine Metapher für die innere Sehnsucht nach einem rettenden Moment oder einer Erleuchtung sein, die bislang ausgeblieben ist.
Am Ende des Gedichts, wenn das „Dunkel“ schließlich durchbricht und „ein schwaches Flimmerlicht“ erscheint, ist der Übergang von Dunkelheit zu Licht vollzogen. Doch das „schwache Flimmerlicht“ ist eher ein zarter Hinweis auf eine mögliche Erlösung oder Klarheit, die das lyrische Ich noch nicht ganz erfasst hat. Die Aussage „Sterne, Sterne, bleibt mir immer nah“ unterstreicht den Wunsch nach dauerhafter Orientierung und Führung, das Streben nach einem stabilen Licht inmitten der Dunkelheit. Das Gedicht endet mit einer Hoffnung auf Nähe und Beständigkeit in einer Welt, die von innerer Unruhe und der Suche nach Klarheit geprägt ist. Meyer zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie das Streben nach Erleuchtung und Orientierung das menschliche Erleben durchziehen kann, besonders in Zeiten von Zweifeln und Verwirrung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.