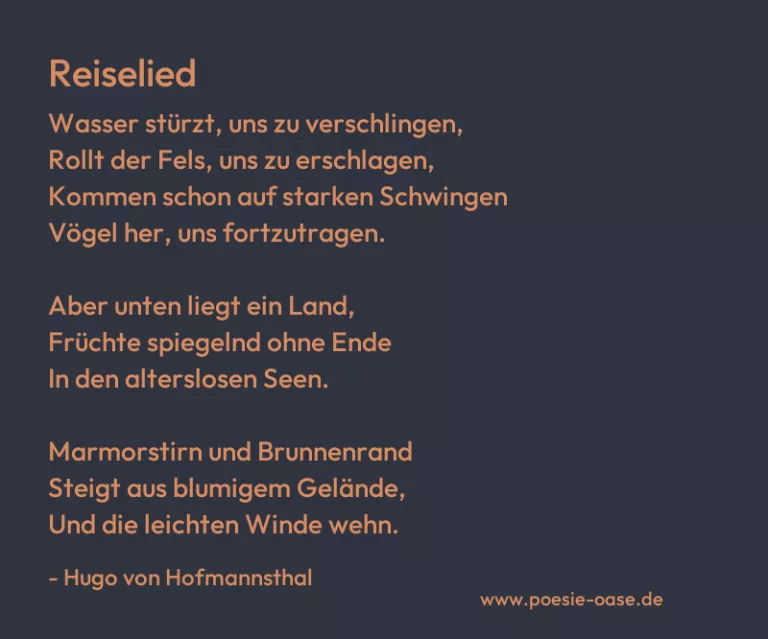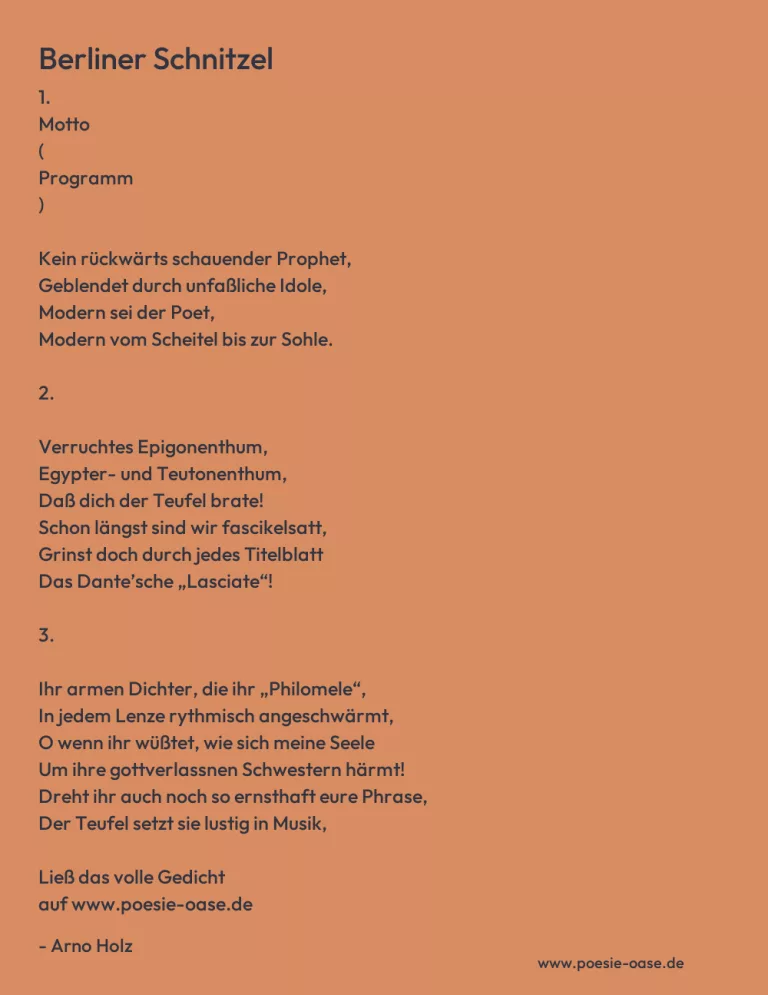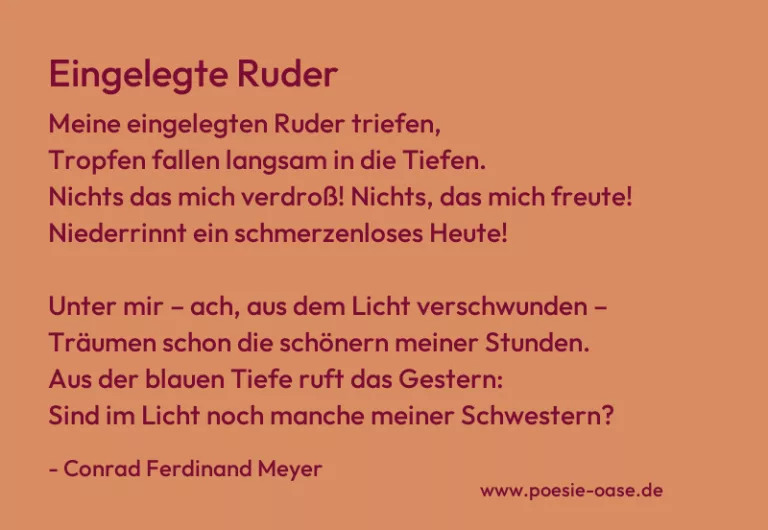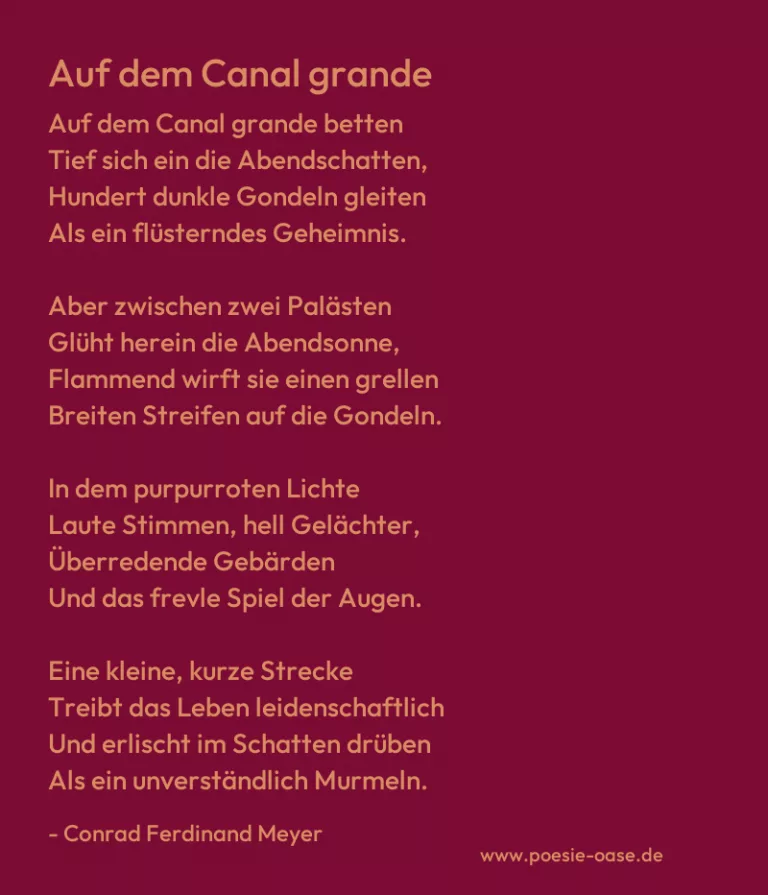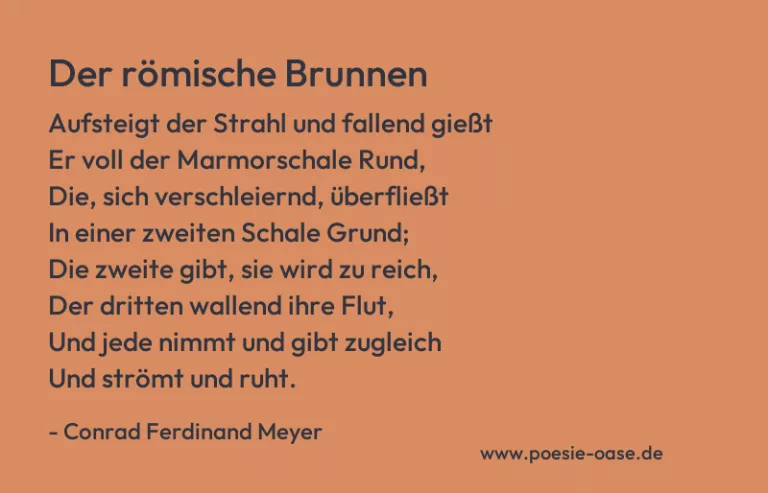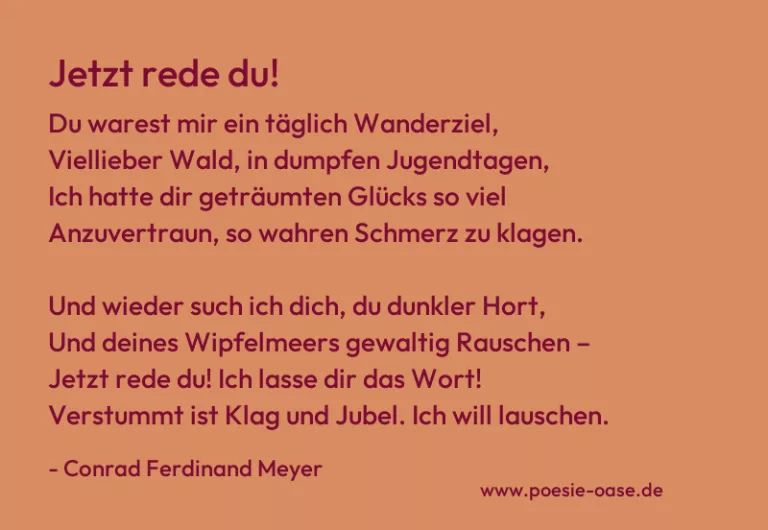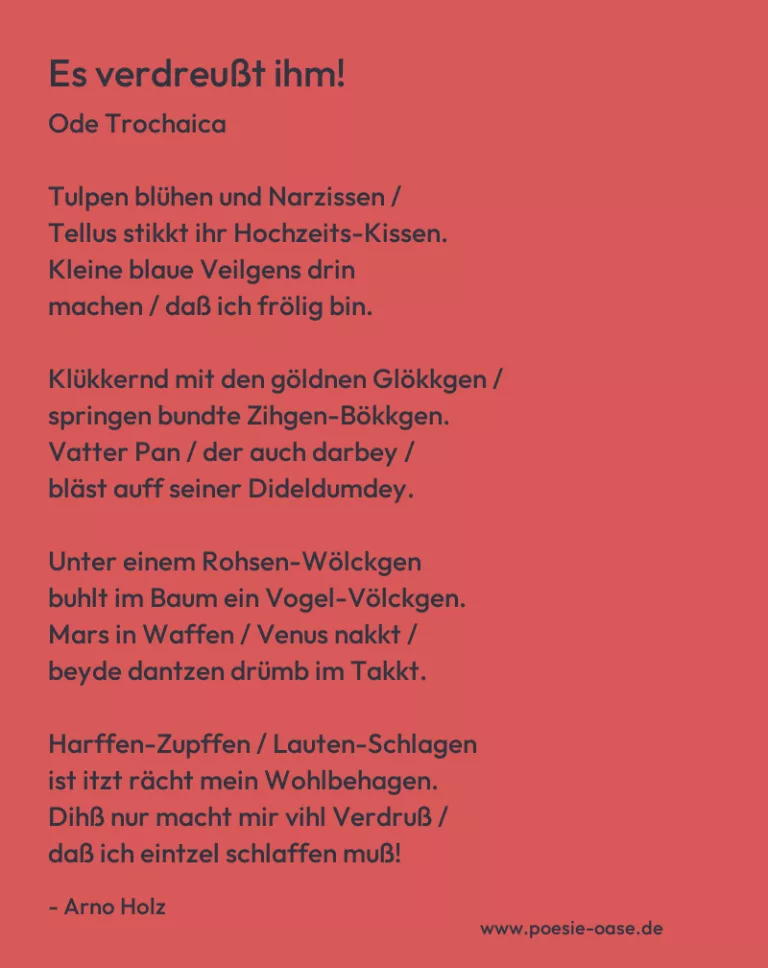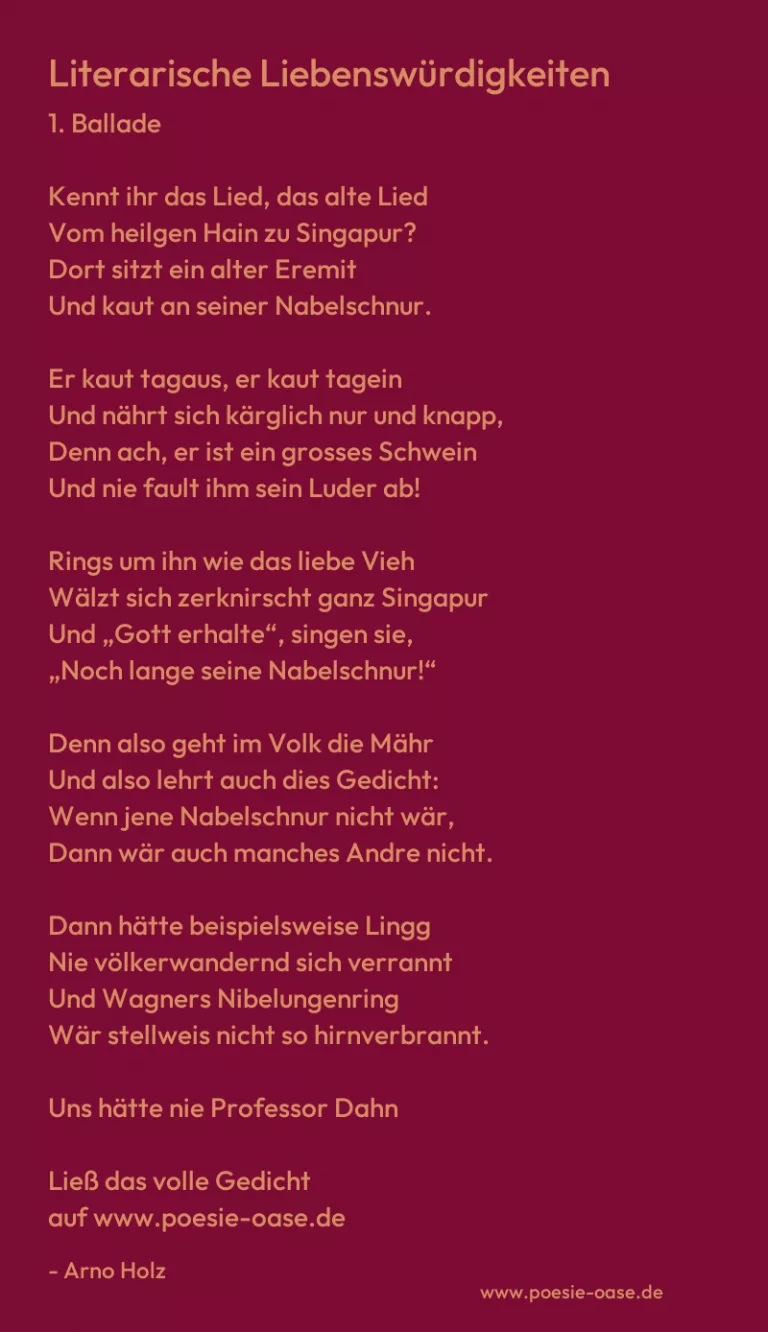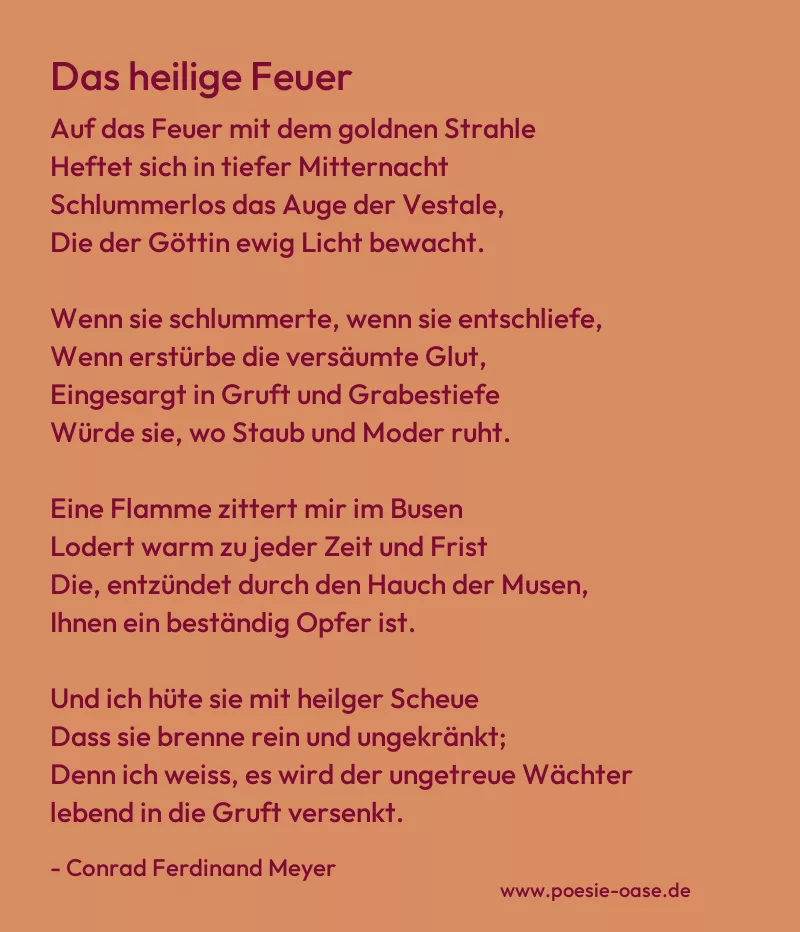Das heilige Feuer
Auf das Feuer mit dem goldnen Strahle
Heftet sich in tiefer Mitternacht
Schlummerlos das Auge der Vestale,
Die der Göttin ewig Licht bewacht.
Wenn sie schlummerte, wenn sie entschliefe,
Wenn erstürbe die versäumte Glut,
Eingesargt in Gruft und Grabestiefe
Würde sie, wo Staub und Moder ruht.
Eine Flamme zittert mir im Busen
Lodert warm zu jeder Zeit und Frist
Die, entzündet durch den Hauch der Musen,
Ihnen ein beständig Opfer ist.
Und ich hüte sie mit heilger Scheue
Dass sie brenne rein und ungekränkt;
Denn ich weiss, es wird der ungetreue Wächter
lebend in die Gruft versenkt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
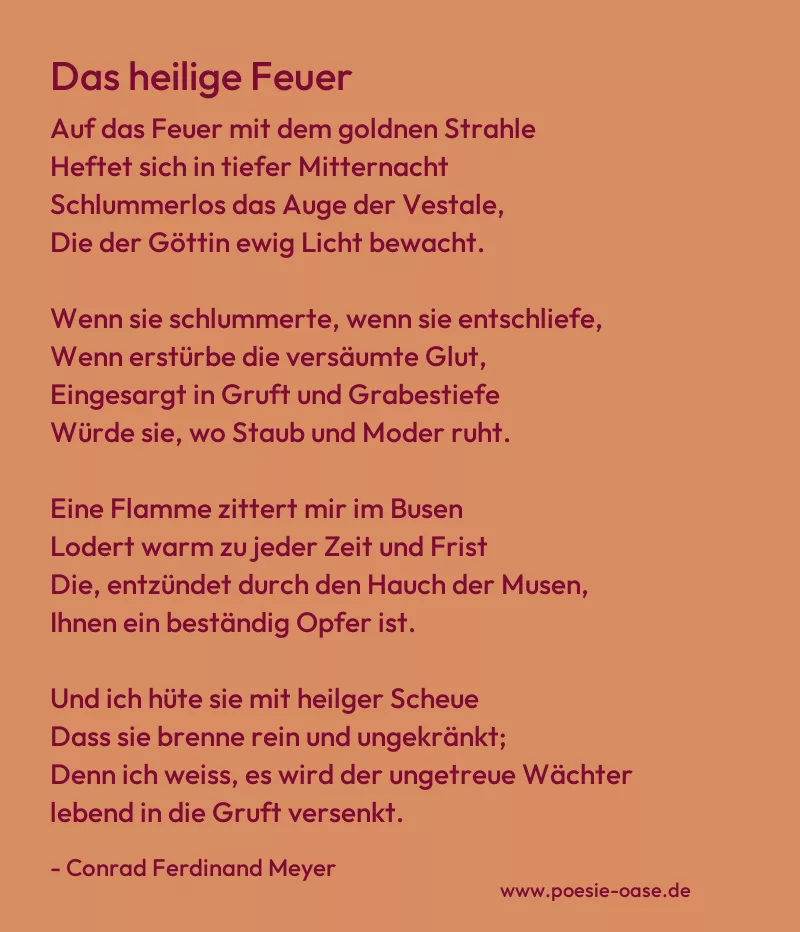
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das heilige Feuer“ von Conrad Ferdinand Meyer thematisiert die Bewahrung von Leidenschaft, Kreativität und innerer Hingabe, wobei das „heilige Feuer“ als Metapher für eine unaufhörliche, schützende Flamme dient, die es zu hüten gilt. Zu Beginn wird das Bild der Vestalin eingeführt, einer Priesterin, die die heilige Flamme der Göttin in der tiefen Mitternacht bewacht. Die Vestale symbolisiert hier eine Person, die ihre Aufgabe – das Aufrechterhalten des heiligen Feuers – mit Hingabe und Disziplin erfüllt. Das Bild der „schlummerlosen“ Vestalin unterstreicht den hohen Einsatz und die Verantwortung, die mit dieser Aufgabe verbunden sind. Der Verlust des Feuers – etwa durch Schlaf oder Versagen – würde mit dem Tod und der Vergänglichkeit verbunden sein, was die Bedeutung der beständigen Bewahrung dieser Flamme verdeutlicht.
Das Gedicht wechselt dann zu einer persönlichen Perspektive, in der der Sprecher von einer „Flamme“ spricht, die in seinem Inneren lodert. Diese Flamme ist die Quelle seines kreativen und künstlerischen Ausdrucks, die „entzündet durch den Hauch der Musen“ – die Musen, die in der griechischen Mythologie für die Inspiration der Künste verantwortlich sind. Der Sprecher sieht diese Flamme als ein „beständiges Opfer“, was bedeutet, dass er sich fortwährend dieser Inspiration und dem kreativen Prozess hingibt. Es handelt sich um eine Leidenschaft, die sowohl heilig als auch gefährlich ist – eine Flamme, die ständig gepflegt werden muss, um ihre Reinheit zu bewahren.
Die Sorge des Sprechers, die Flamme „rein und ungekränkt“ zu halten, zeigt eine tiefe Respektierung dieser inneren Quelle der Kreativität und des Lebens. Der Gedanke, dass der „ungetreue Wächter“ – jemand, der die Flamme vernachlässigt oder beschädigt – „lebend in die Gruft versenkt“ wird, weist auf die dramatischen Konsequenzen des Scheiterns hin. Es ist eine Warnung vor der Gefahr, diese Flamme zu verlieren oder zu opfern, denn der Verlust dieser inneren Inspiration würde zu einem „Grab“ führen, das metaphorisch für den Verlust der Kreativität und der geistigen Vitalität steht. Die „Gruft“ steht somit für das endgültige Ende der Schaffenskraft und der Verbindung zu einer höheren, spirituellen Quelle.
Insgesamt vermittelt das Gedicht die Bedeutung von Hingabe und Wachsamkeit in Bezug auf die eigene Kreativität und den inneren Antrieb. Es fordert den Leser dazu auf, die „heilige Flamme“ des eigenen Lebens mit Respekt und Verantwortung zu hüten und zu bewahren, da nur so das wahre kreative Potenzial und die Lebensenergie aufrechterhalten werden können. Die metaphysischen Bilder von Feuer und Gruft spiegeln die duale Natur von Leidenschaft und Zerbrechlichkeit wider und mahnen dazu, die innere Flamme zu bewahren, um nicht in geistiger Dunkelheit zu versinken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.