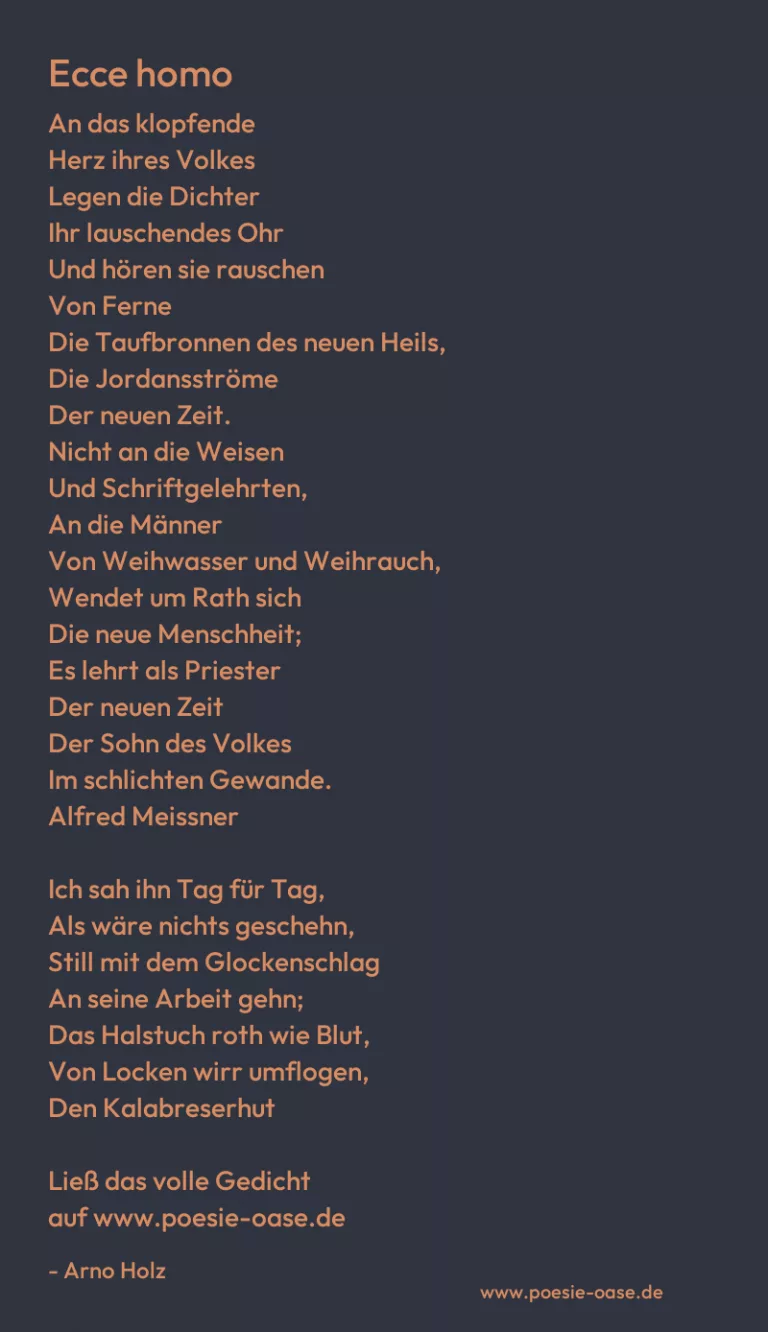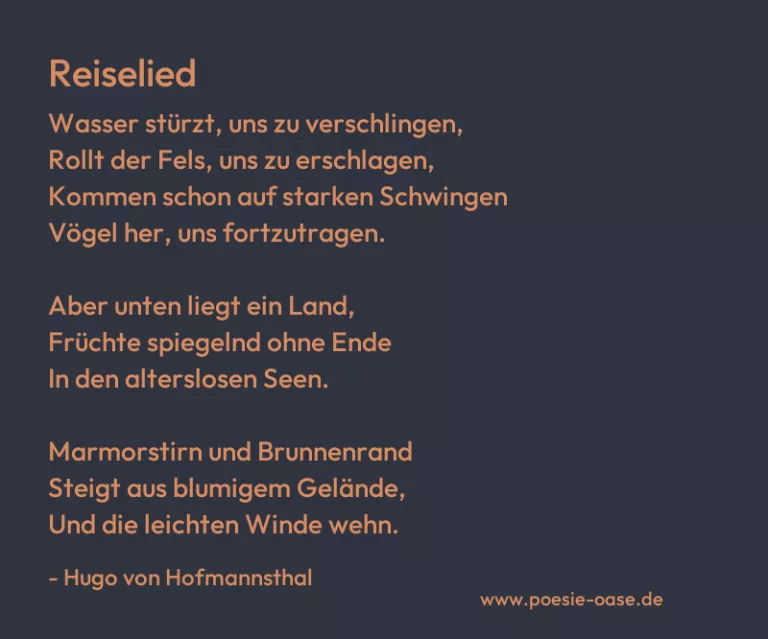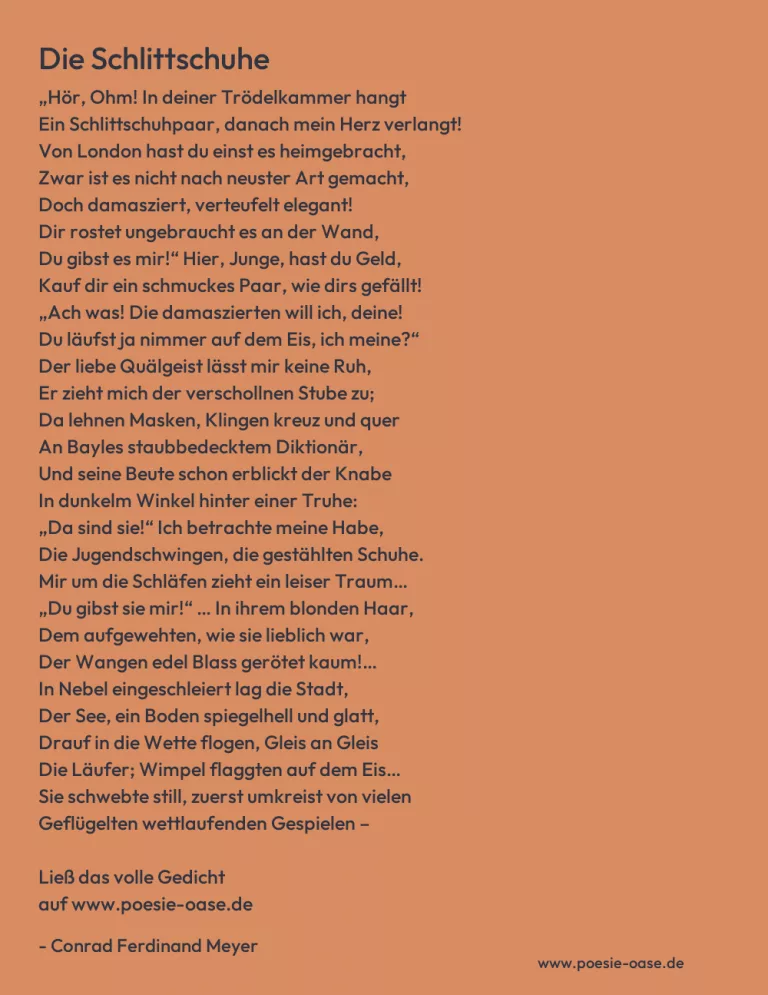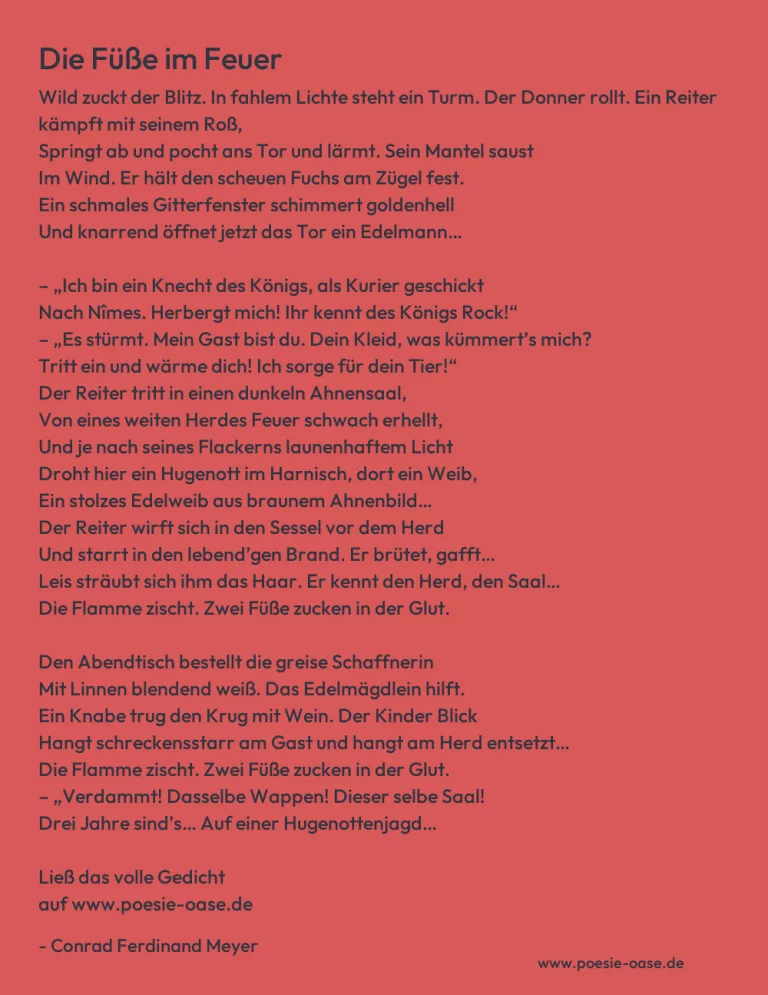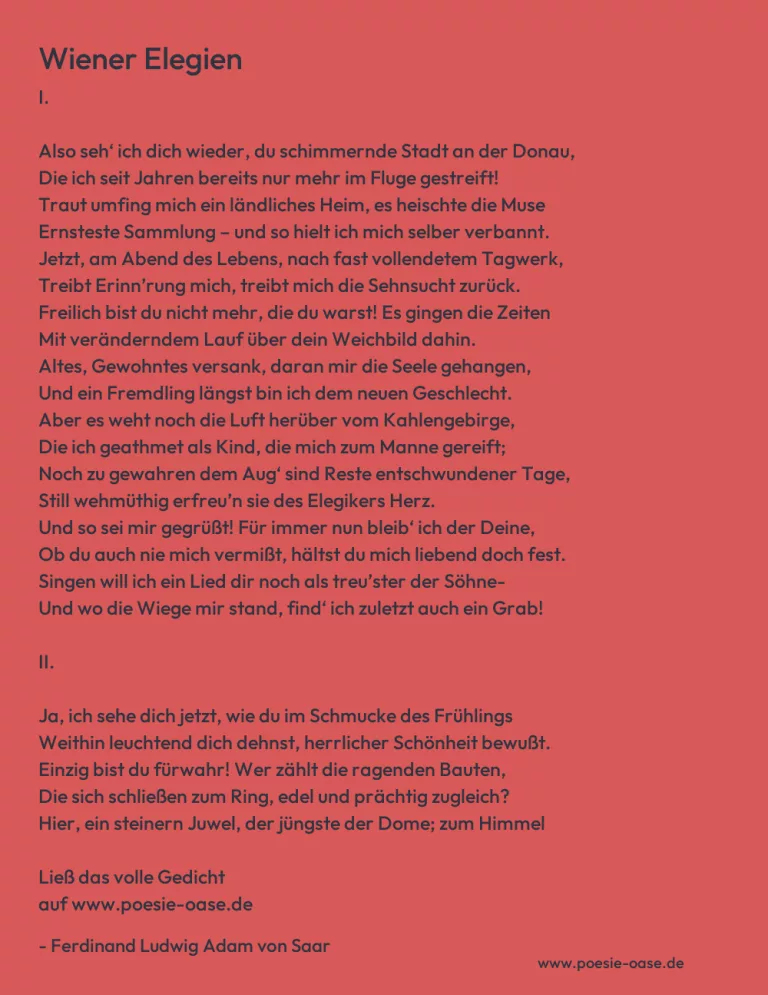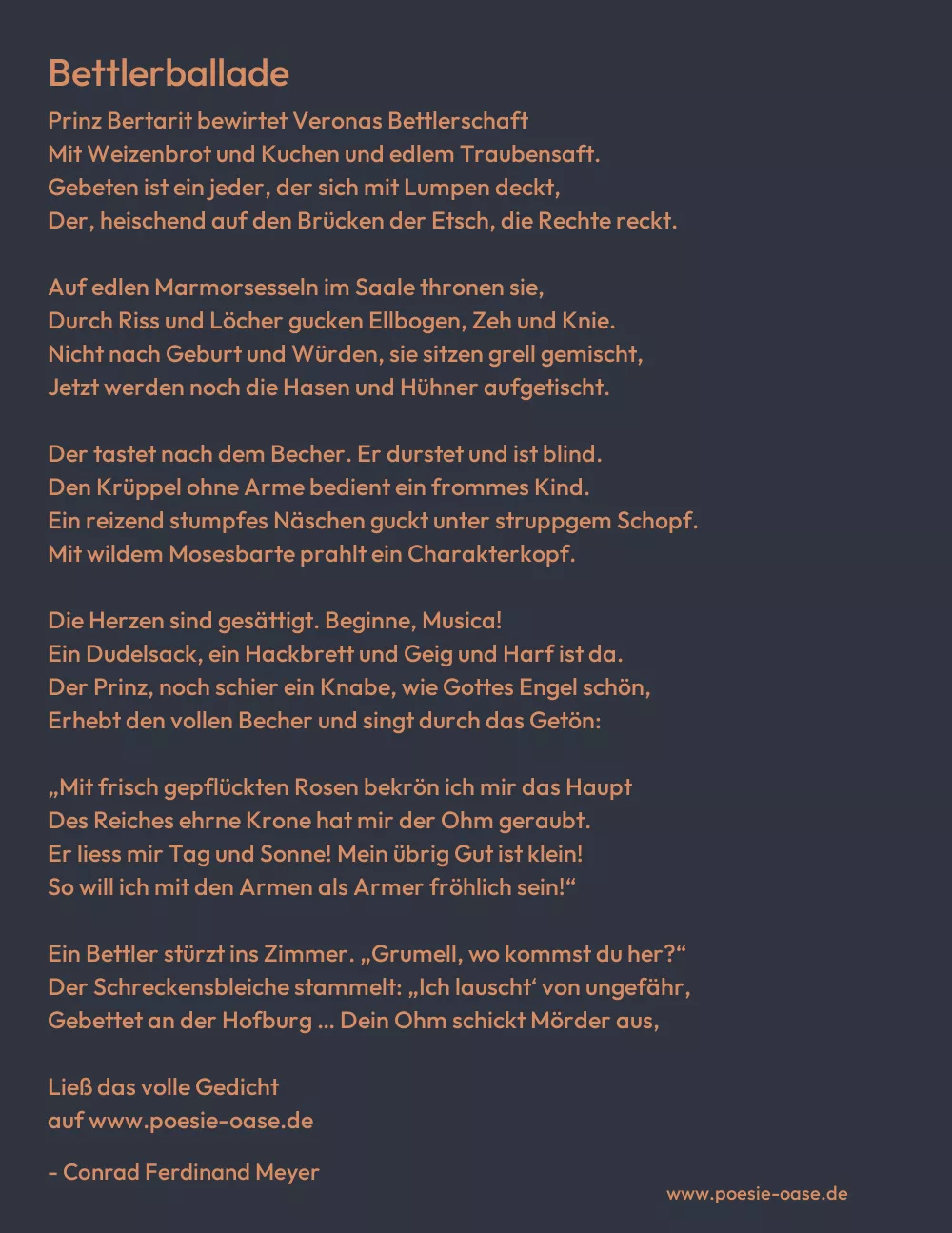Prinz Bertarit bewirtet Veronas Bettlerschaft
Mit Weizenbrot und Kuchen und edlem Traubensaft.
Gebeten ist ein jeder, der sich mit Lumpen deckt,
Der, heischend auf den Brücken der Etsch, die Rechte reckt.
Auf edlen Marmorsesseln im Saale thronen sie,
Durch Riss und Löcher gucken Ellbogen, Zeh und Knie.
Nicht nach Geburt und Würden, sie sitzen grell gemischt,
Jetzt werden noch die Hasen und Hühner aufgetischt.
Der tastet nach dem Becher. Er durstet und ist blind.
Den Krüppel ohne Arme bedient ein frommes Kind.
Ein reizend stumpfes Näschen guckt unter struppgem Schopf.
Mit wildem Mosesbarte prahlt ein Charakterkopf.
Die Herzen sind gesättigt. Beginne, Musica!
Ein Dudelsack, ein Hackbrett und Geig und Harf ist da.
Der Prinz, noch schier ein Knabe, wie Gottes Engel schön,
Erhebt den vollen Becher und singt durch das Getön:
„Mit frisch gepflückten Rosen bekrön ich mir das Haupt
Des Reiches ehrne Krone hat mir der Ohm geraubt.
Er liess mir Tag und Sonne! Mein übrig Gut ist klein!
So will ich mit den Armen als Armer fröhlich sein!“
Ein Bettler stürzt ins Zimmer. „Grumell, wo kommst du her?“
Der Schreckensbleiche stammelt: „Ich lauscht‘ von ungefähr,
Gebettet an der Hofburg … Dein Ohm schickt Mörder aus,
Nimm meinen braunen Mantel!“ Erzschritt umdröhnt das Haus.
„Drück in die Stirn den Hut dir! Er schattet tief! Geschwind!
Da hast du meinen Stecken! Entspring, geliebtes Kind! „
Die Mörder nahen klirrend. Ein Bettler schleicht davon.
„Wer bist du? Zeig das Antlitz!“ Gehobne Dolche drohn.
„Lass ihn! Es ist Grumello! Ich kenn das Loch im Hut!
Ich kenn den Riss im Ärmel! Wir opfern edler Blut!“
Sie spähen durch die Hallen und suchen Bertarit,
Der unter dunkelm Mantel dem dunkeln Tod entflieht.
Er fuhr in fremde Länder und ward darob zum Mann.
Er kehrte heim gepanzert. Den Ohm erschlug er dann.
Verona nahm er stürmend in rotem Feuerschein.
Am Abend lud der König Veronas Bettler ein.