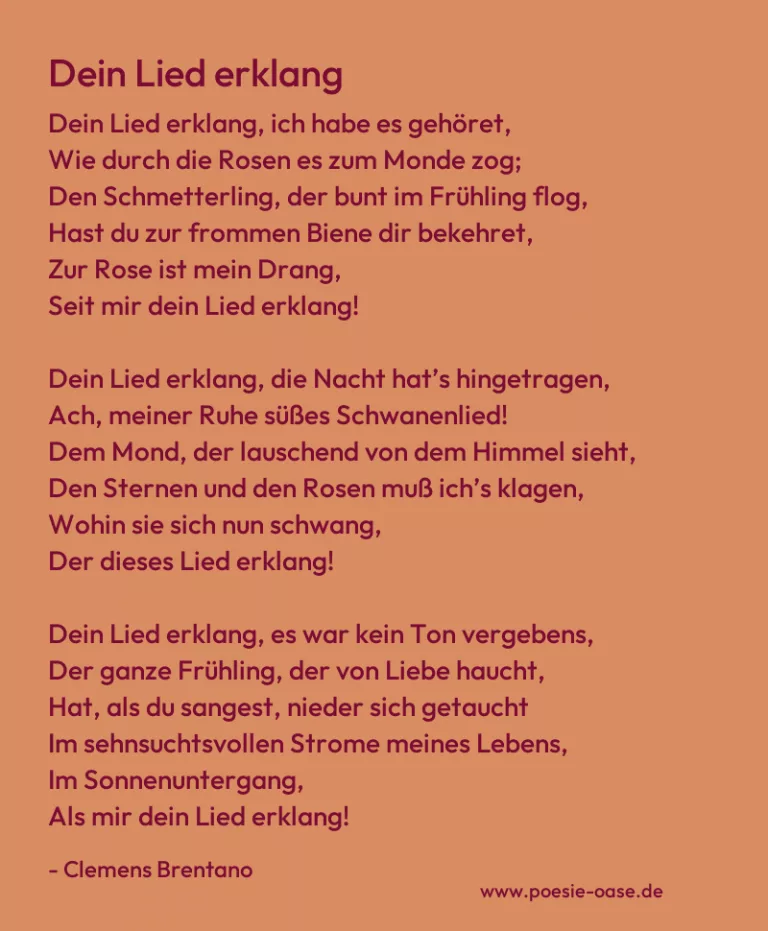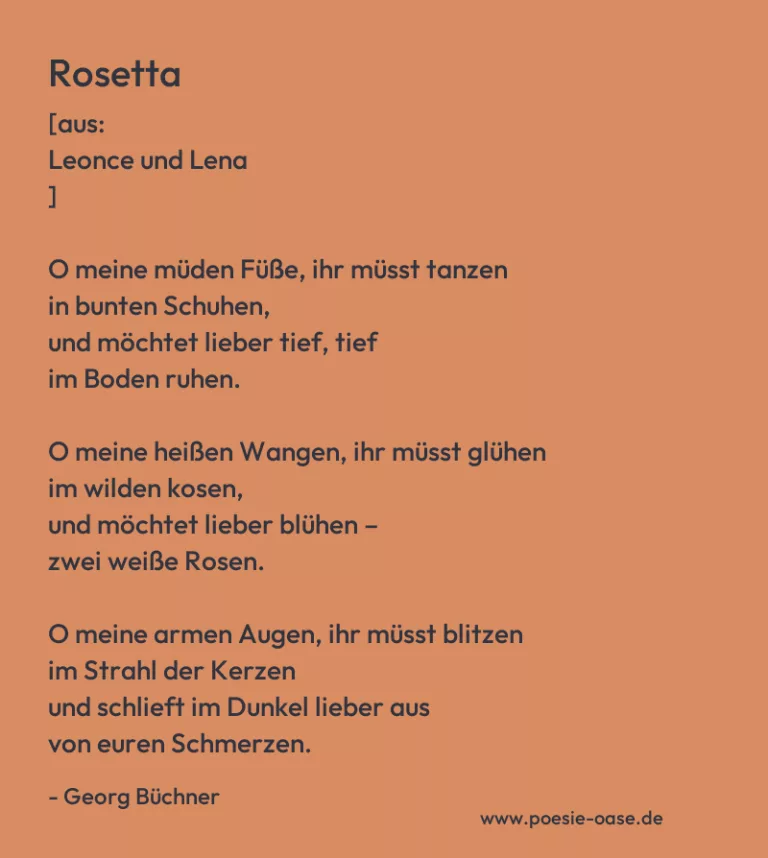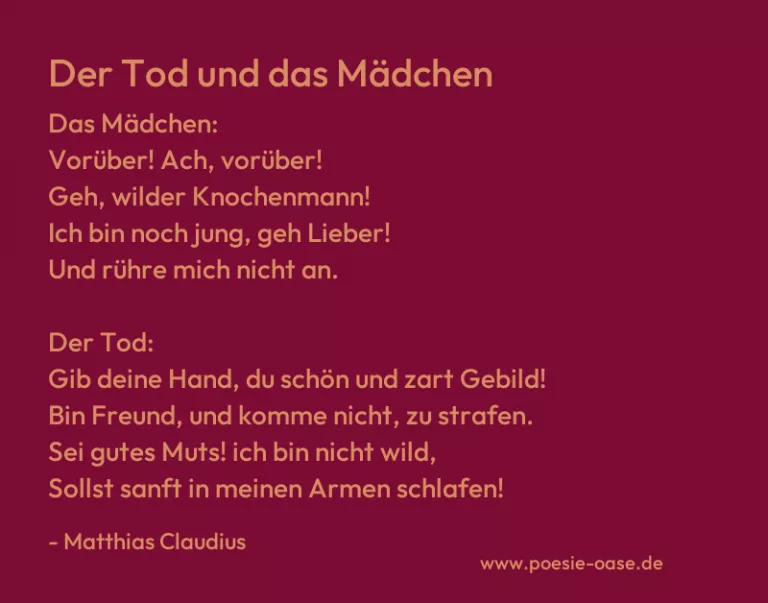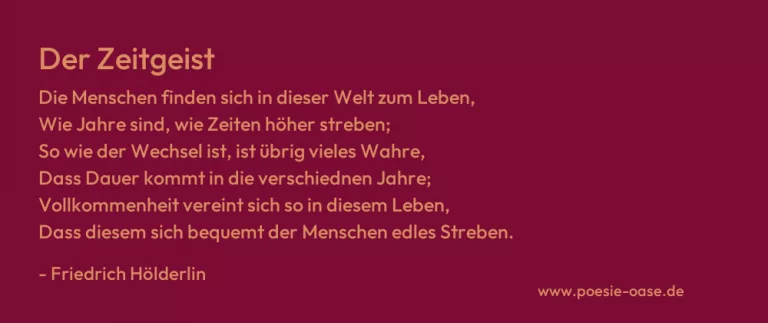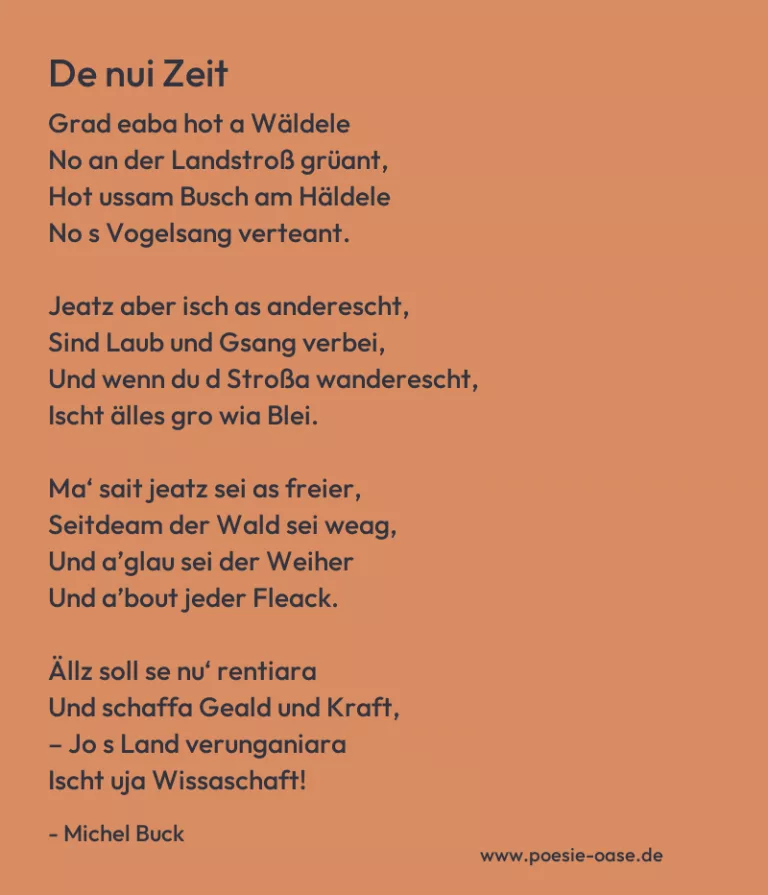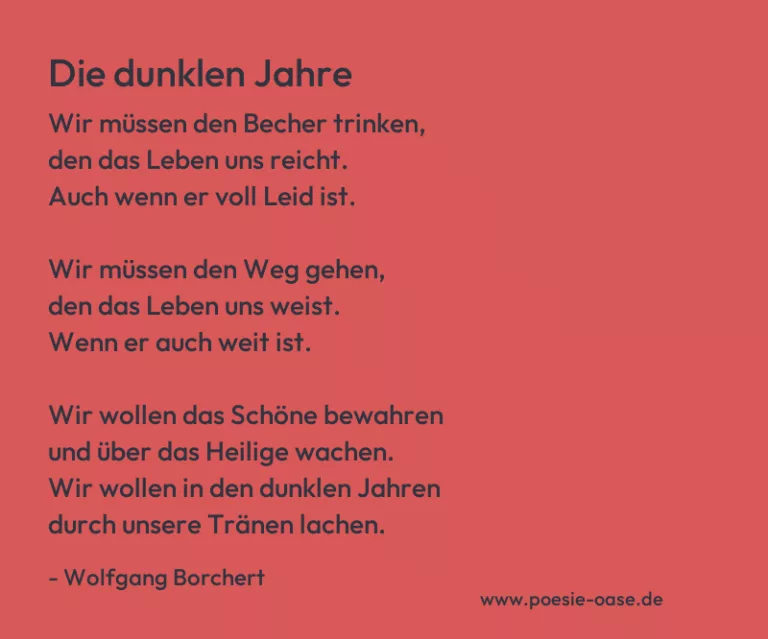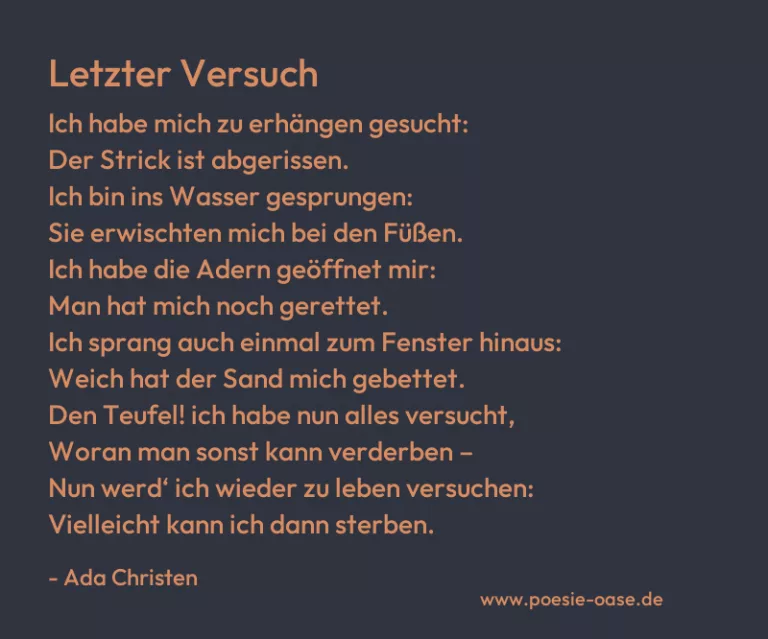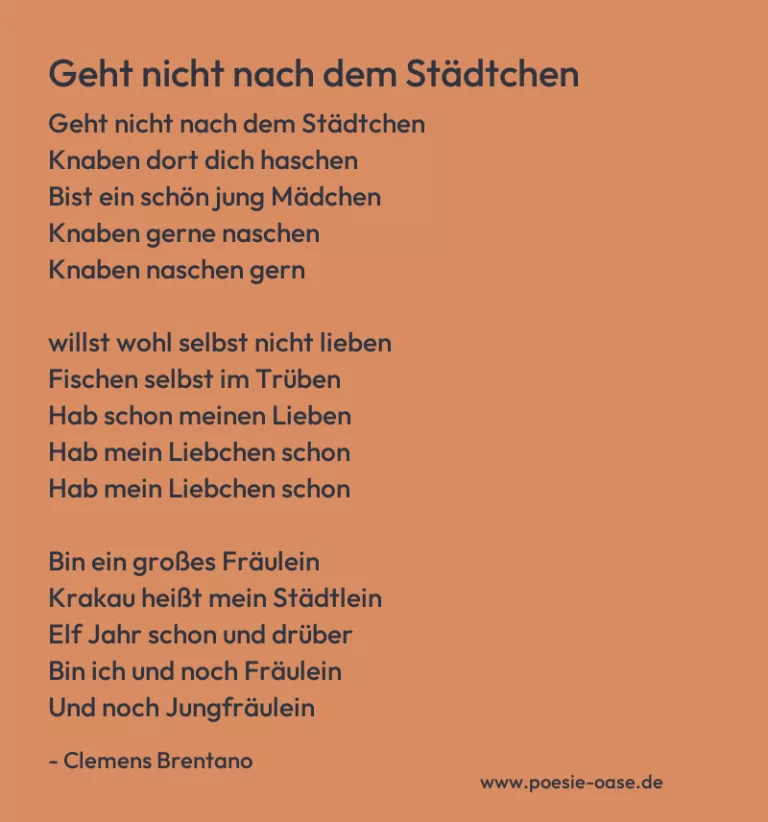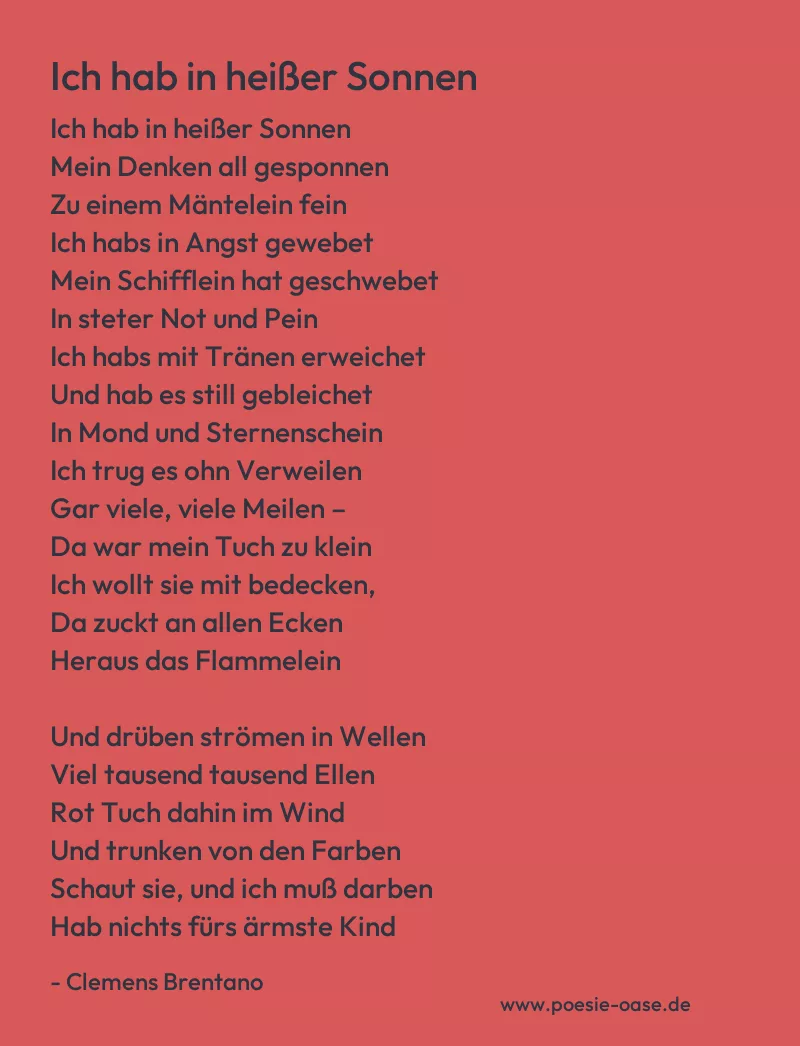Ich hab in heißer Sonnen
Ich hab in heißer Sonnen
Mein Denken all gesponnen
Zu einem Mäntelein fein
Ich habs in Angst gewebet
Mein Schifflein hat geschwebet
In steter Not und Pein
Ich habs mit Tränen erweichet
Und hab es still gebleichet
In Mond und Sternenschein
Ich trug es ohn Verweilen
Gar viele, viele Meilen –
Da war mein Tuch zu klein
Ich wollt sie mit bedecken,
Da zuckt an allen Ecken
Heraus das Flammelein
Und drüben strömen in Wellen
Viel tausend tausend Ellen
Rot Tuch dahin im Wind
Und trunken von den Farben
Schaut sie, und ich muß darben
Hab nichts fürs ärmste Kind
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
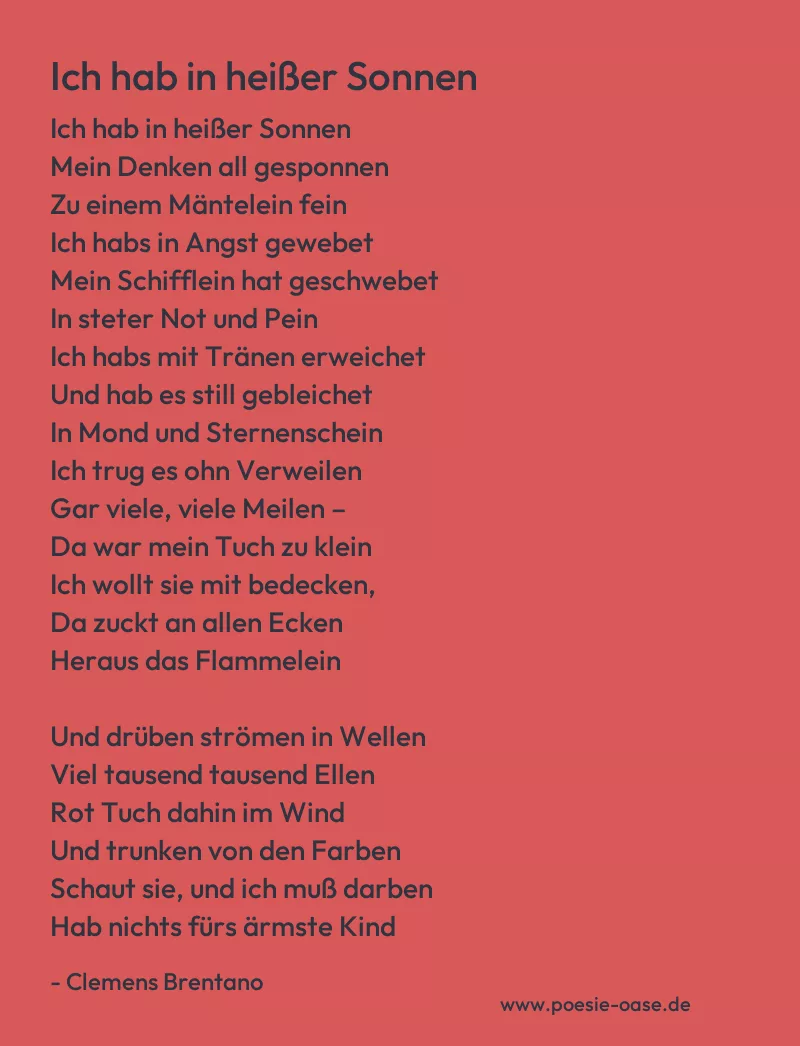
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich hab in heißer Sonnen“ von Clemens Brentano thematisiert in symbolischer, fast märchenhaft anmutender Sprache den Kontrast zwischen innerem Einsatz und äußerem Scheitern, zwischen persönlichem Opfer und unerreichter Erfüllung. Es spricht von der existenziellen Erfahrung, mit aller Kraft etwas zu erschaffen – und am Ende doch mit leeren Händen dazustehen.
Das lyrische Ich beschreibt, wie es aus seinem Denken ein „Mäntelein fein“ spinnt – ein poetisches Bild für einen inneren, ideellen oder vielleicht sogar künstlerischen Schöpfungsprozess. Dieses Werk entsteht nicht leichtfertig, sondern unter großer Anstrengung, Angst und Leid. Es ist durchzogen von Symbolen der Mühe: Hitze, Tränen, Not, stete Bewegung und Einsamkeit. Der Mantel steht dabei für Schutz, Trost, vielleicht sogar Liebe, die das Ich spenden will.
Doch als dieser Mantel gebraucht wird, reicht er nicht: „mein Tuch [war] zu klein“. Die Idee, andere damit zu bedecken – also zu helfen, zu trösten, zu teilen – scheitert. Statt Wärme spendet das Tuch nur Flammen, was auf die enttäuschte Hoffnung oder gar auf verletzende Wirkung des eigentlich gut Gemeinten hindeuten könnte. Es bleibt eine tragische Leere: Der Wunsch, Gutes zu tun, trifft auf die Begrenztheit des Ichs oder die Unzulänglichkeit seiner Mittel.
Die letzte Strophe intensiviert diesen Kontrast. Während das lyrische Ich darbt, „nichts fürs ärmste Kind“ hat, strömt in der Ferne ein unermesslicher Reichtum – rot leuchtender Stoff – herüber, wie im Überfluss vorhanden. Diese Bildwelt verweist auf Ungerechtigkeit oder auf das Gefühl, dass das Eigene unbemerkt bleibt, während andere scheinbar mühelos Schönheit oder Anerkennung erfahren.
Brentano zeichnet mit wenigen, aber starken Bildern eine tiefe emotionale Situation zwischen Sehnsucht, Hingabe und bitterer Enttäuschung. Die poetische Sprache, das Spiel mit Licht, Stoff und Bewegung, machen das Gedicht zu einem Gleichnis über das menschliche Streben und Scheitern – ein leiser, aber schmerzhafter Ausdruck romantischer Melancholie.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.