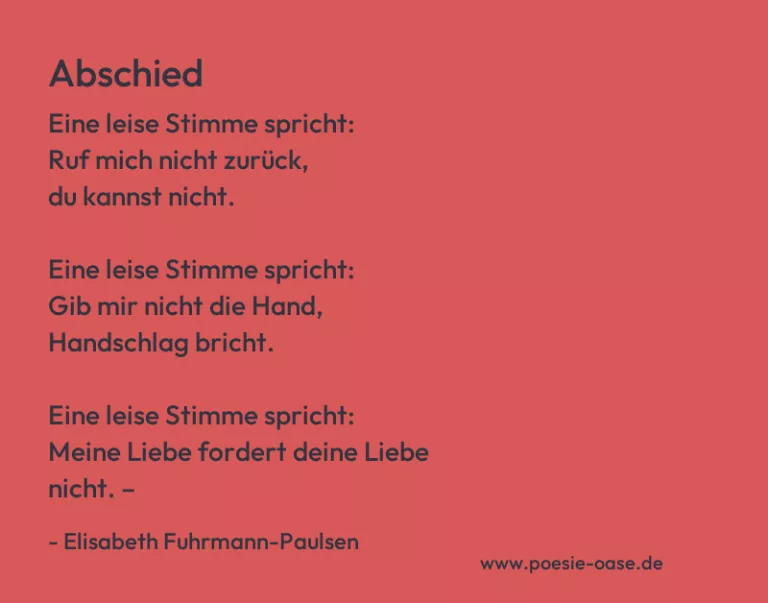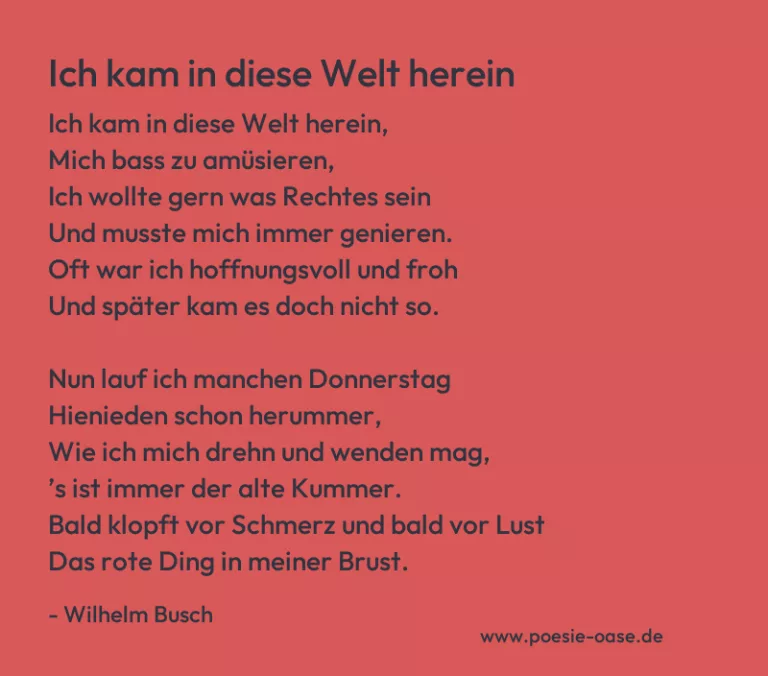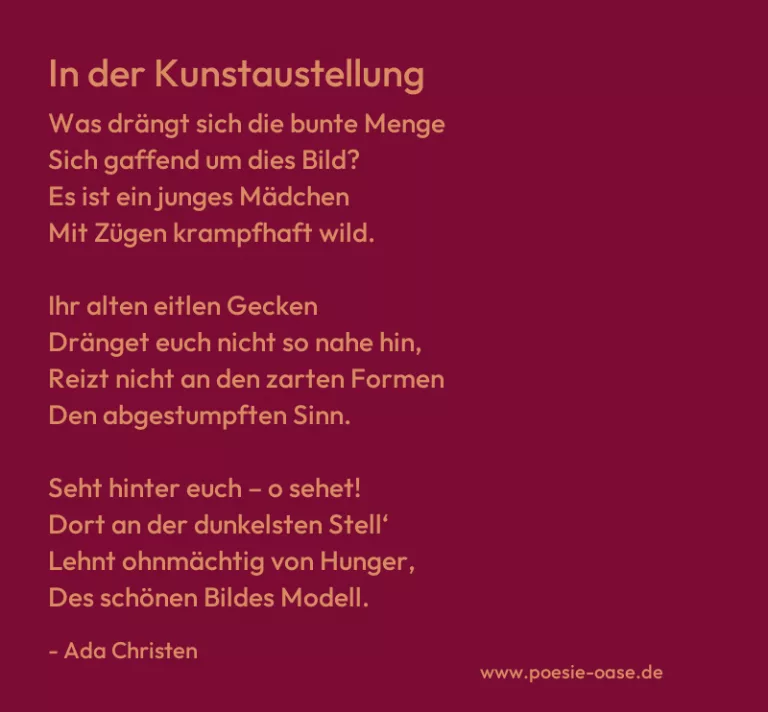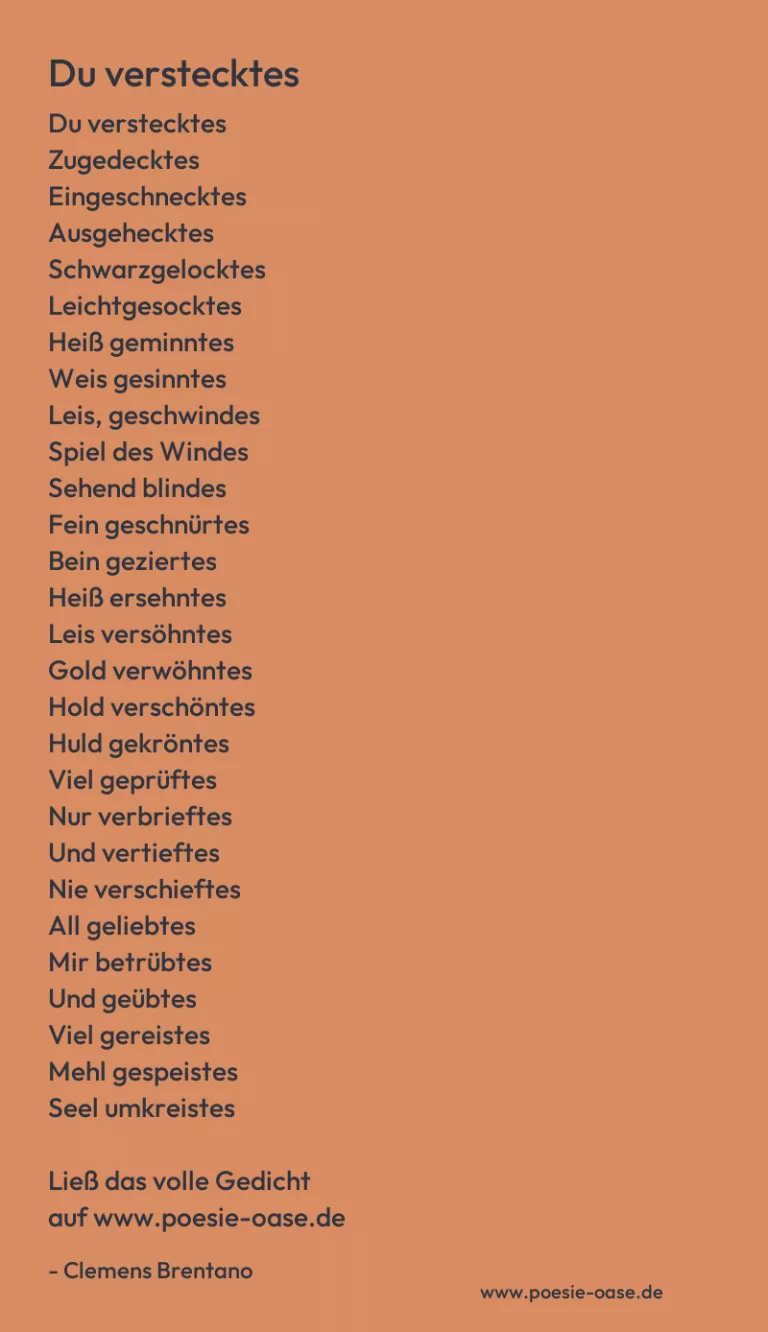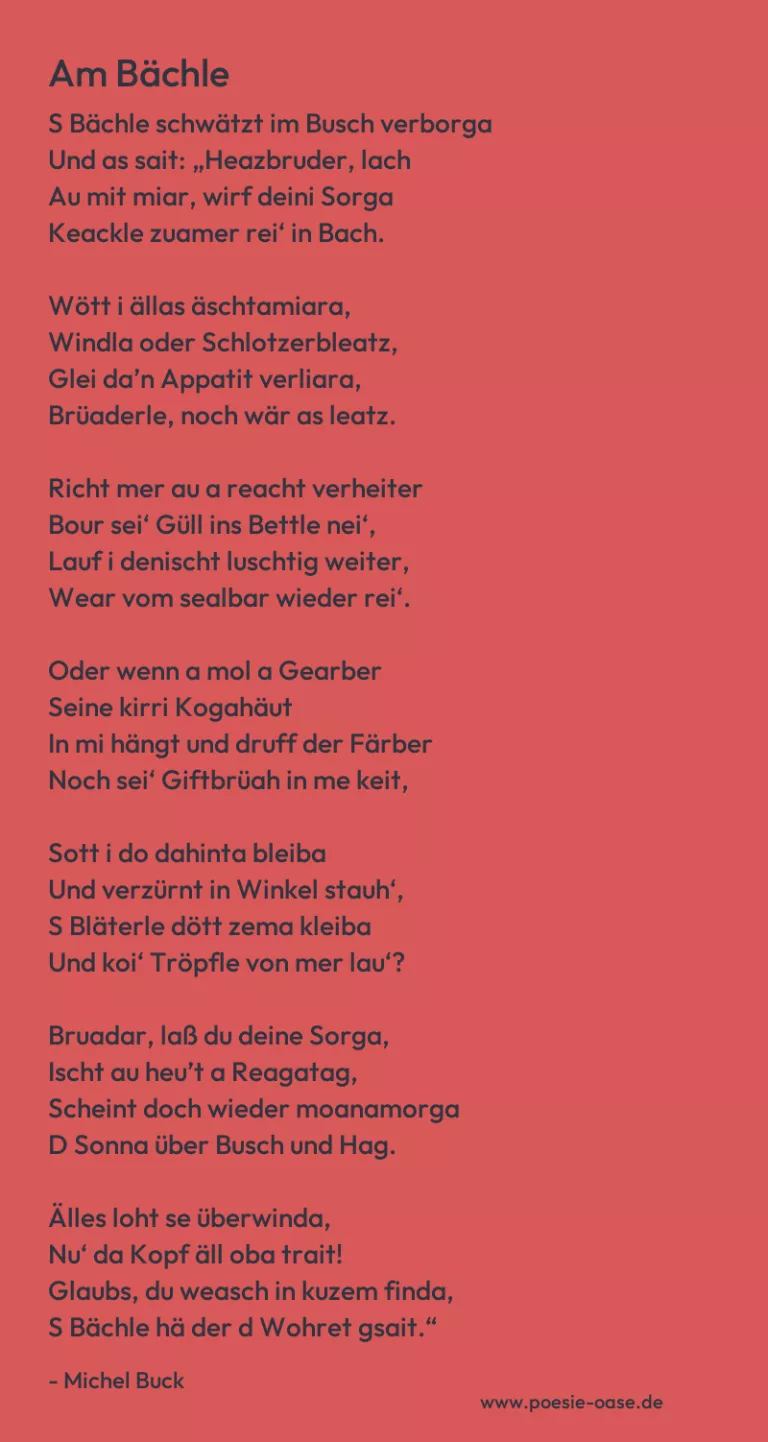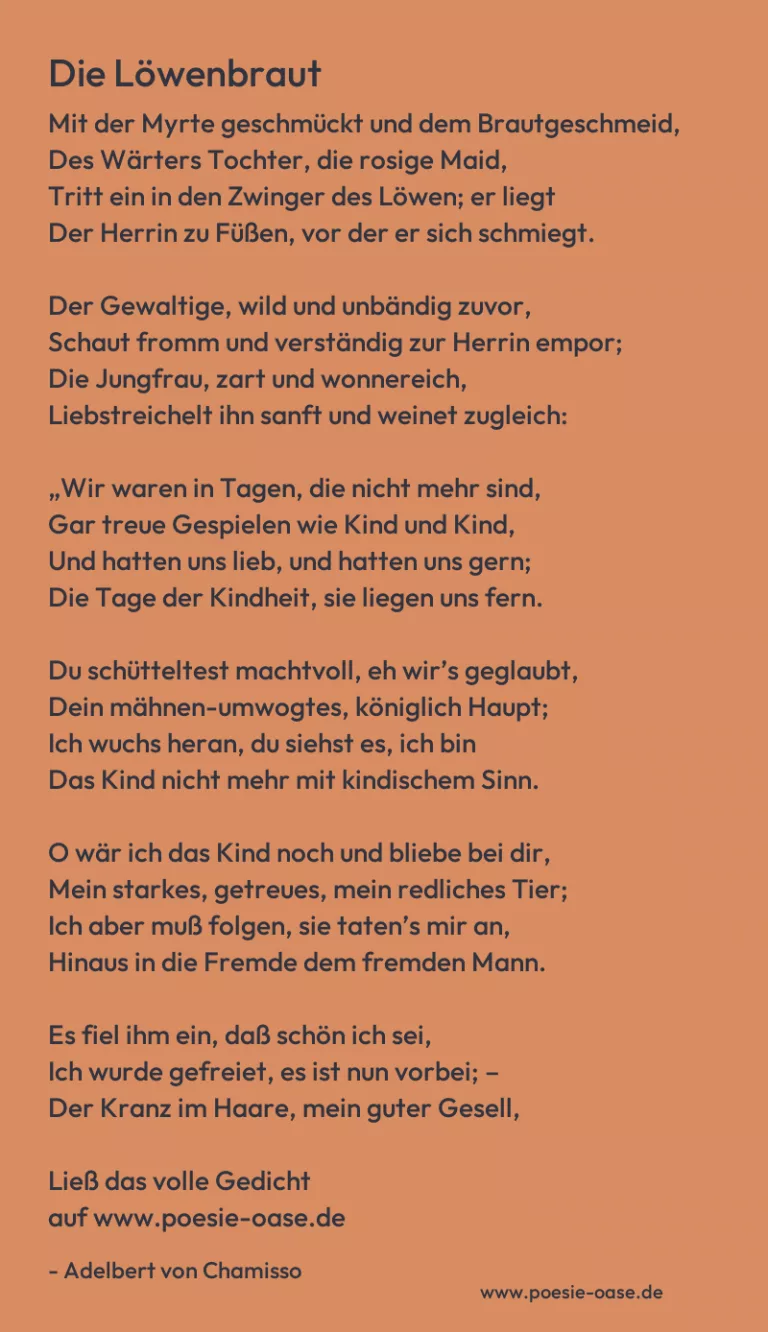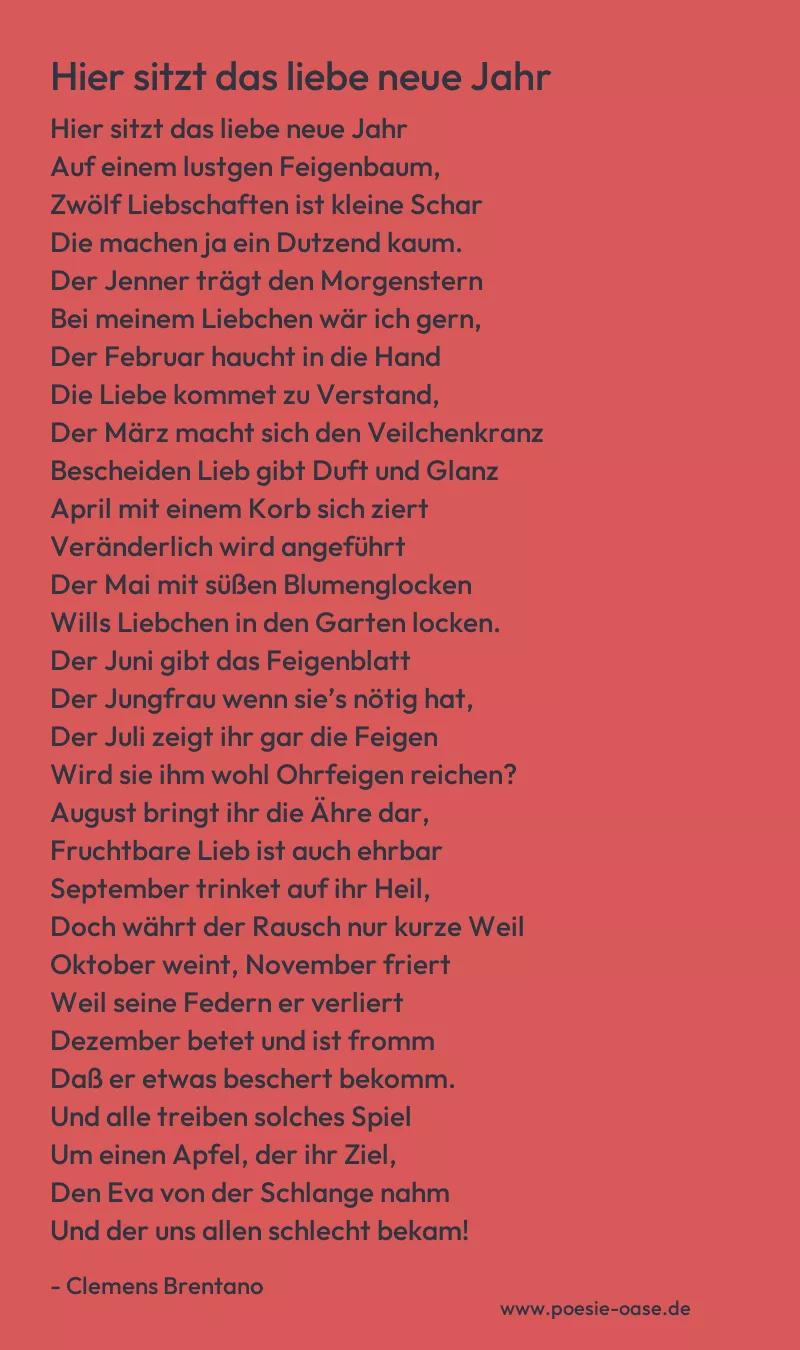Blumen & Pflanzen, Emotionen & Gefühle, Feiern, Fortschritt, Gegenwart, Gemeinfrei, Götter, Leichtigkeit, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Tiere
Hier sitzt das liebe neue Jahr
Hier sitzt das liebe neue Jahr
Auf einem lustgen Feigenbaum,
Zwölf Liebschaften ist kleine Schar
Die machen ja ein Dutzend kaum.
Der Jenner trägt den Morgenstern
Bei meinem Liebchen wär ich gern,
Der Februar haucht in die Hand
Die Liebe kommet zu Verstand,
Der März macht sich den Veilchenkranz
Bescheiden Lieb gibt Duft und Glanz
April mit einem Korb sich ziert
Veränderlich wird angeführt
Der Mai mit süßen Blumenglocken
Wills Liebchen in den Garten locken.
Der Juni gibt das Feigenblatt
Der Jungfrau wenn sie’s nötig hat,
Der Juli zeigt ihr gar die Feigen
Wird sie ihm wohl Ohrfeigen reichen?
August bringt ihr die Ähre dar,
Fruchtbare Lieb ist auch ehrbar
September trinket auf ihr Heil,
Doch währt der Rausch nur kurze Weil
Oktober weint, November friert
Weil seine Federn er verliert
Dezember betet und ist fromm
Daß er etwas beschert bekomm.
Und alle treiben solches Spiel
Um einen Apfel, der ihr Ziel,
Den Eva von der Schlange nahm
Und der uns allen schlecht bekam!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
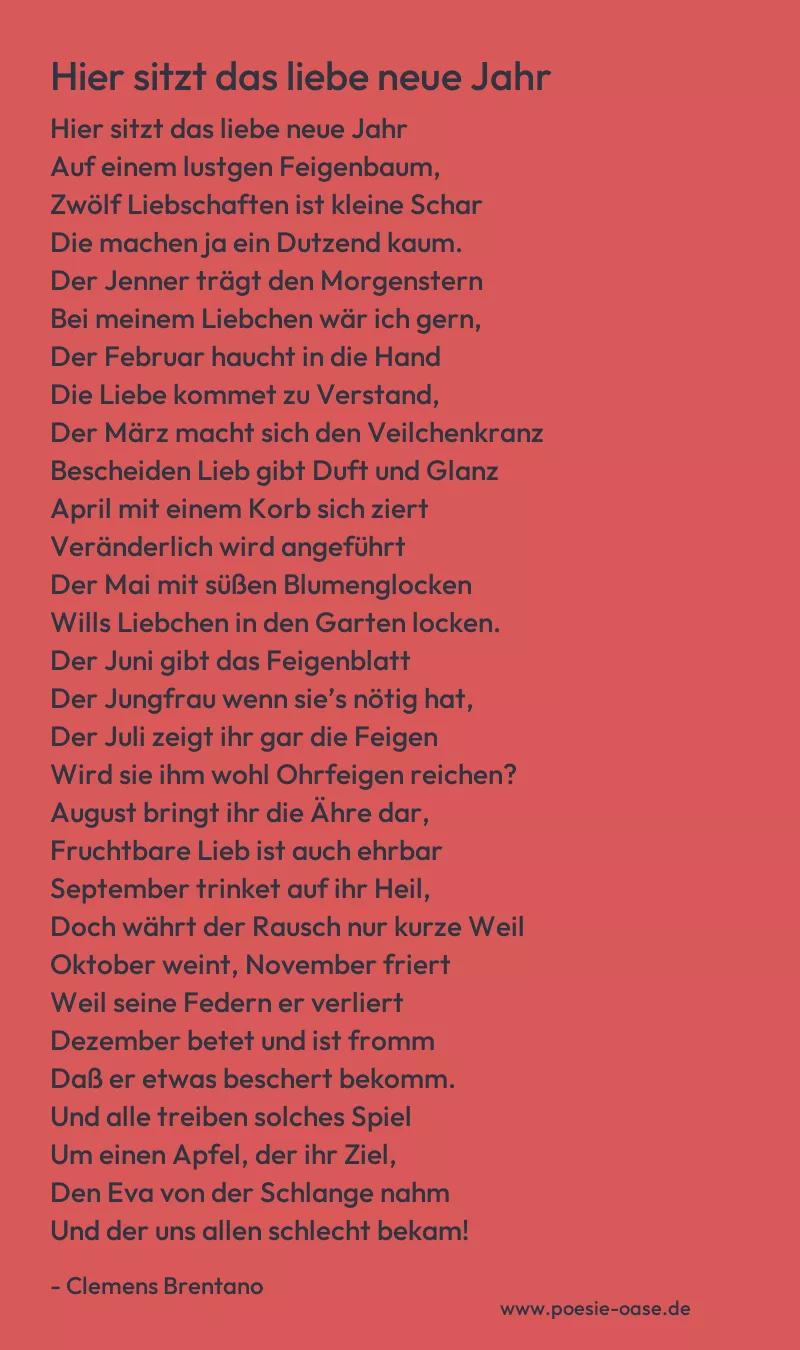
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hier sitzt das liebe neue Jahr“ von Clemens Brentano ist eine verspielte, satirisch-allegorische Darstellung des Jahreslaufs, bei der jedem Monat eine eigene Liebescharakteristik zugeschrieben wird. In lockerer, fast volkstümlicher Sprache verknüpft Brentano die zwölf Monate mit typisierten Formen der Liebe – von unschuldig und verspielt bis zu körperlich und vergänglich. Dabei durchzieht das Gedicht ein leicht spöttischer Ton, der religiöse und mythologische Motive humorvoll aufgreift.
Das Jahr beginnt mit dem Bild eines „lustgen Feigenbaums“, auf dem das neue Jahr sitzt. Die „zwölf Liebschaften“ stehen für die Monate, die in Folge personifiziert werden. Jeder Monat verkörpert eine bestimmte Phase oder Gestalt der Liebe: Der Januar bringt den „Morgenstern“, ein Symbol der Hoffnung oder des Neubeginns, während der Februar die Liebe zur Vernunft bringt. Der März und April zeigen Liebe in ihrer zarten, aber auch launischen Gestalt, passend zur wechselhaften Natur des Frühlings.
Besonders auffällig ist Brentanos sinnliche und ironische Darstellung der Sommermonate: Der Juni mit dem „Feigenblatt“ spielt auf Scham und Verhüllung an, der Juli zeigt gar die Frucht, was in eine erotische Anspielung mündet, die durch die Frage nach einer möglichen „Ohrfeige“ des Mädchens noch zugespitzt wird. Der August steht für fruchtbare, ehrbare Liebe, bevor es im Herbst und Winter zu einem Abklingen der Leidenschaft kommt: Der September trinkt, Oktober und November sind von Melancholie und Kälte gezeichnet, der Dezember schließlich wird religiös und bittet um Gaben.
Den Abschluss bildet ein ironischer Rückgriff auf die biblische Erzählung vom Sündenfall. Der „Apfel“, um den sich alles dreht, verweist auf die Urszene der Verführung und des Begehrens. Die Schlange, Eva und der fatale Biss in die verbotene Frucht rahmen die Jahresreise in eine größere theologische Dimension ein – allerdings mit einem augenzwinkernden Unterton. So verbindet Brentano in diesem Gedicht Naturbeobachtung, Liebesphilosophie und Religionskritik zu einem poetischen Kalenderbild voller Humor und Hintersinn.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.