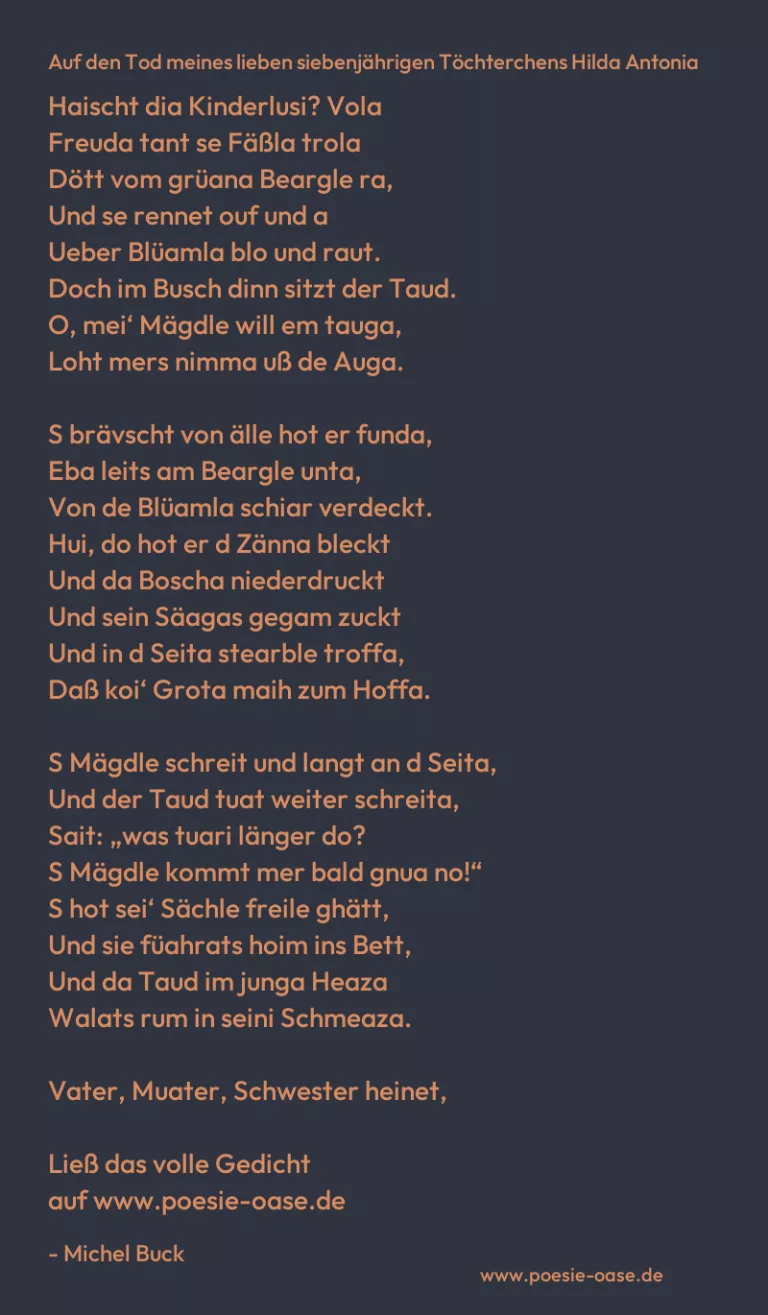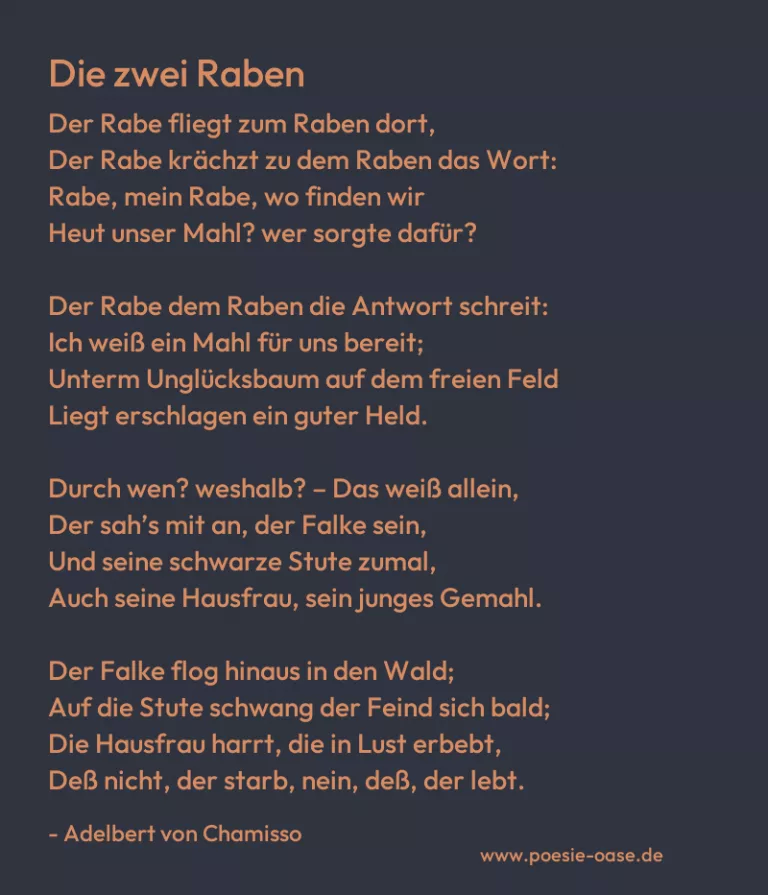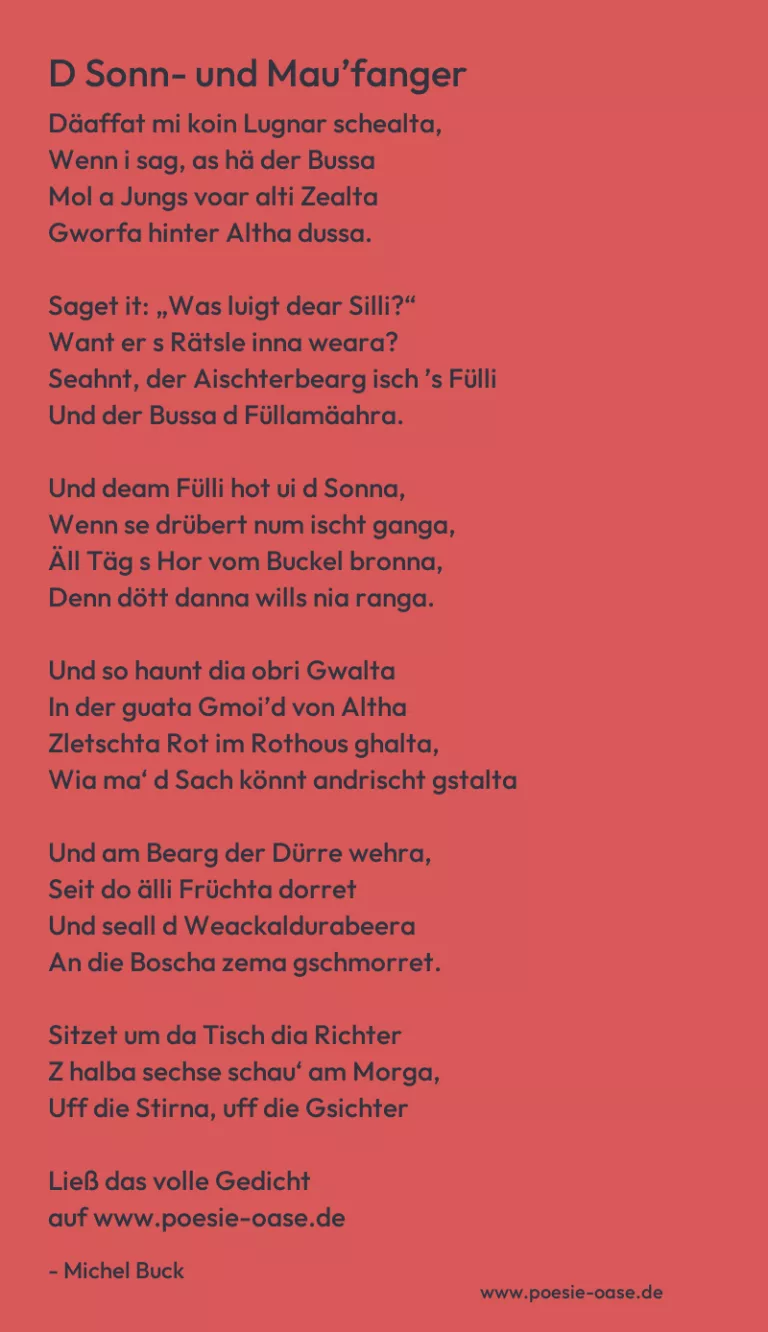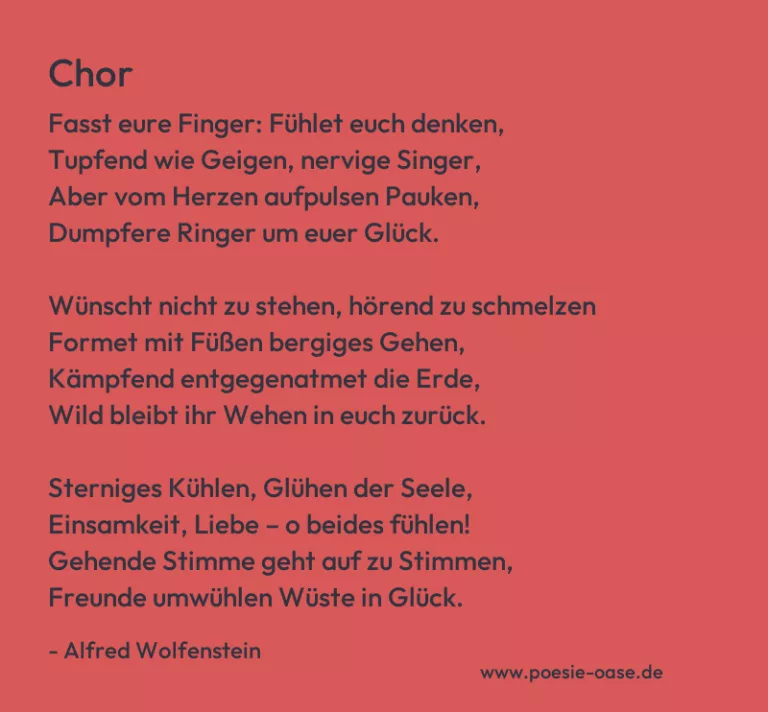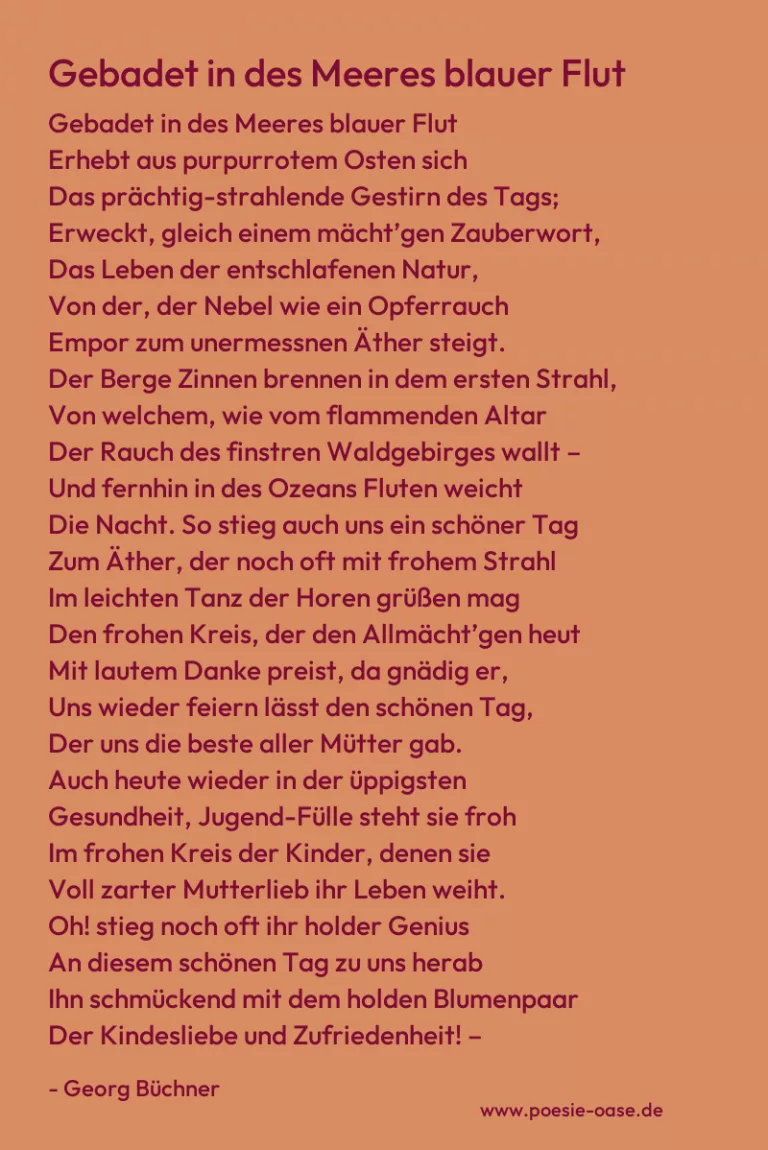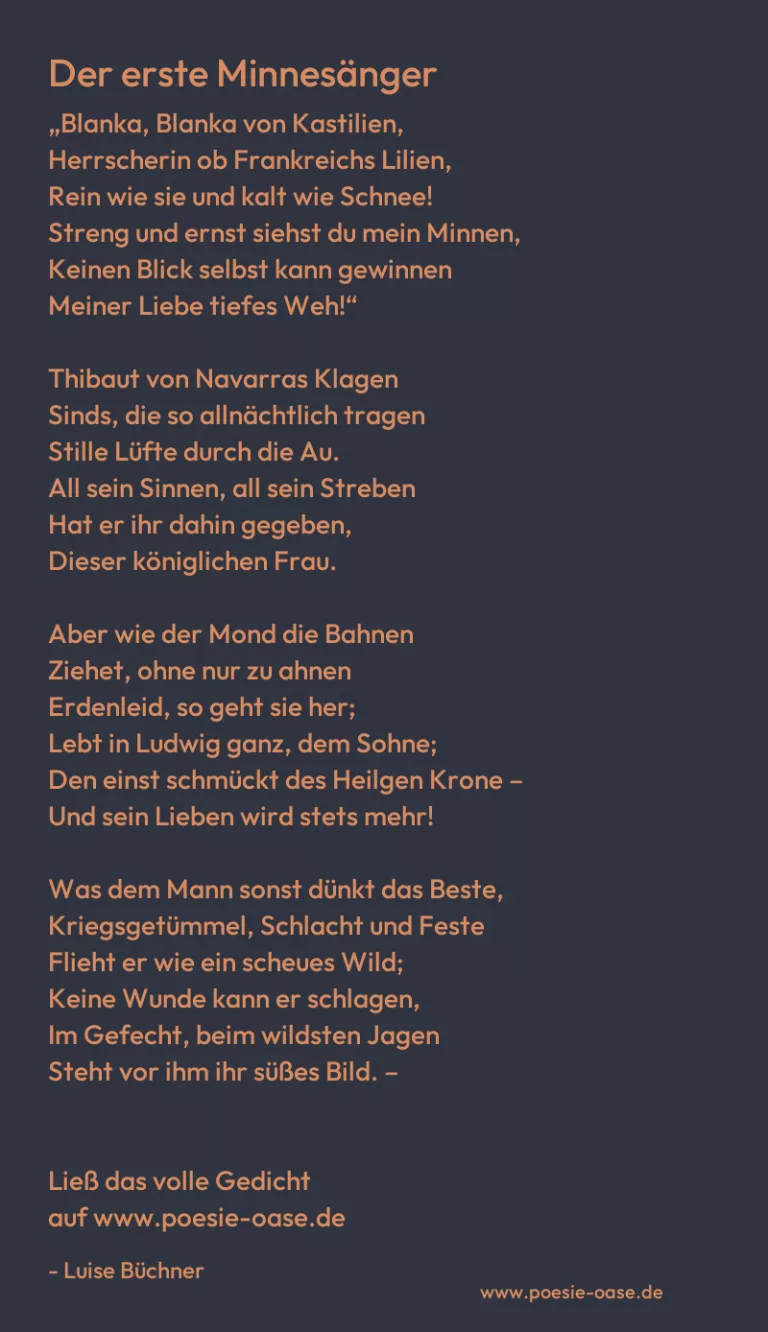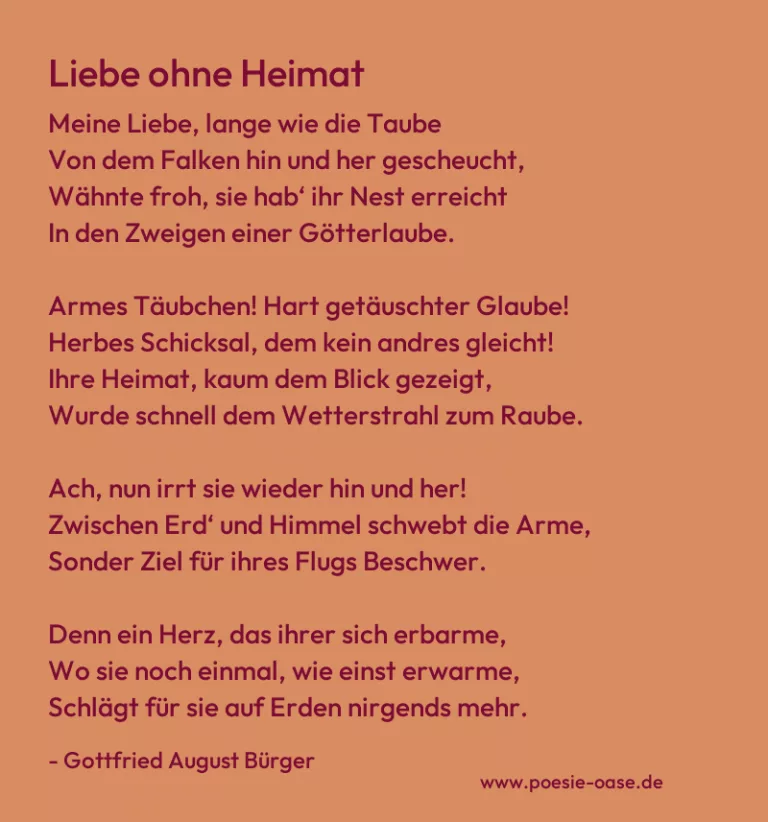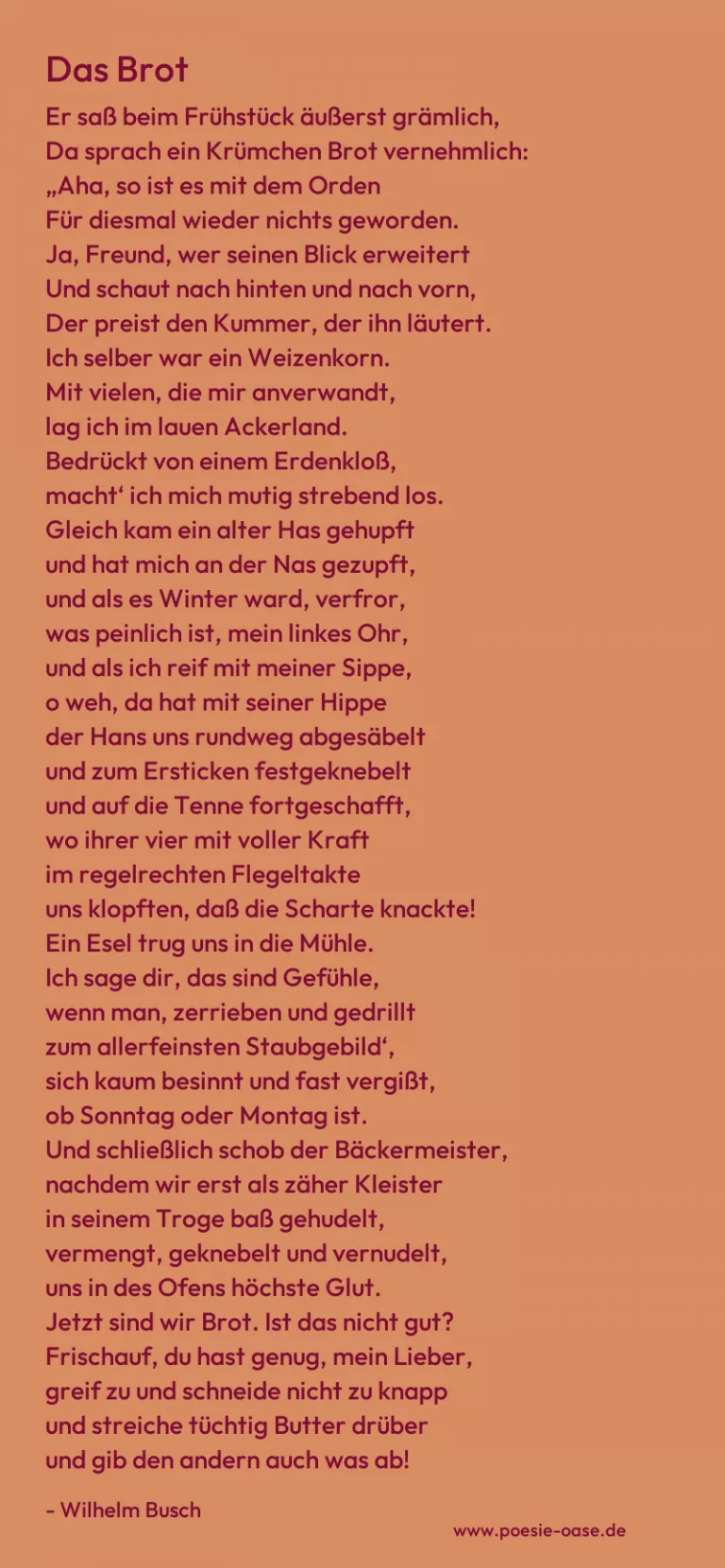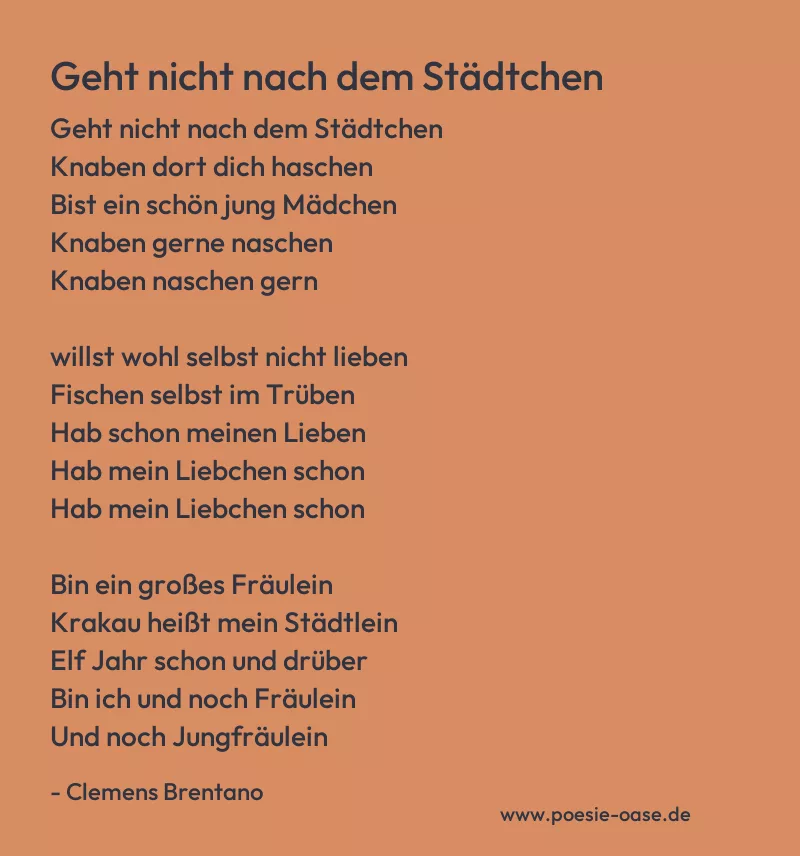Geht nicht nach dem Städtchen
Geht nicht nach dem Städtchen
Knaben dort dich haschen
Bist ein schön jung Mädchen
Knaben gerne naschen
Knaben naschen gern
willst wohl selbst nicht lieben
Fischen selbst im Trüben
Hab schon meinen Lieben
Hab mein Liebchen schon
Hab mein Liebchen schon
Bin ein großes Fräulein
Krakau heißt mein Städtlein
Elf Jahr schon und drüber
Bin ich und noch Fräulein
Und noch Jungfräulein
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
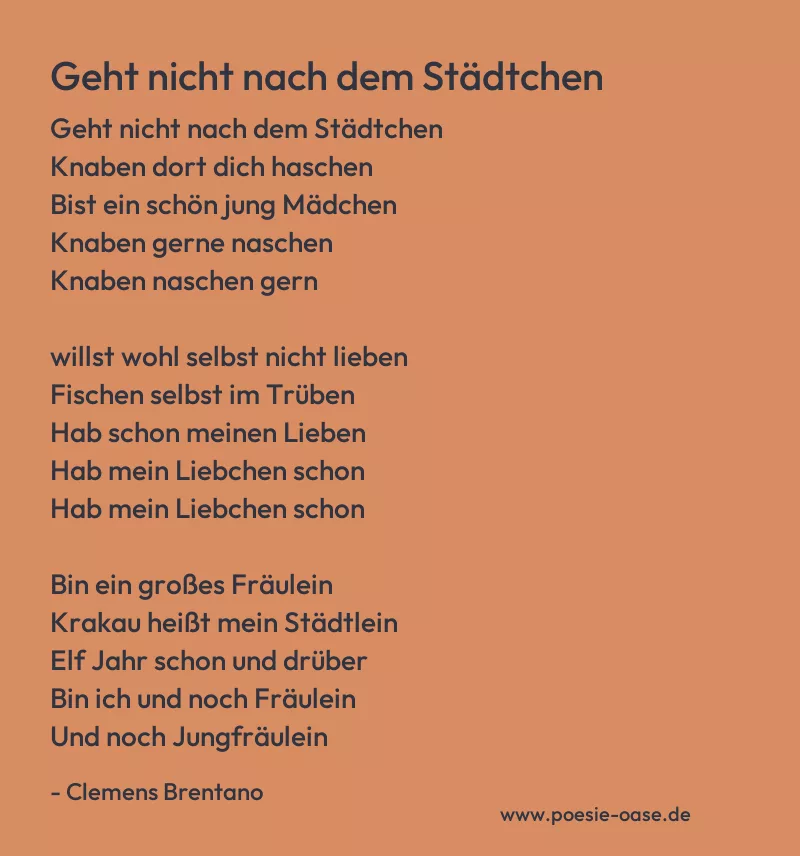
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Geht nicht nach dem Städtchen“ von Clemens Brentano ist ein kurzes, spielerisches Volkslied in Dialogform, das mit augenzwinkerndem Ton Themen wie Liebe, Verführung und weibliche Selbstbestimmung verhandelt. In einfachen, volksliedhaften Versen wird eine Warnung ausgesprochen, die sich schnell als kokettes Spiel entpuppt: Ein junges Mädchen wird davor gewarnt, in die Stadt zu gehen, wo „Knaben gerne naschen“ – ein deutliches Bild für das erotische Interesse junger Männer.
Die Sprecherin nimmt diese Warnung zwar zur Kenntnis, wehrt sich jedoch mit Stolz und Selbstbewusstsein. Sie erklärt, dass sie bereits verliebt sei – „Hab mein Liebchen schon“ –, und gleichzeitig lässt sie durchblicken, dass auch sie weiß, wie man spielt: „Fischen selbst im Trüben“. Damit stellt sie sich nicht als naiv oder schutzbedürftig dar, sondern als jemand, der ihre eigene Rolle im Spiel der Liebe kennt und kontrolliert.
In der letzten Strophe unterstreicht sie ihre Eigenständigkeit nochmals durch die Selbstaussage „Bin ein großes Fräulein“ und nennt stolz ihr Herkunftsstädtchen „Krakau“. Die Aussage, sie sei „elf Jahr schon und drüber“, klingt zunächst kindlich-naiv, ist aber im Kontext der Selbstbezeichnung als „Fräulein“ doppeldeutig: Sie spielt mit der Vorstellung jugendlicher Unschuld und der gesellschaftlichen Zuschreibung von Reife und Jungfräulichkeit.
Brentano nutzt in diesem Gedicht typische Merkmale der romantischen Volksliedtradition: klare Reime, einfache Sprache, Wiederholungen und eine dialogische Struktur. Doch hinter der scheinbaren Harmlosigkeit steckt ein subtiles Spiel mit Rollenbildern, Gender und gesellschaftlicher Erwartung. Die weibliche Stimme ist selbstbewusst, witzig und ironisch – und entzieht sich jeder einfachen Deutung als bloßes „Opfer“ männlicher Begierde.
„Geht nicht nach dem Städtchen“ ist somit mehr als ein heiteres Volkslied: Es ist ein kleines, ironisches Rollenstück, das mit Leichtigkeit und Charme traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit und Liebe hinterfragt – ganz im Sinne der Romantik, in der Ernst und Spiel, Naivität und Reflexion oft eng beieinander liegen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.