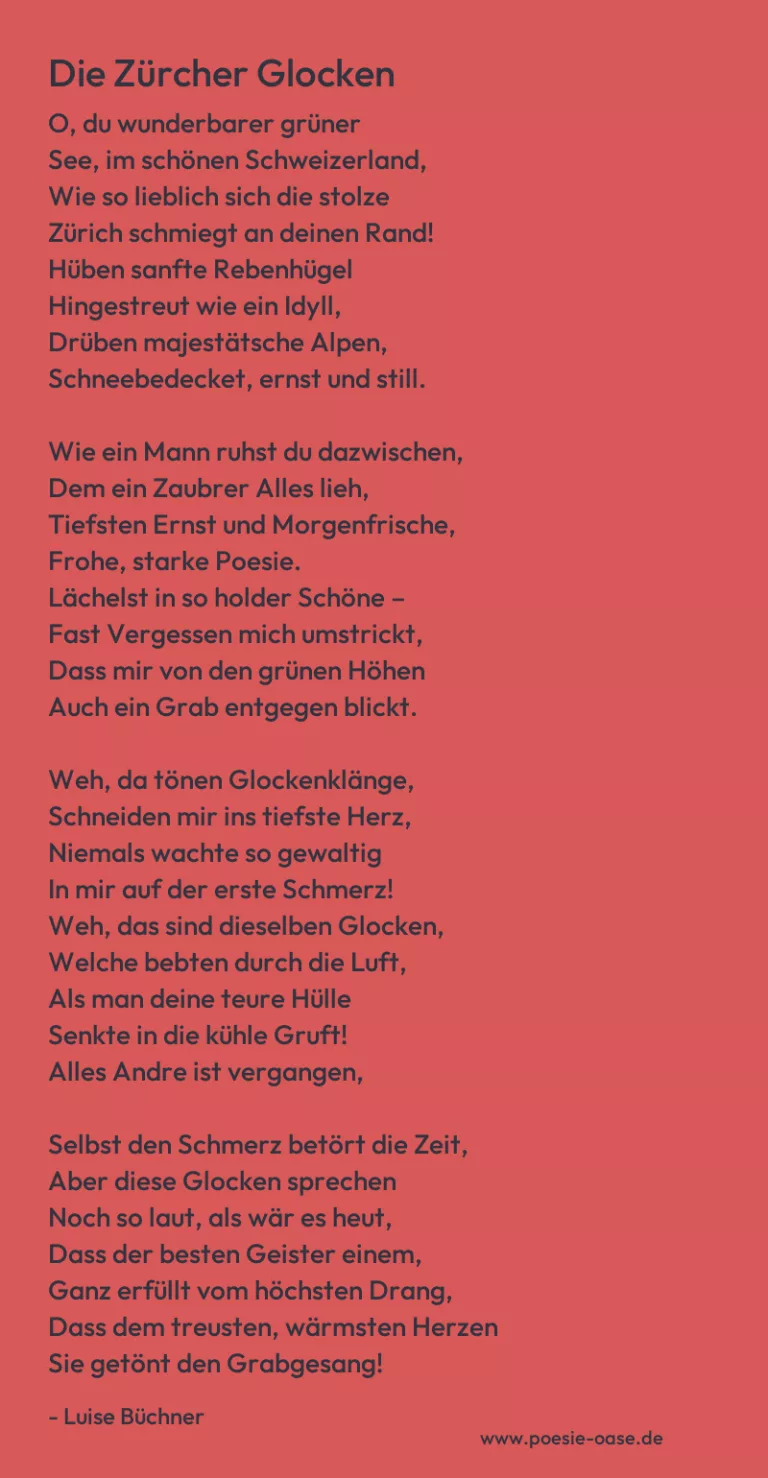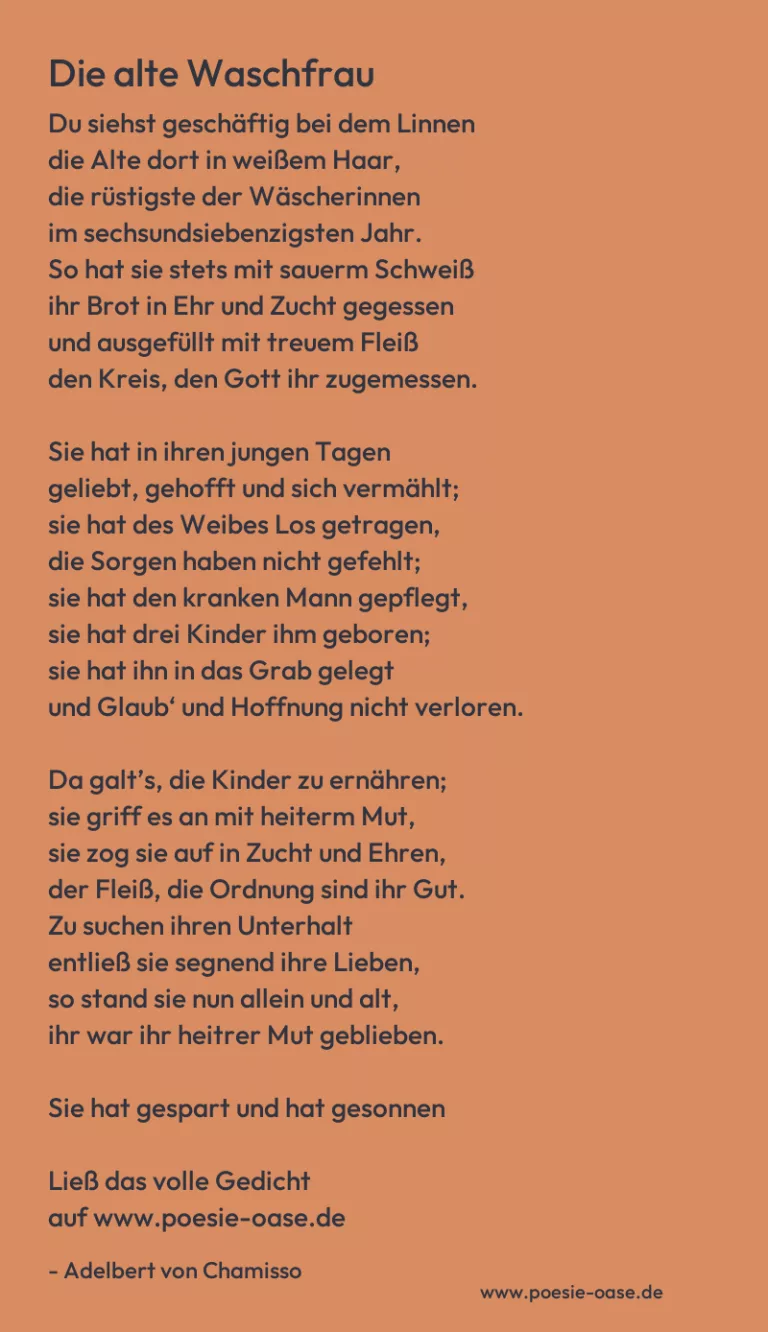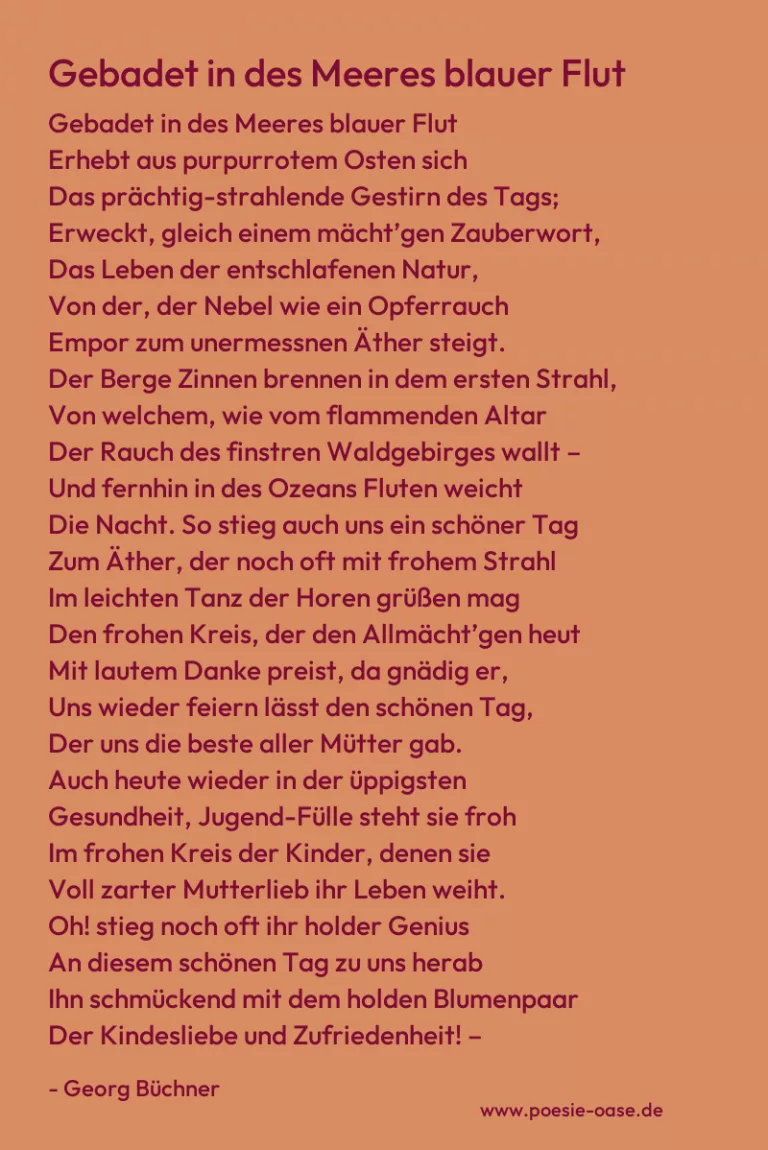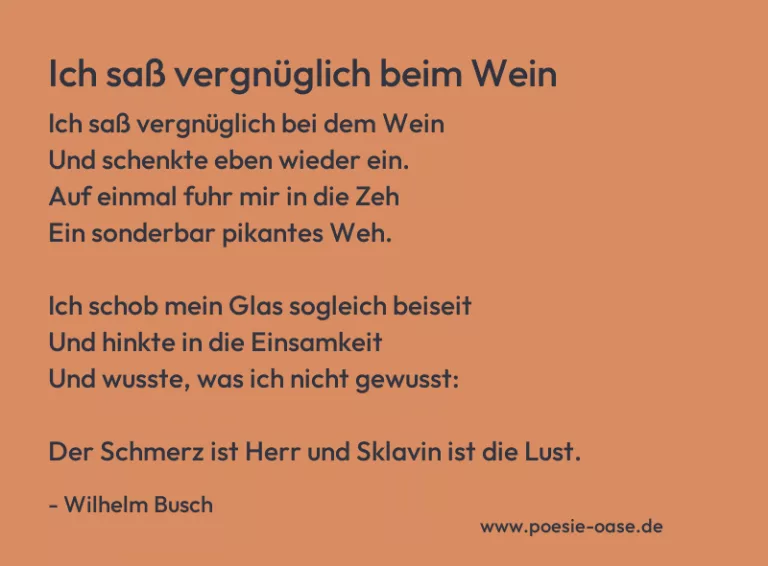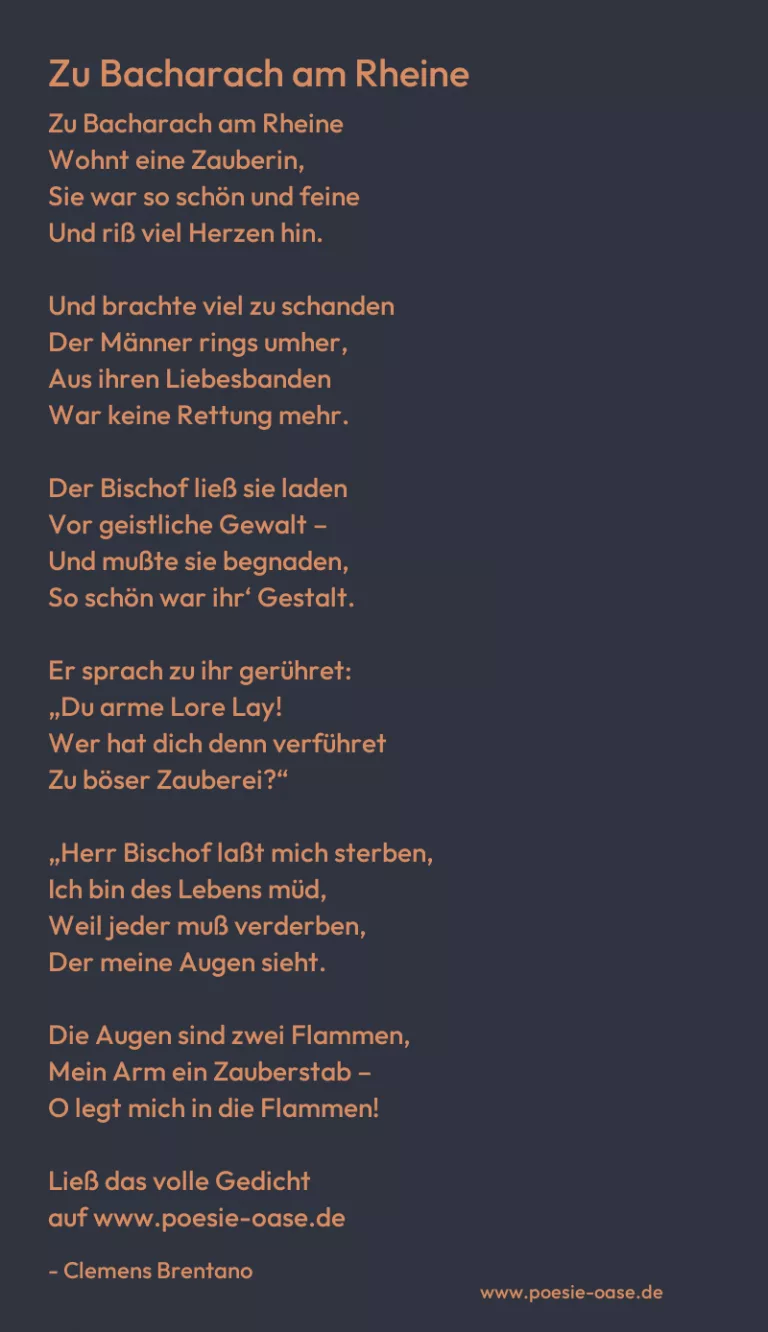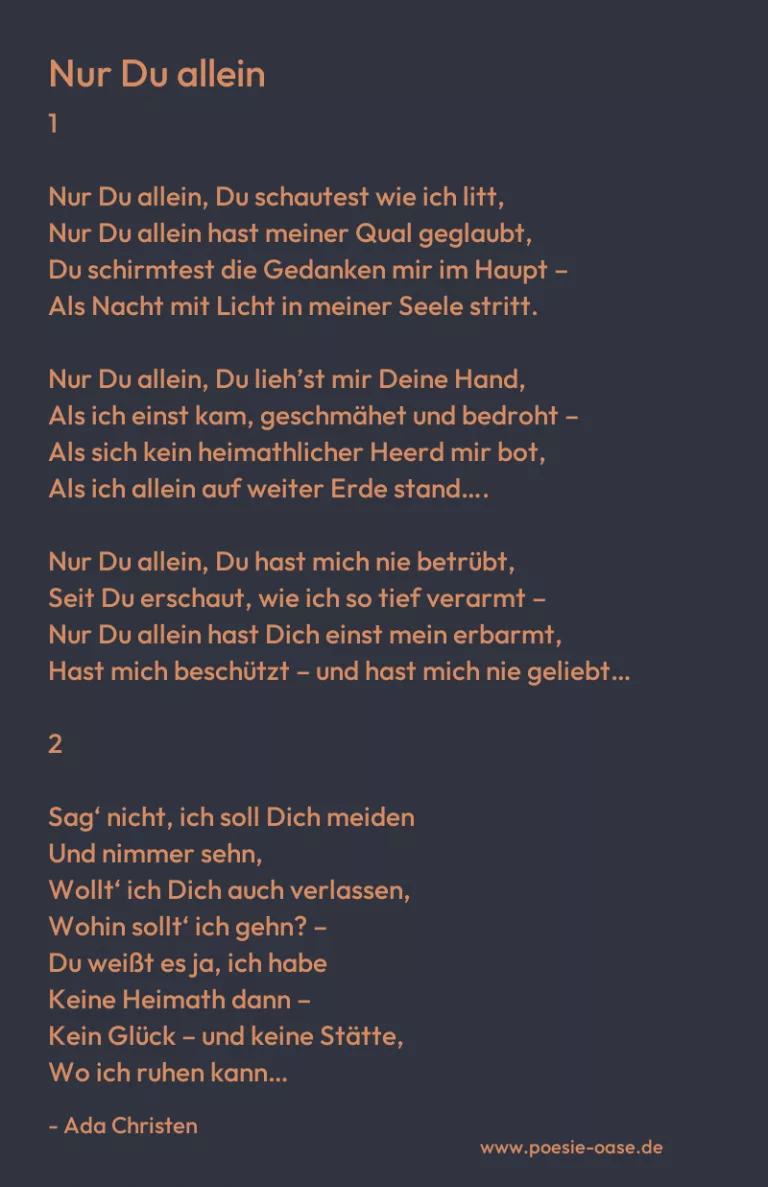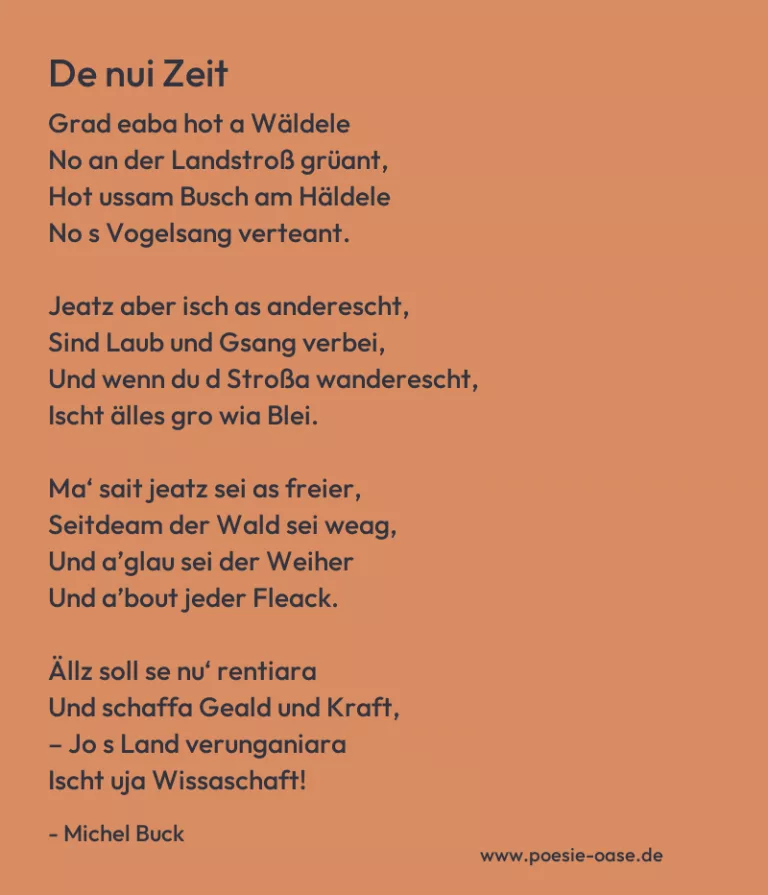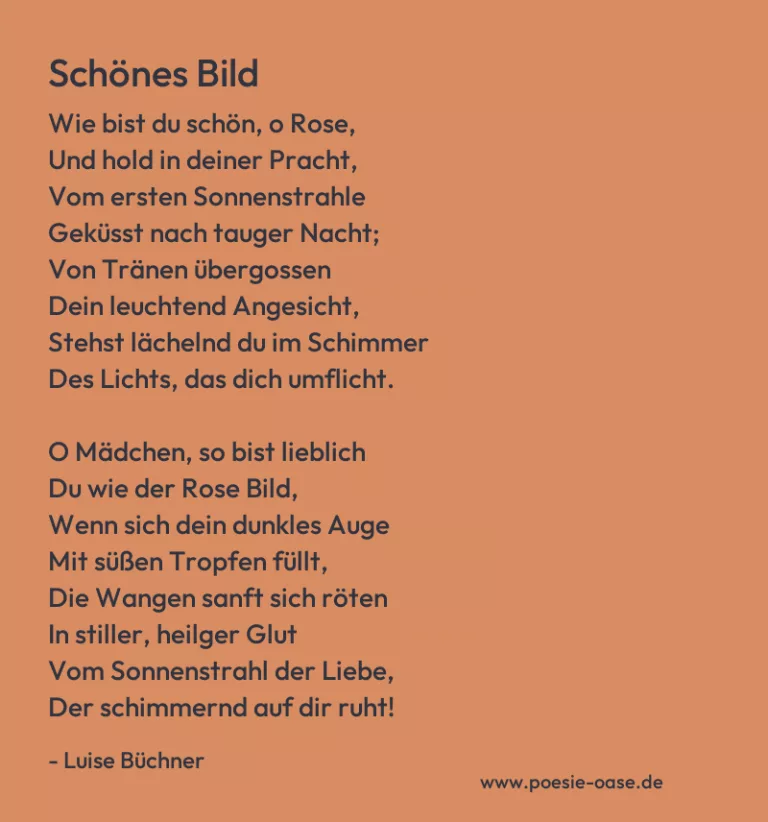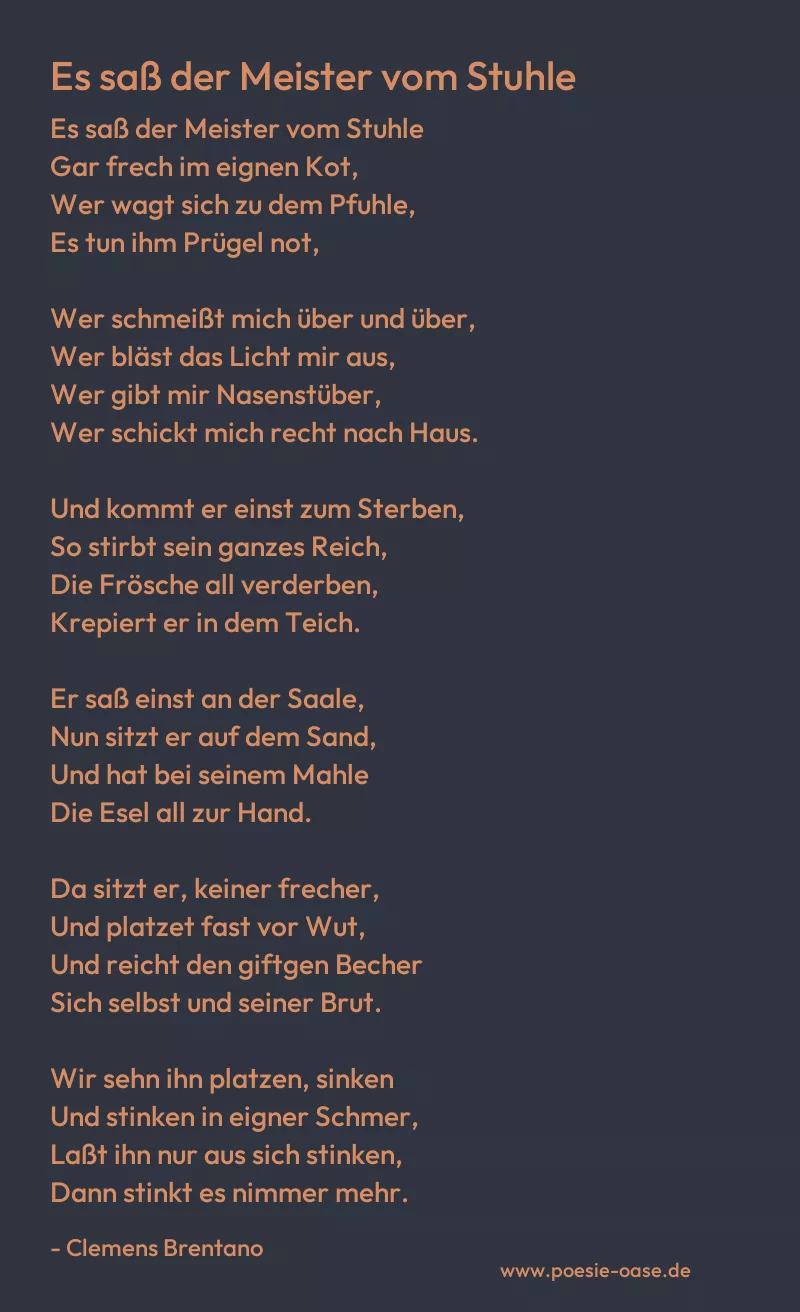Es saß der Meister vom Stuhle
Es saß der Meister vom Stuhle
Gar frech im eignen Kot,
Wer wagt sich zu dem Pfuhle,
Es tun ihm Prügel not,
Wer schmeißt mich über und über,
Wer bläst das Licht mir aus,
Wer gibt mir Nasenstüber,
Wer schickt mich recht nach Haus.
Und kommt er einst zum Sterben,
So stirbt sein ganzes Reich,
Die Frösche all verderben,
Krepiert er in dem Teich.
Er saß einst an der Saale,
Nun sitzt er auf dem Sand,
Und hat bei seinem Mahle
Die Esel all zur Hand.
Da sitzt er, keiner frecher,
Und platzet fast vor Wut,
Und reicht den giftgen Becher
Sich selbst und seiner Brut.
Wir sehn ihn platzen, sinken
Und stinken in eigner Schmer,
Laßt ihn nur aus sich stinken,
Dann stinkt es nimmer mehr.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
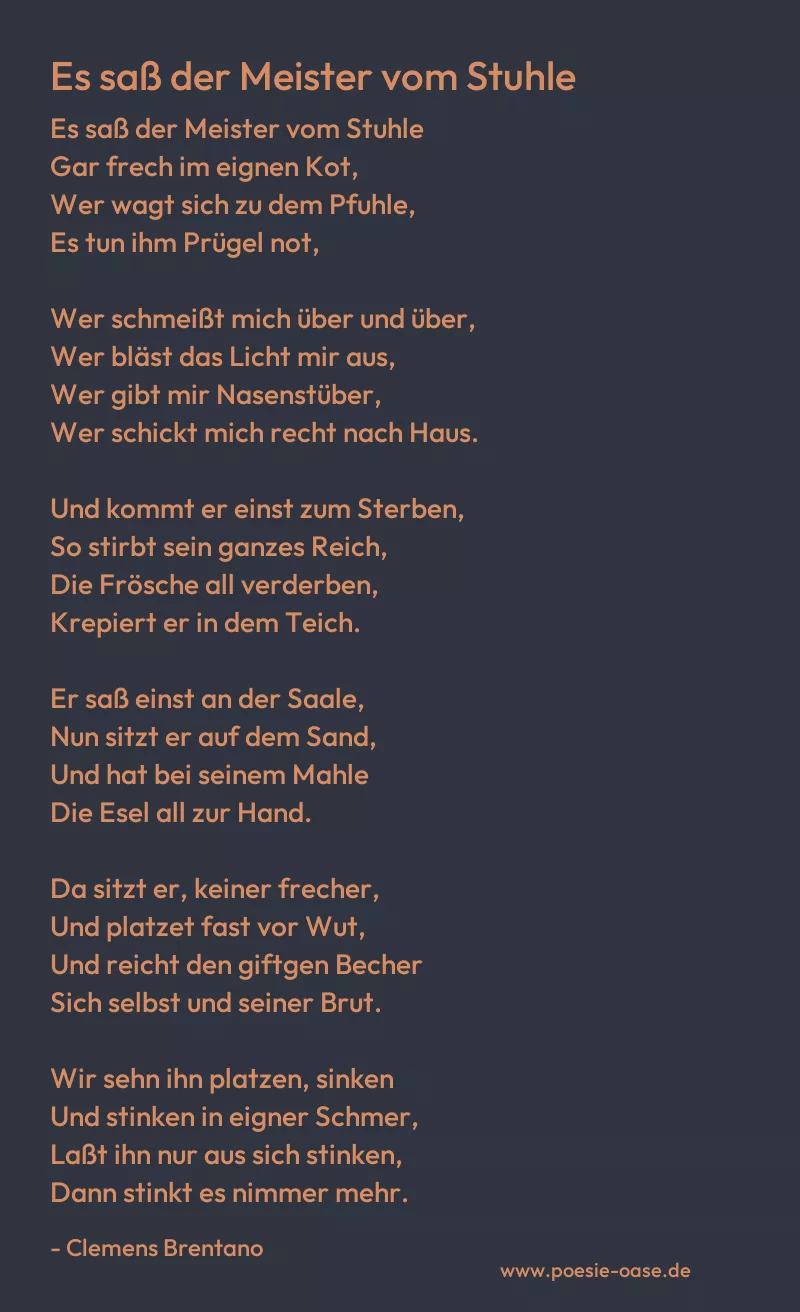
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Es saß der Meister vom Stuhle“ von Clemens Brentano ist eine scharfsinnige, sarkastische Gesellschafts- oder Herrschaftssatire, in der eine machtvolle Figur – vermutlich ein Anführer, König oder Richter – in grotesker Weise demontiert wird. Brentano verwendet dabei drastische Bilder, um die moralische Verkommenheit und Lächerlichkeit des „Meisters“ bloßzustellen.
Schon die erste Strophe präsentiert die Hauptfigur „gar frech im eignen Kot“ – ein entwürdigendes Bild, das auf Selbstgefälligkeit, Ignoranz und Verfall deutet. Der „Pfuhl“ symbolisiert die moralische oder geistige Tiefe, in der sich der „Meister“ befindet, während er zugleich alle, die ihm nahekommen, mit Strafe bedroht. Diese Doppelmoral wird in den folgenden Versen weiter enthüllt: Er klagt über Angriffe („Nasenstüber“, „Licht ausblasen“), doch es wird angedeutet, dass er selbst dafür verantwortlich ist.
Brentano nutzt Tierbilder wie Frösche und Esel, um das Umfeld des „Meisters“ zu charakterisieren – Mitläufer und Nutznießer, die dem Verfall beiwohnen. Besonders deutlich wird die Vergänglichkeit und Lächerlichkeit der Macht in der dritten Strophe: Der Tod des Herrschers bedeutet auch das Ende seines gesamten Reichs, doch dieses ist ohnehin schon verkommen – ein Teich voller Frösche, keine edle Nation.
Die Sprache ist beißend und abgründig. Mit Ausdrücken wie „giftger Becher“, „platzen“, „stinken“ zeichnet Brentano ein Bild völliger Selbstzerstörung. Der „Meister“ wird nicht gestürzt, sondern vernichtet sich selbst durch seine Arroganz und Wut. Am Ende scheint sogar eine Art Erlösung in der Katastrophe zu liegen: Wenn er sich „aus sich stinkt“, wird es „nimmer mehr“ stinken – also ist sein Ende zugleich Reinigung.
Brentano liefert mit diesem Gedicht ein düsteres, satirisches Bild von Machtmissbrauch, Selbstherrlichkeit und moralischem Verfall. Die groteske Überzeichnung macht den Text ebenso komisch wie bitter, und sein gesellschaftskritischer Gehalt bleibt überzeitlich aktuell.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.