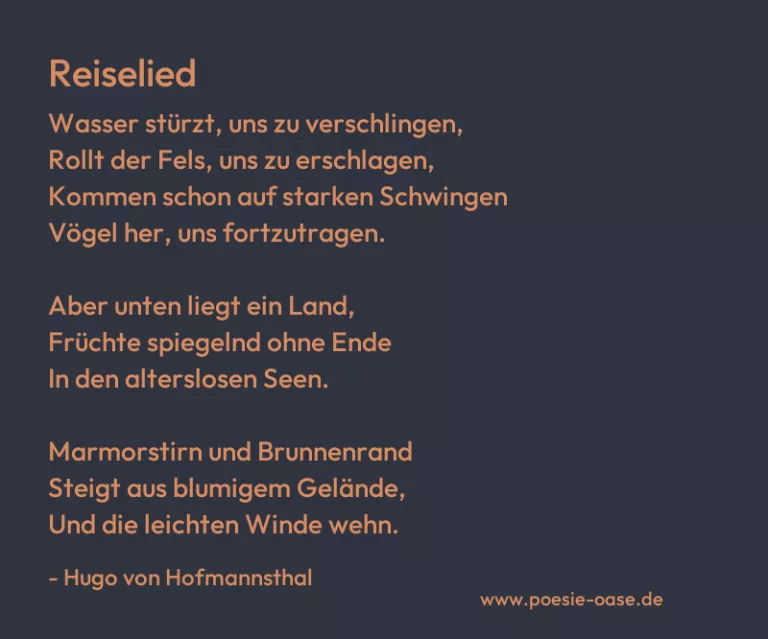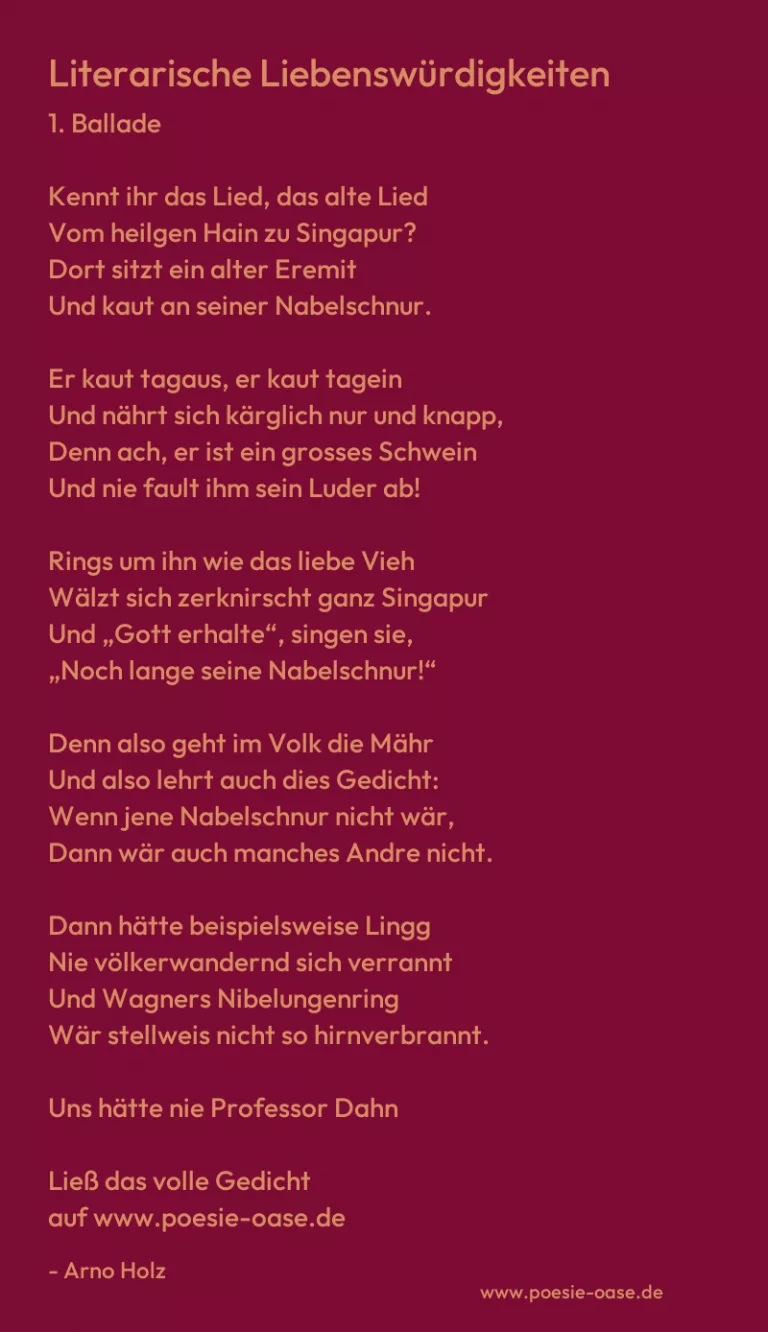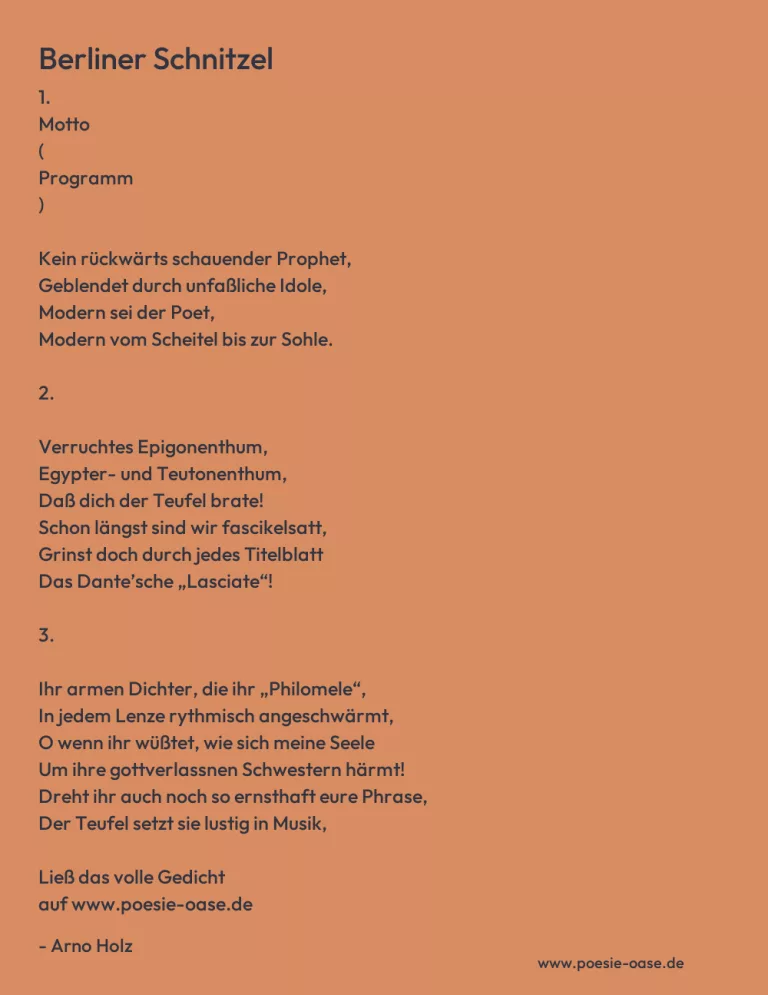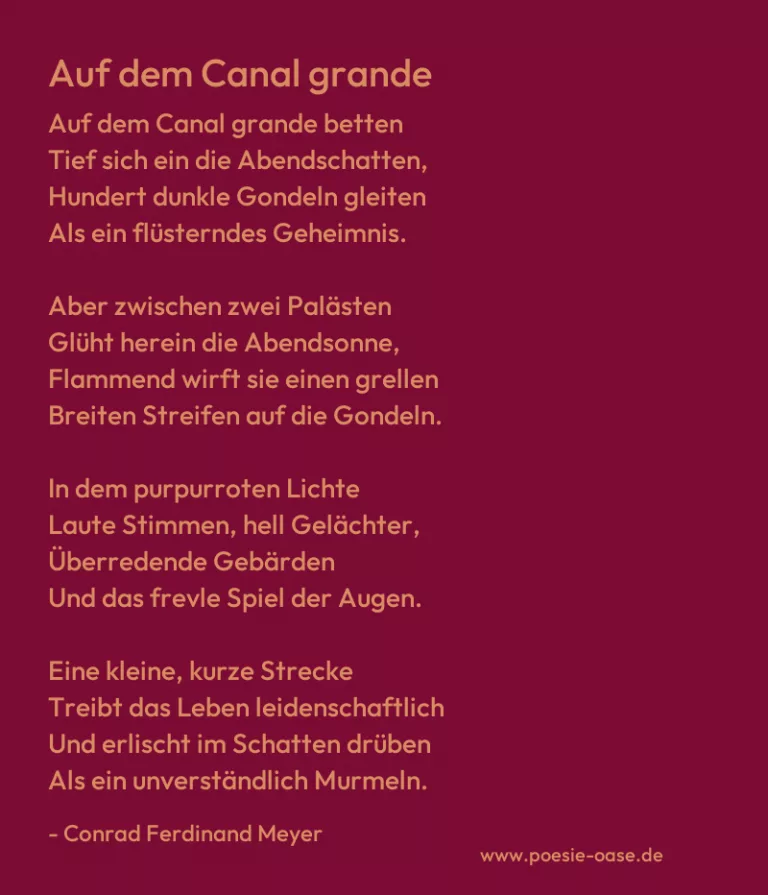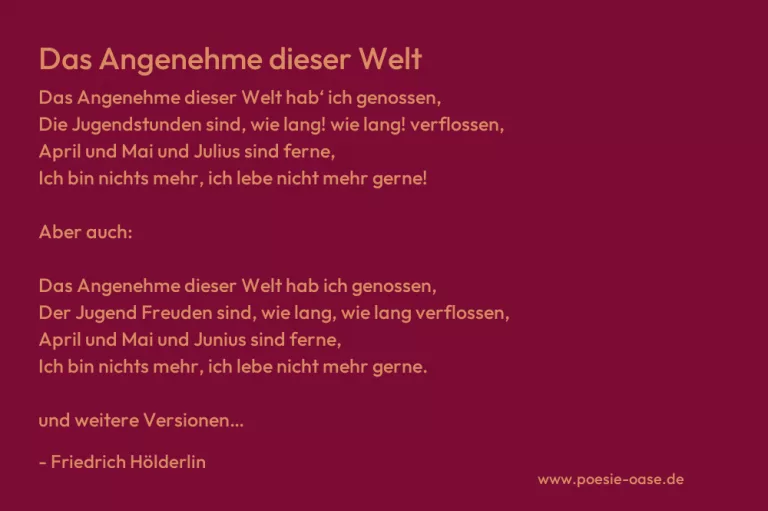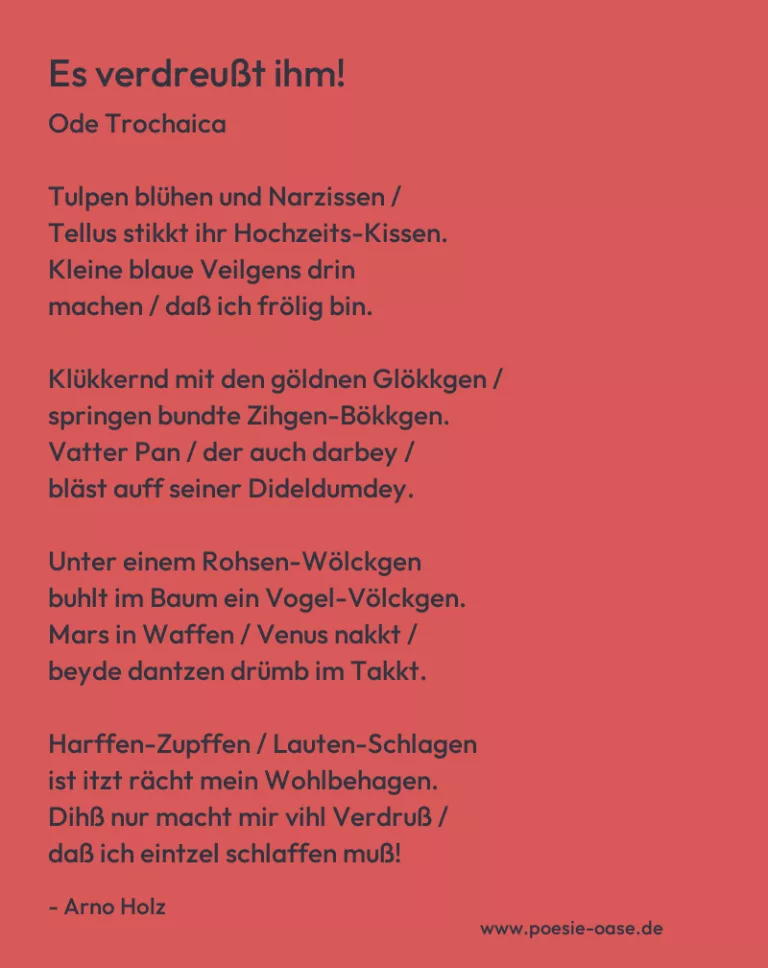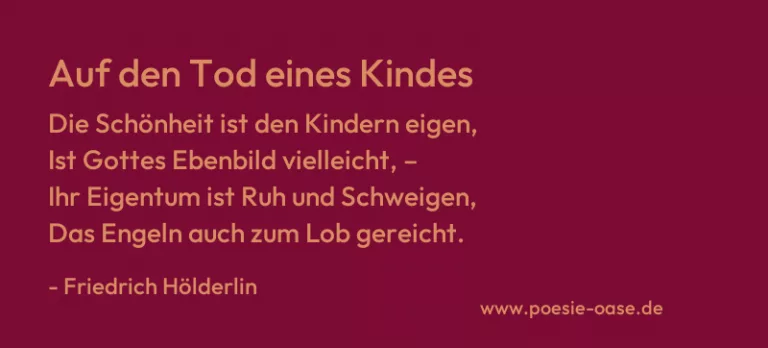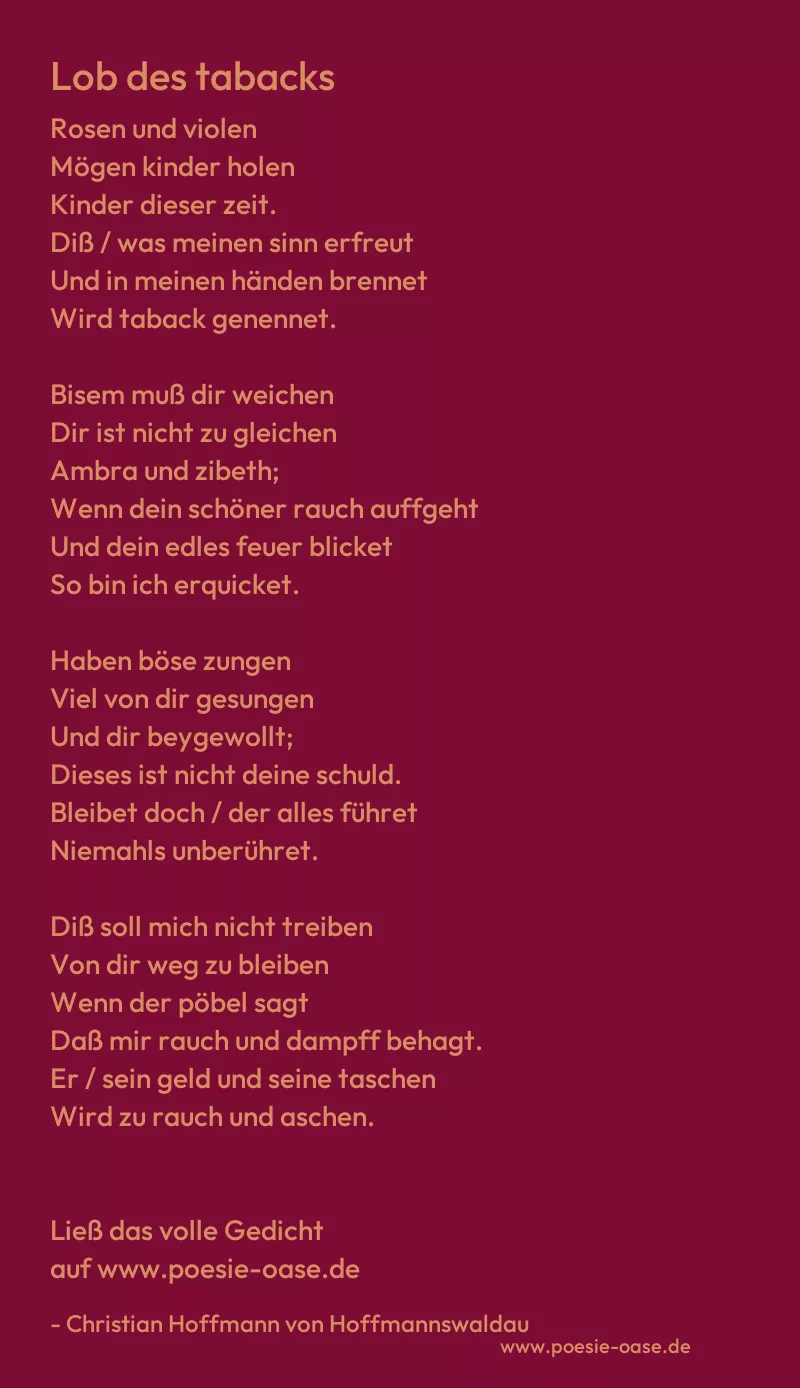Lob des tabacks
Rosen und violen
Mögen kinder holen
Kinder dieser zeit.
Diß / was meinen sinn erfreut
Und in meinen händen brennet
Wird taback genennet.
Bisem muß dir weichen
Dir ist nicht zu gleichen
Ambra und zibeth;
Wenn dein schöner rauch auffgeht
Und dein edles feuer blicket
So bin ich erquicket.
Haben böse zungen
Viel von dir gesungen
Und dir beygewollt;
Dieses ist nicht deine schuld.
Bleibet doch / der alles führet
Niemahls unberühret.
Diß soll mich nicht treiben
Von dir weg zu bleiben
Wenn der pöbel sagt
Daß mir rauch und dampff behagt.
Er / sein geld und seine taschen
Wird zu rauch und aschen.
Nun so will ich trincken
Weil die sternen blincken
Und das grosse licht
Durch die düstren wolcken bricht;
Ja / des Phöbus güldner wagen
Soll mein rauchwerck tragen.
Venus wird nicht zürnen
Wenn auf ihre stirnen
Sich tabacks-rauch legt.
Ward sie doch auch nicht bewegt
Wenn Vulcan / das ungeheuer
Machte rauch und feuer.
Und vor andern allen
Wird der rauch gefallen
Dir / o krieges-gott.
Drum hat es auch keine noth
Wenn die sachen / so wir üben
Nur die götter lieben.
Nun / ihr lieben brüder
Thut / was wein und lieder
Itzt hat angestimmt.
Schaut! wie meine pfeiffe glimmt
Da doch meiner liebsten sinnen
Nicht so brennen können.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
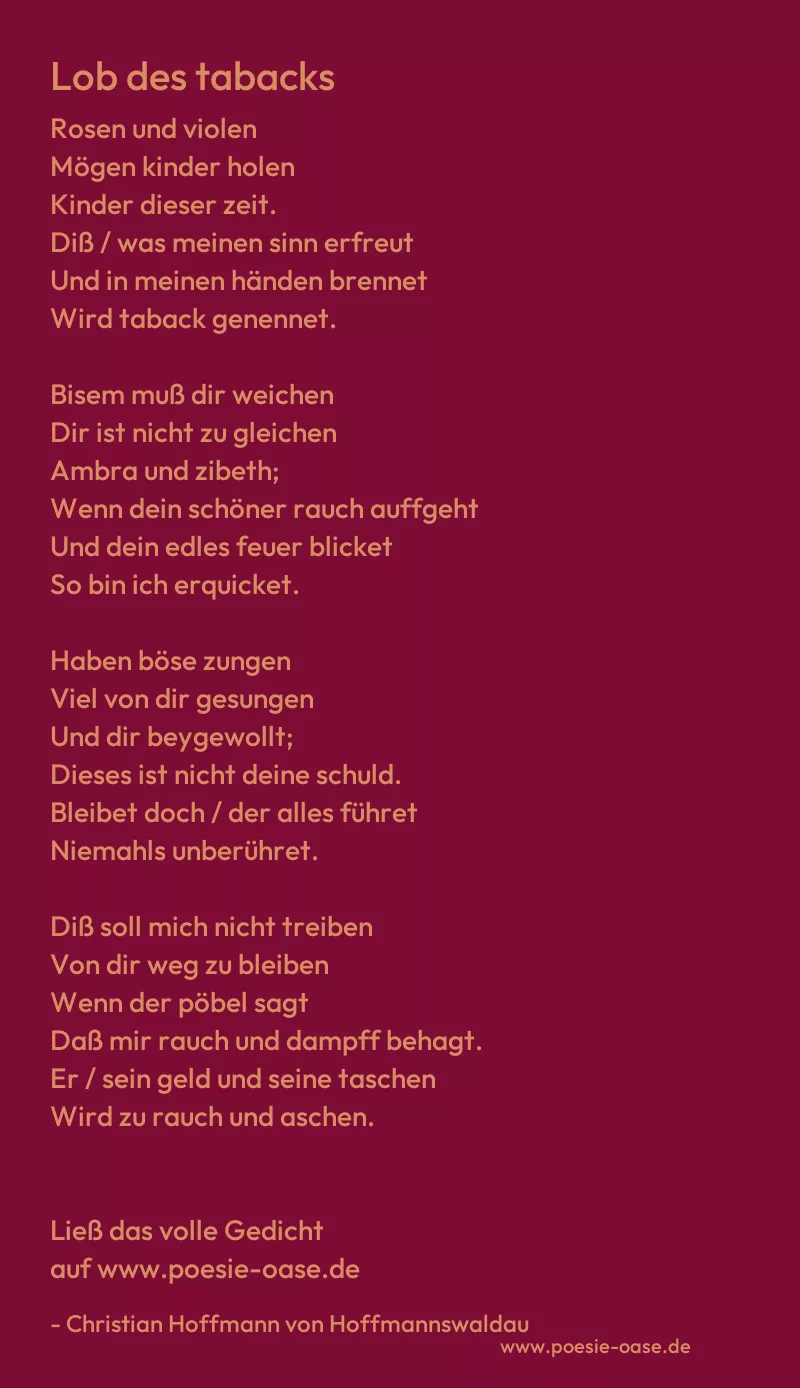
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Lob des Tabacks“ von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau ist ein heiteres, augenzwinkerndes Lobgedicht auf das Rauchen, genauer: auf den Tabakgenuss in Pfeifenform. In spielerischer Abgrenzung zu klassischen Themen wie Rosen, Veilchen oder der Liebe feiert das lyrische Ich hier das Rauchen als Quelle sinnlicher Freude, innerer Erquickung und sogar spiritueller Erhebung.
Bereits in der ersten Strophe wird klar, dass sich der Sprecher bewusst vom konventionellen Geschmack absetzt. Rosen und Veilchen sind für Kinder – der reife Genießer widmet sich dem Tabak, der „in meinen Händen brennet“ und den „Sinn erfreut“. Diese bewusste Abgrenzung gegenüber kindlicher oder gesellschaftlich akzeptierter Ästhetik ist typisch für barocke Dichtung, die gerne mit Gegensätzen spielt. Der Tabakrauch wird als edel und belebend dargestellt, als etwas, das selbst kostbare Düfte wie Ambra oder Zibet übertrifft.
Zugleich verteidigt das lyrische Ich den Tabak gegen seine Kritiker. „Böse Zungen“ mögen ihn verunglimpfen, doch das sei keine Schuld des Tabaks selbst – vielmehr ist die negative Bewertung Teil einer allgemeinen Heuchelei, gegen die sich der Sprecher mit Selbstironie und Trotz stellt. Diese Haltung spiegelt ein libertäres Lebensgefühl wider, das sich nicht von der Meinung des „Pöbels“ beeindrucken lässt. Die Pointe, dass letztlich alles – Geld, Besitz, selbst die Kritiker – zu „Rauch und Aschen“ wird, enthält eine augenzwinkernde Vanitas-Anspielung.
Im weiteren Verlauf wird das Rauchen sogar in den mythisch-göttlichen Bereich erhoben. Der Rauch soll bis zum Sonnenwagen des „Phöbus“ (Apollon) steigen, Venus wird den Rauch auf ihrer Stirn dulden, und selbst Vulcan, der Gott des Feuers, diente als Vorbild für das „Rauch- und Feuerwerk“. Diese mythologischen Bezüge verleihen dem Tabakrauchen eine fast kultische Dimension: Nicht nur ist es Genuss, sondern auch eine Form der Verbindung mit dem Göttlichen – besonders dem Kriegsgott Mars, der für das kämpferische, maskuline Prinzip steht.
In der letzten Strophe findet das Gedicht in einer geselligen, fast trunkenen Stimmung seinen Abschluss. Der Tabak wird gleichgestellt mit „Wein und Liedern“, den klassischen Zutaten barocker Lebensfreude. Die glimmende Pfeife ist sichtbares Zeichen dieser Lust – selbst stärker als das Begehren nach der Geliebten. Damit setzt Hoffmannswaldau ein ironisches, aber auch selbstbewusstes Zeichen für individuelle Freiheit, Genussfähigkeit und das Recht, gegen den Geschmack der Mehrheit zu leben.
„Lob des Tabacks“ ist somit weit mehr als nur eine Laune – es ist ein geistreiches, kultiviertes Gedicht, das Lebenskunst, Selbstbehauptung und poetische Verspieltheit in barocker Manier vereint.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.