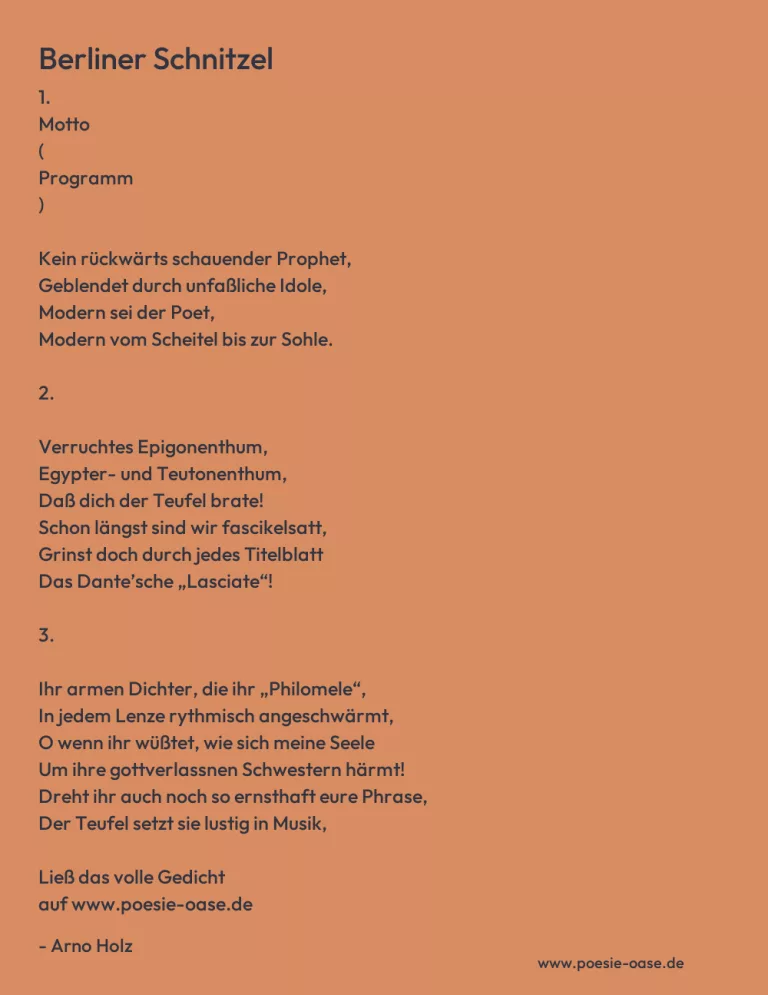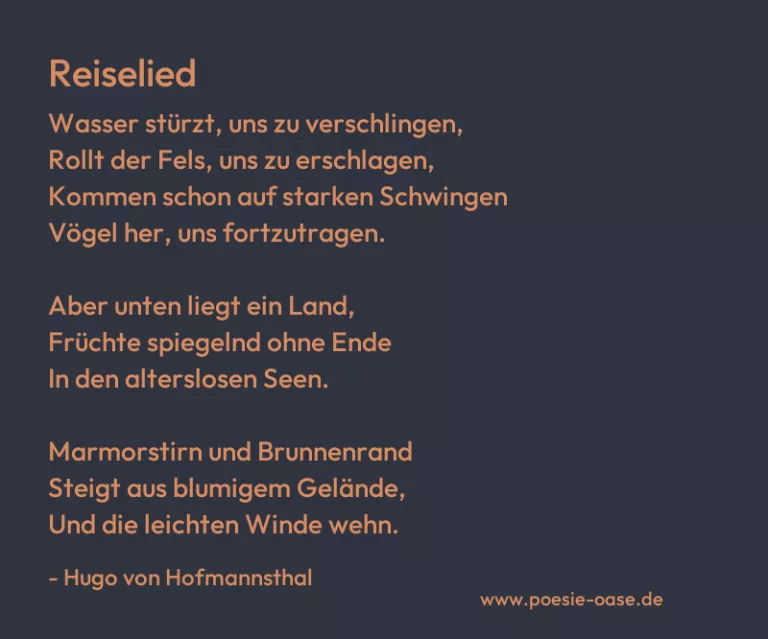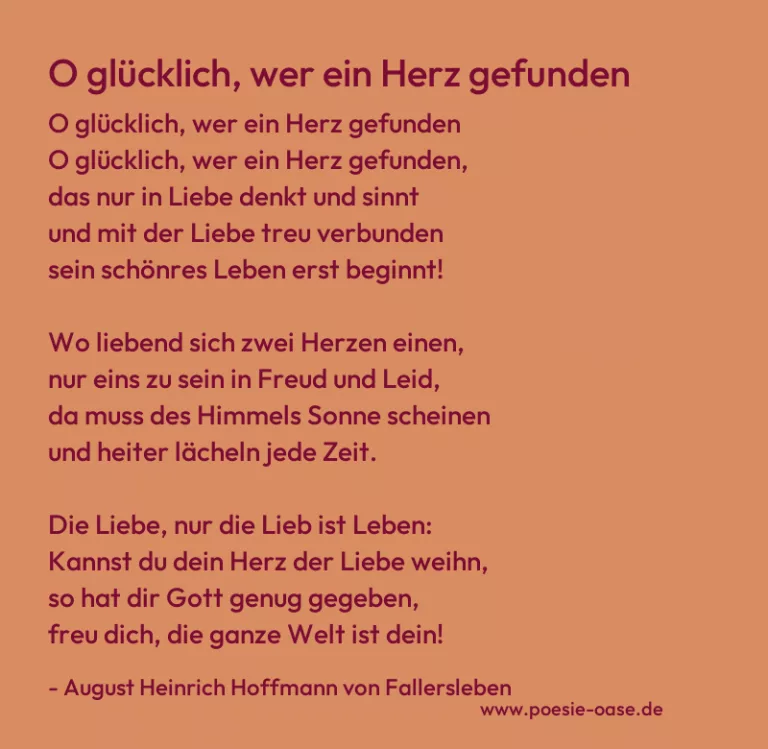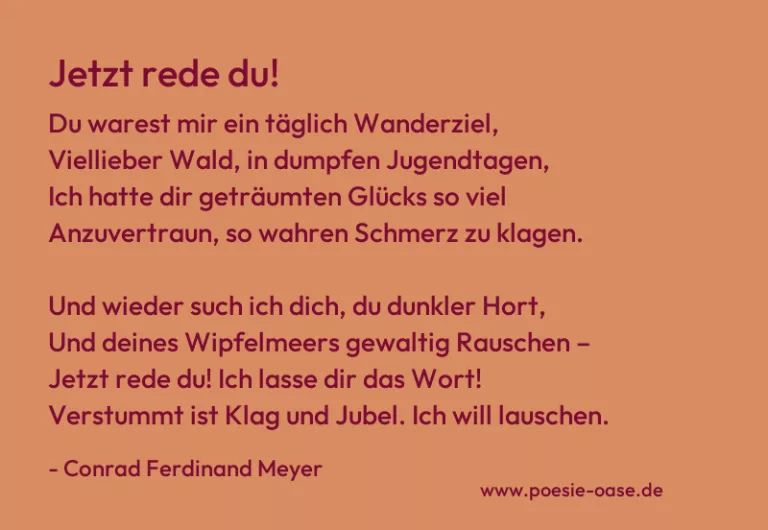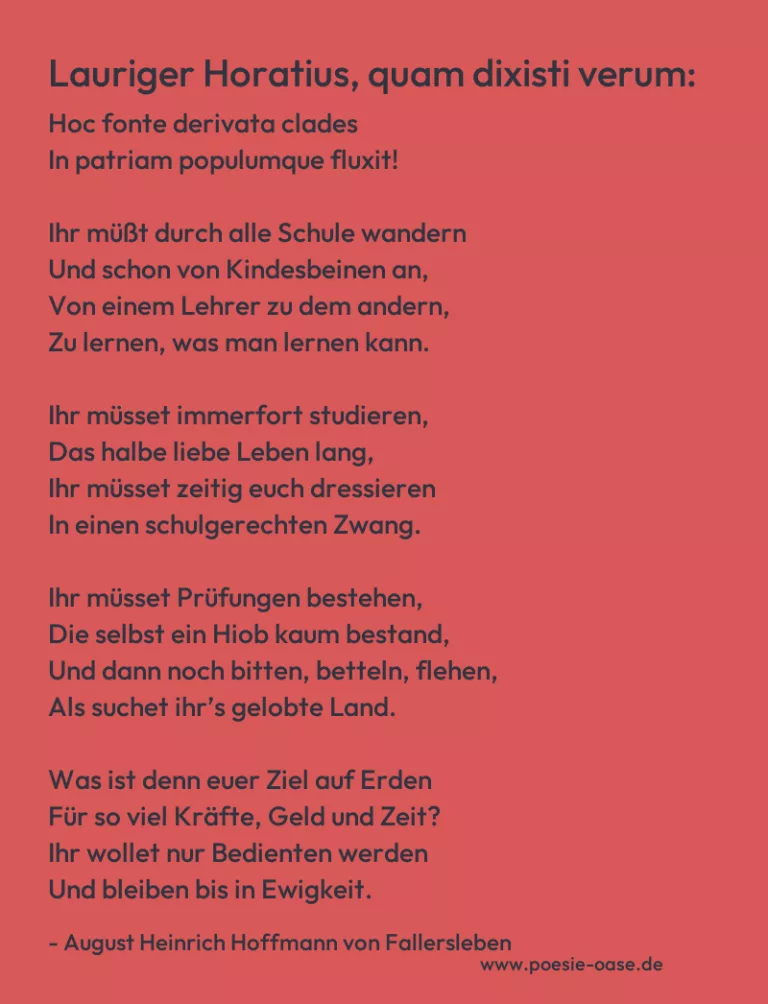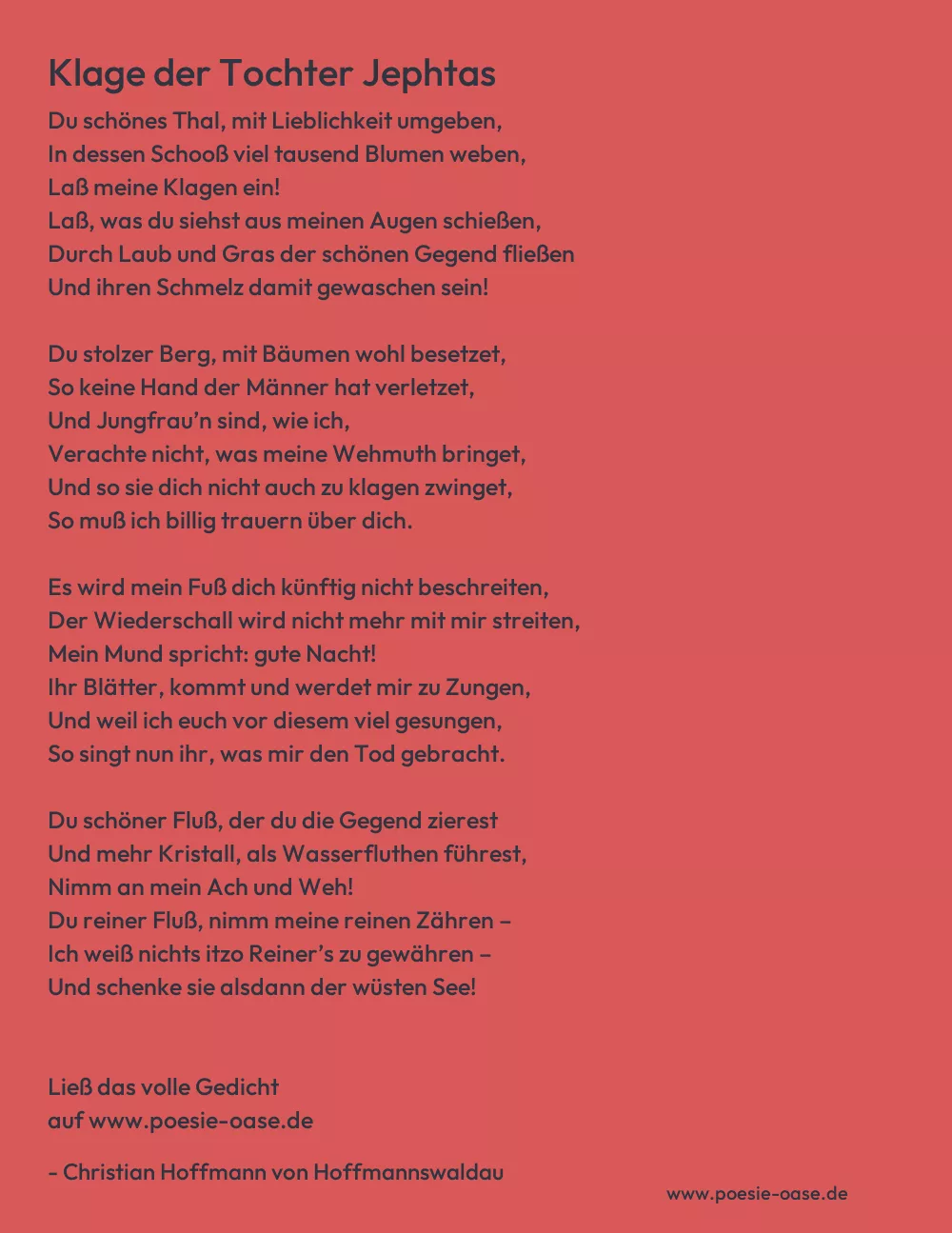Du schönes Thal, mit Lieblichkeit umgeben,
In dessen Schooß viel tausend Blumen weben,
Laß meine Klagen ein!
Laß, was du siehst aus meinen Augen schießen,
Durch Laub und Gras der schönen Gegend fließen
Und ihren Schmelz damit gewaschen sein!
Du stolzer Berg, mit Bäumen wohl besetzet,
So keine Hand der Männer hat verletzet,
Und Jungfrau’n sind, wie ich,
Verachte nicht, was meine Wehmuth bringet,
Und so sie dich nicht auch zu klagen zwinget,
So muß ich billig trauern über dich.
Es wird mein Fuß dich künftig nicht beschreiten,
Der Wiederschall wird nicht mehr mit mir streiten,
Mein Mund spricht: gute Nacht!
Ihr Blätter, kommt und werdet mir zu Zungen,
Und weil ich euch vor diesem viel gesungen,
So singt nun ihr, was mir den Tod gebracht.
Du schöner Fluß, der du die Gegend zierest
Und mehr Kristall, als Wasserfluthen führest,
Nimm an mein Ach und Weh!
Du reiner Fluß, nimm meine reinen Zähren –
Ich weiß nichts itzo Reiner’s zu gewähren –
Und schenke sie alsdann der wüsten See!
Was aber will ich Arme doch beginnen?
Was plag‘ ich doch durch Klagen meine Sinnen?
Es ist um mich gethan.
Die Jugend heißt mich ferner sein und leben,
Und der, so mir das Leben hat gegeben,
Macht, daß ich nicht mehr leben kann.
O schwerer Sieg! o unglückselig Streiten!
Des Vaters Ruhm muß mir das Grab bereiten;
Die Liebe bringt Gefahr.
Mein Untergang vermehrt der Feinde Haufen;
Es muß mein Blut zu ihrem Blute laufen;
Der Tochter Tod vermehrt der Feinde Schaar.
Ganz Ammon wird des Vaters Sieg belachen
Und einen Scherz aus Jephta’s Tochter machen;
Hier ist kein Unterscheid.
Ganz Ammon trotzt und muß durch’s Schwert verderben;
Die Tochter liebt und muß, wie Ammon, sterben;
Aus Ammon’s Blut blüht Angst und Herzeleid.
Der Vater schlug der Feinde Trotz danieder;
Jetzt rächt der Feind sich an dem Vater wieder,
Jetzt fleußt sein eigen Blut,
Sein eigen Blut, aus seinen Adern kommen,
Sein eigen Blut, davon ich bin genommen,
Sein eigen Blut, sein Schatz, sein größtes Gut.
Es muß mein Blut ein reiner Zeuge werden,
Daß Lust und Leid verbunden stehn auf Erden
Und stets verschwistert sein,
Daß Thränen stets bei unserm Lachen schweben,
Daß Rosen stets mit Dornen sind umgeben,
Daß Freud‘ und Lust begleitet Angst und Pein.
Es muß so sein! Der Himmel hat’s beschlossen,
Daß hier mein Blut soll werden ausgegossen,
Wiewohl ohn‘ alle Schuld;
Ist Lieb‘ und Lust Beleidigung zu nennen,
So muß ich nur die Uebelthat bekennen;
Doch zähm‘ ich mich durch Sanftmuth und Geduld.-
Und nun, ihr zarten Schwestern, deren Sinnen
Durch Lieb‘ und Treu‘ mich weislich binden können,
Hier ist der letzte Kuß,
Das letzte Wort, die letzte Zeit, zu scheiden!
Ich muß euch jetzt, ihr müßt mich wieder meiden!
Es trennet sich Mund, Auge, Herz und Fuß.
Es ist genug euch und auch mich betrübet;
Die ihr mich stets, die ich euch stets geliebet,
Es ist genug geklagt!
Vergeh‘ ich gleich, so muß mein Name bleiben
Und durch den Lauf der Zeiten stets bekleiben.
Die Tugend lebt; drum sterb‘ ich unverzagt.