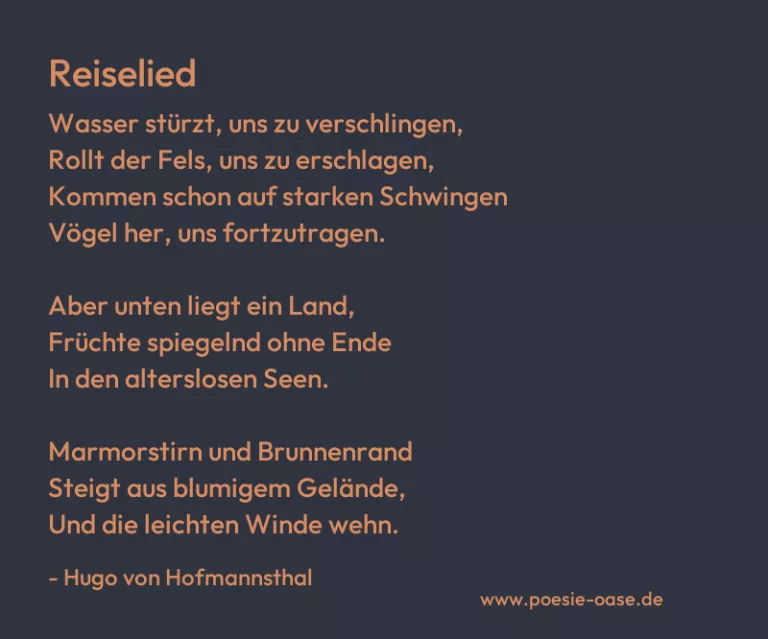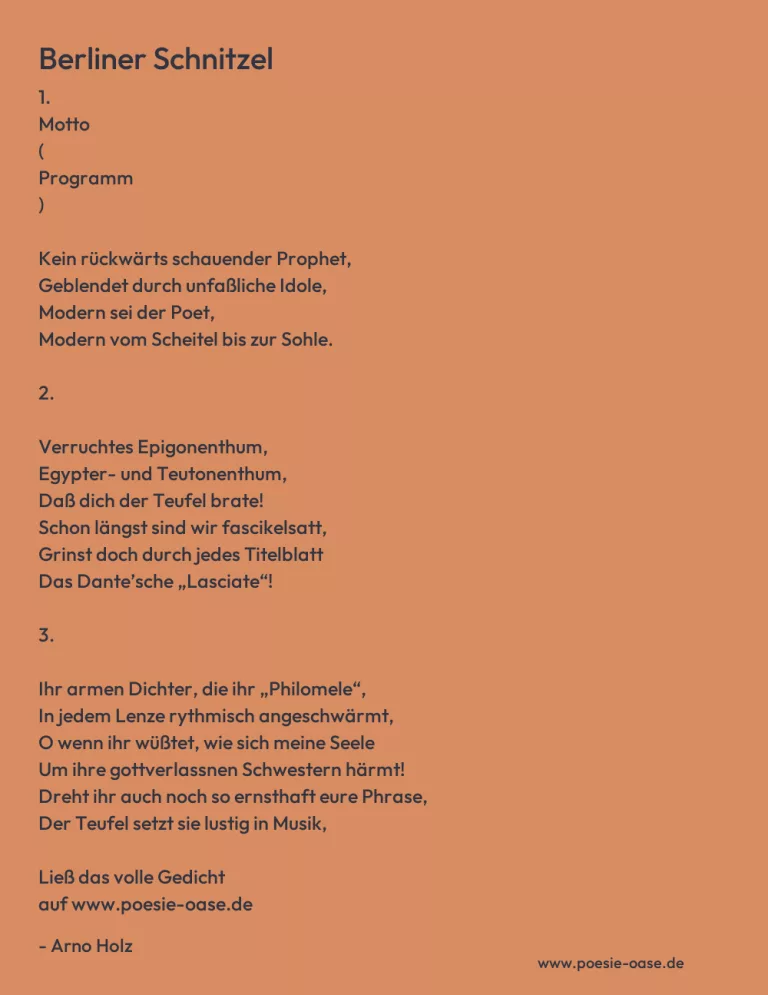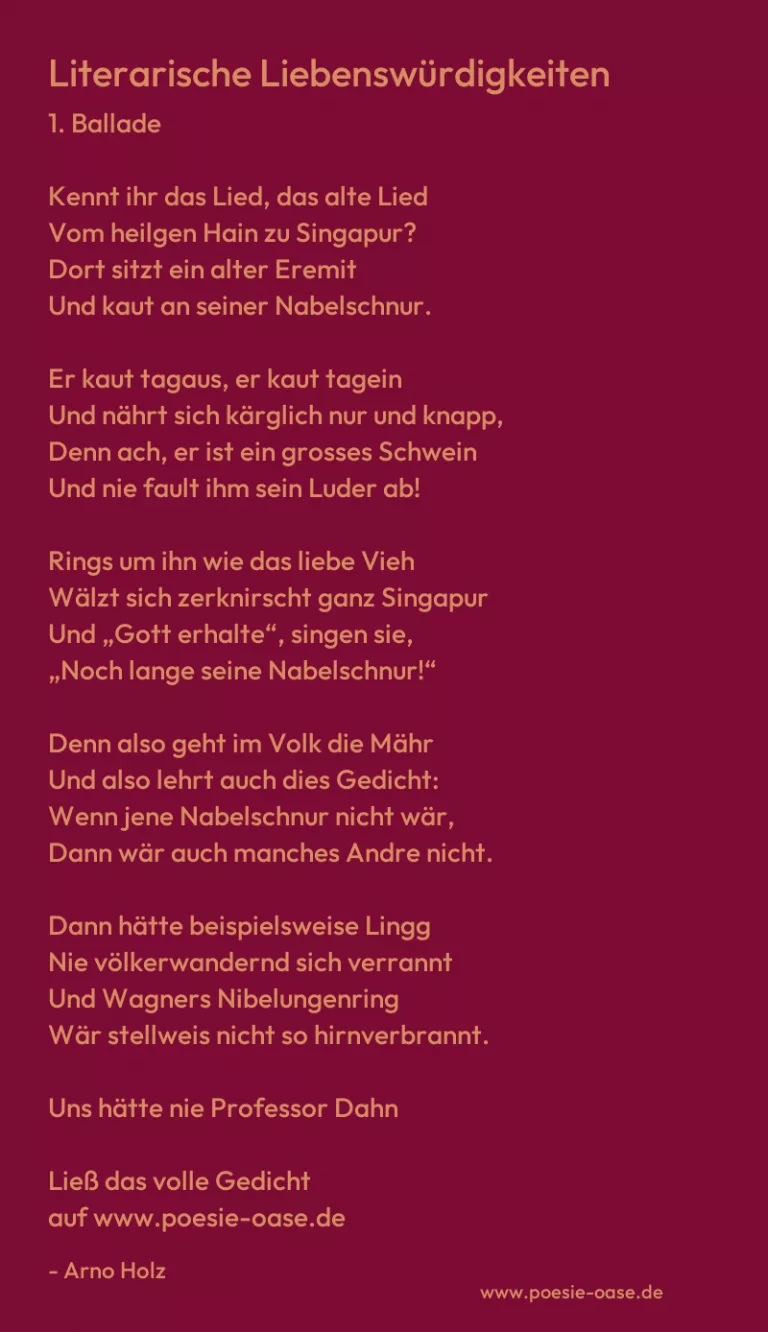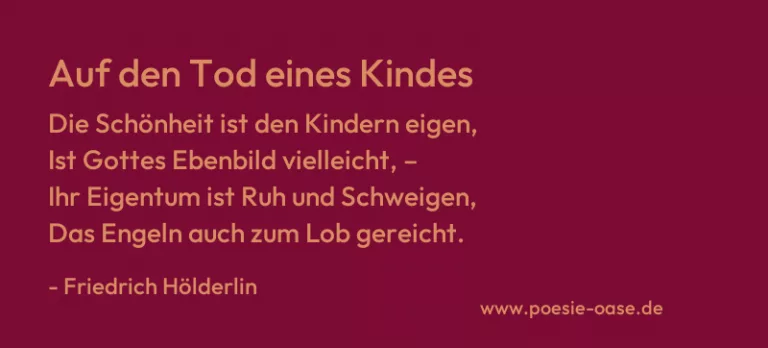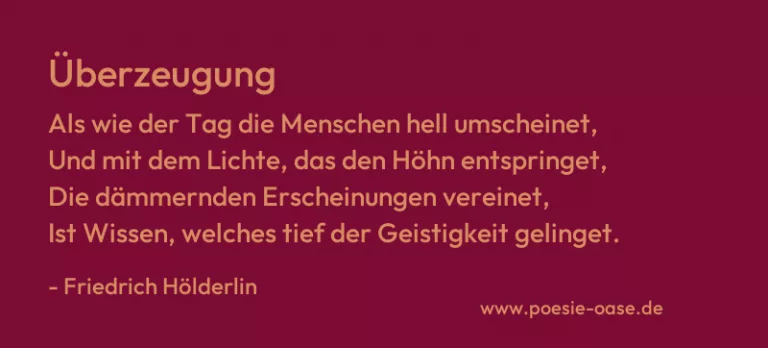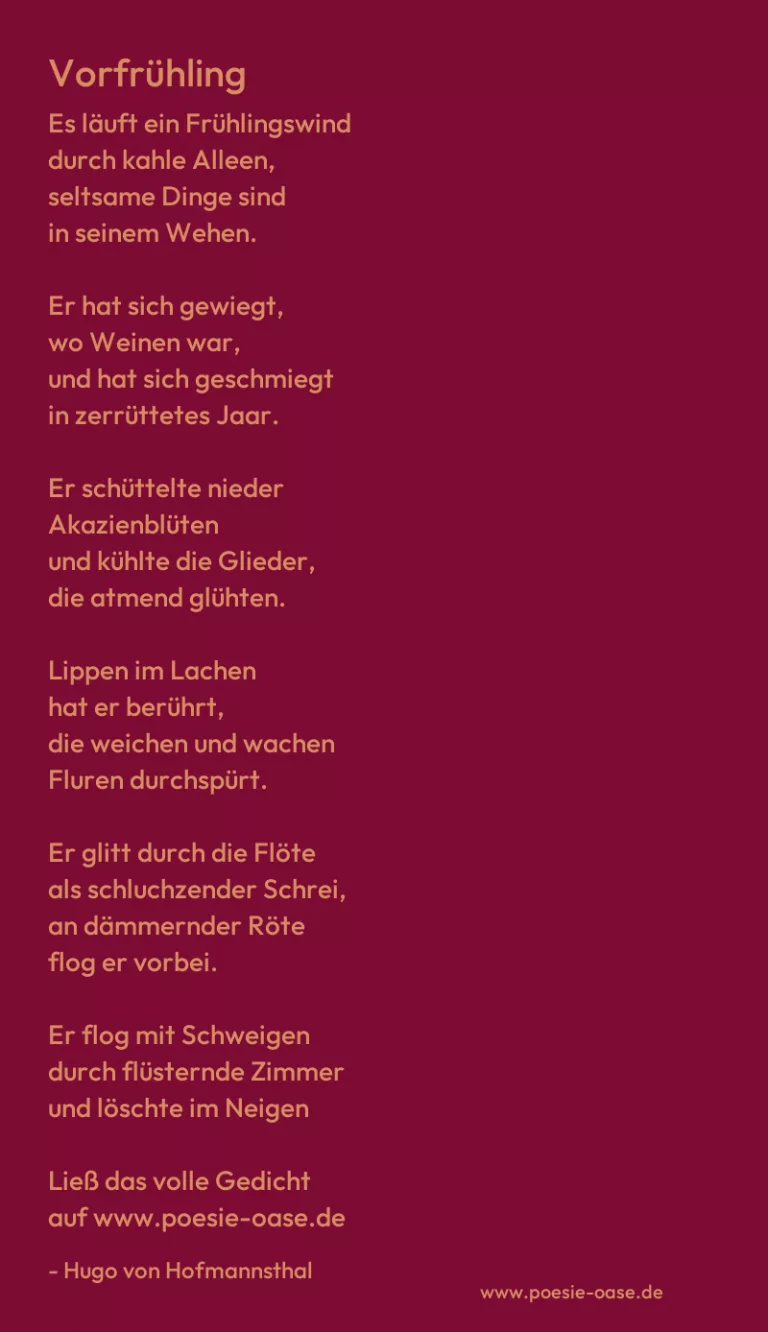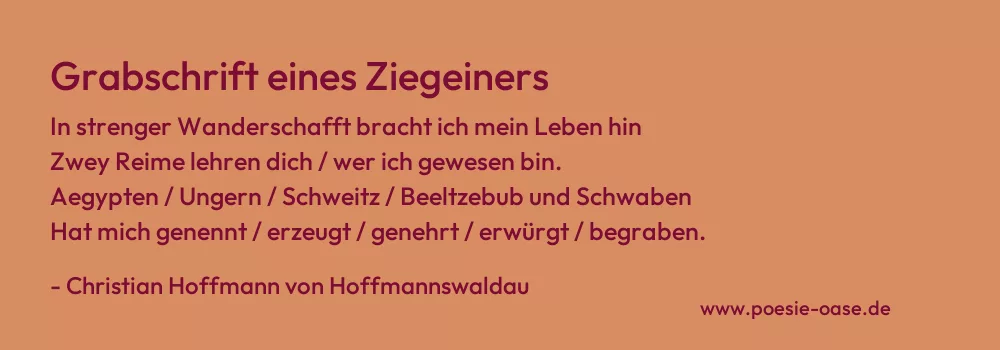Grabschrift eines Ziegeiners
In strenger Wanderschafft bracht ich mein Leben hin
Zwey Reime lehren dich / wer ich gewesen bin.
Aegypten / Ungern / Schweitz / Beeltzebub und Schwaben
Hat mich genennt / erzeugt / genehrt / erwürgt / begraben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
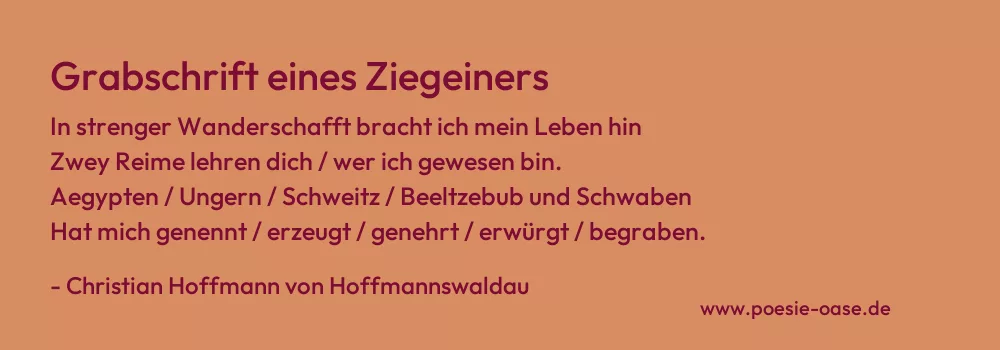
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Grabschrift eines Ziegeiners“ von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau ist ein kurzes, pointiertes Epigramm, das in nur zwei Verspaaren eine ganze Lebensgeschichte andeutet – mit Witz, Ironie und barocker Schärfe. Im Zentrum steht eine fiktionalisierte Selbstbeschreibung eines „Zigeuners“ (heute als diskriminierender Begriff erkannt), der sein Leben in ständiger Bewegung und Fremdheit verbracht hat.
Schon die erste Zeile „In strenger Wanderschafft bracht ich mein Leben hin“ verweist auf das zentrale Motiv des Unterwegsseins. Die „strenge Wanderschafft“ ist Ausdruck eines rastlosen, möglicherweise auch entbehrungsreichen Daseins, das keine feste Heimat kennt. Das lyrische Ich fasst sein ganzes Leben in „zwei Reime“ zusammen – eine ironische Reduktion, die typisch barocke Kürze und Tiefe zugleich schafft.
Der zweite Vers liefert mit fünf Ortsangaben eine sarkastische Zusammenfassung des Lebenslaufs: „Aegypten / Ungern / Schweitz / Beeltzebub und Schwaben“. Diese Orte sind nicht chronologisch oder geografisch geordnet, sondern symbolisch zu verstehen. „Aegypten“ steht möglicherweise für den Ursprung, auch im Sinne einer mythisch-exotischen Herkunft. „Ungern“ und „Schweitz“ könnten Stationen des Lebens oder Aufenthaltsorte sein. Mit „Beeltzebub“ wird das Dämonische, das Böse oder ein gewaltsames Ende angedeutet – eine drastische Wendung, die schließlich in „Schwaben“ zur endgültigen Ruhestätte führt. Der scheinbar banale Ort wird so zum Grab in einer langen, bizarren Biografie.
Das Gedicht ist ein Spiel mit Identität, Herkunft und Außenseitertum. Es verbindet Elemente des Spottgedichts mit der barocken Vanitas-Tradition, in der das Leben als kurzes, oft absurdes Schauspiel erscheint. Der Humor liegt in der grotesken Überzeichnung: Der Erzähler behauptet, er könne mit zwei Reimen alles sagen – und tut es auf so übersteigerte Weise, dass gerade diese Reduktion aufhorchen lässt.
Hoffmannswaldau gelingt mit wenigen Worten ein satirisches Porträt eines gesellschaftlich Ausgegrenzten, das zwischen Spott, Tragik und Ironie schwankt. Der lakonische Ton, die Mischung aus realen und symbolischen Ortsangaben und die knappe Form machen das Epigramm zu einem prägnanten Beispiel barocker Weltdeutung – voller Abgründigkeit, Witz und Doppelsinn.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.