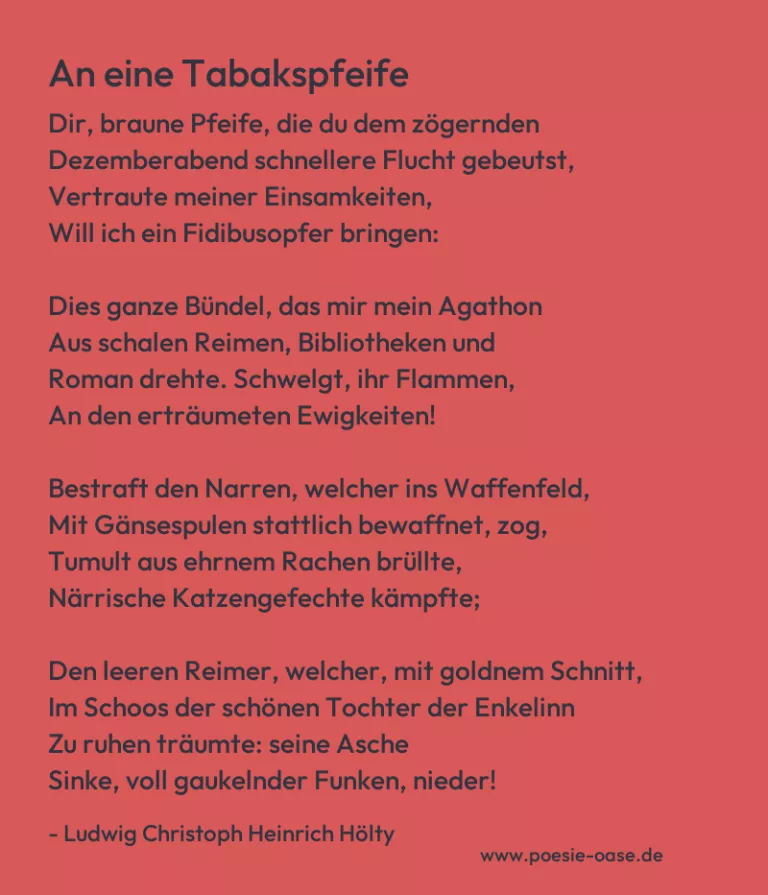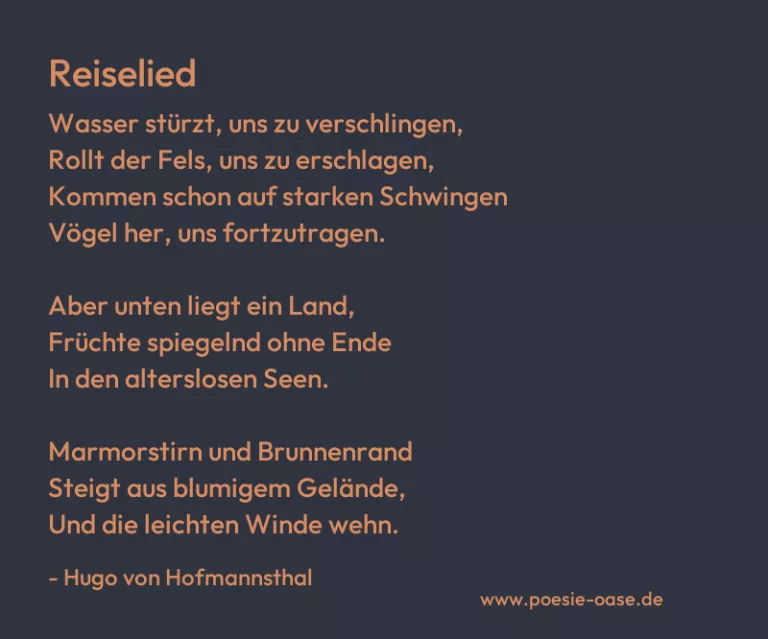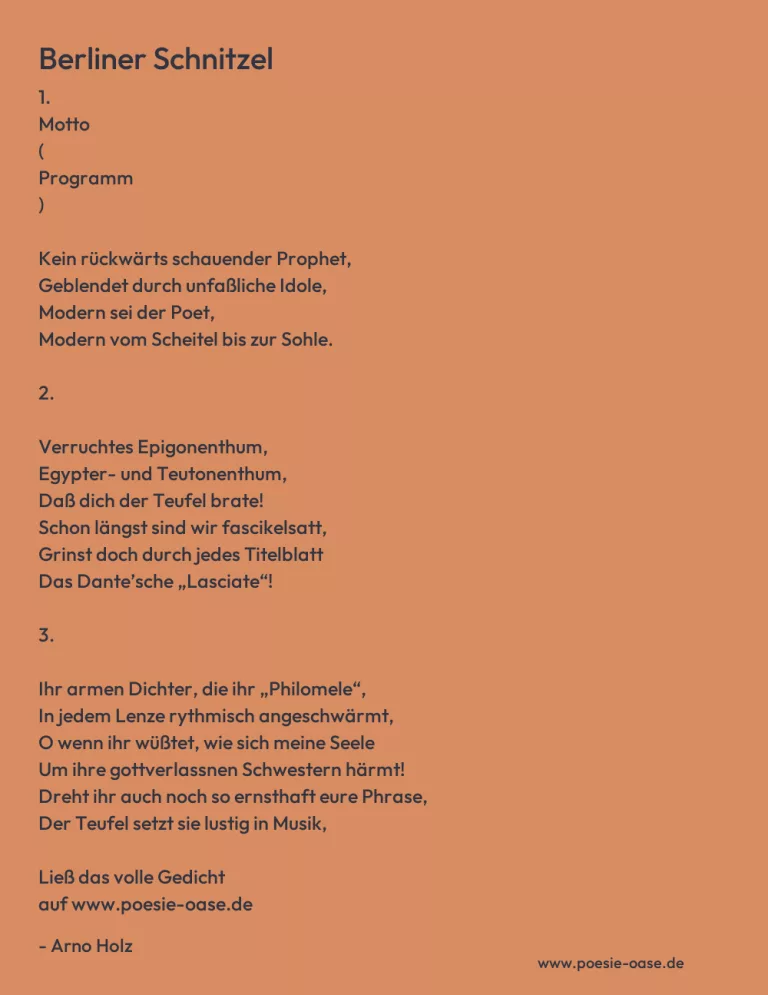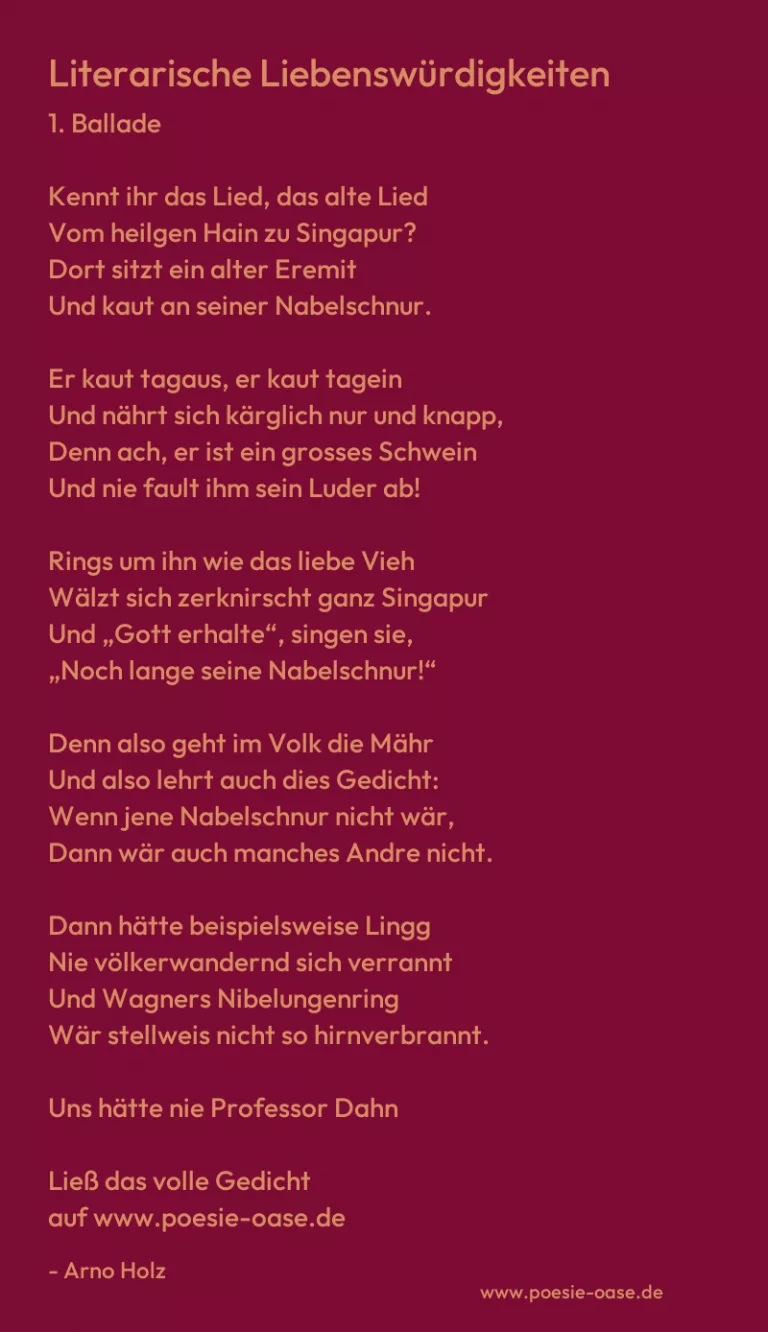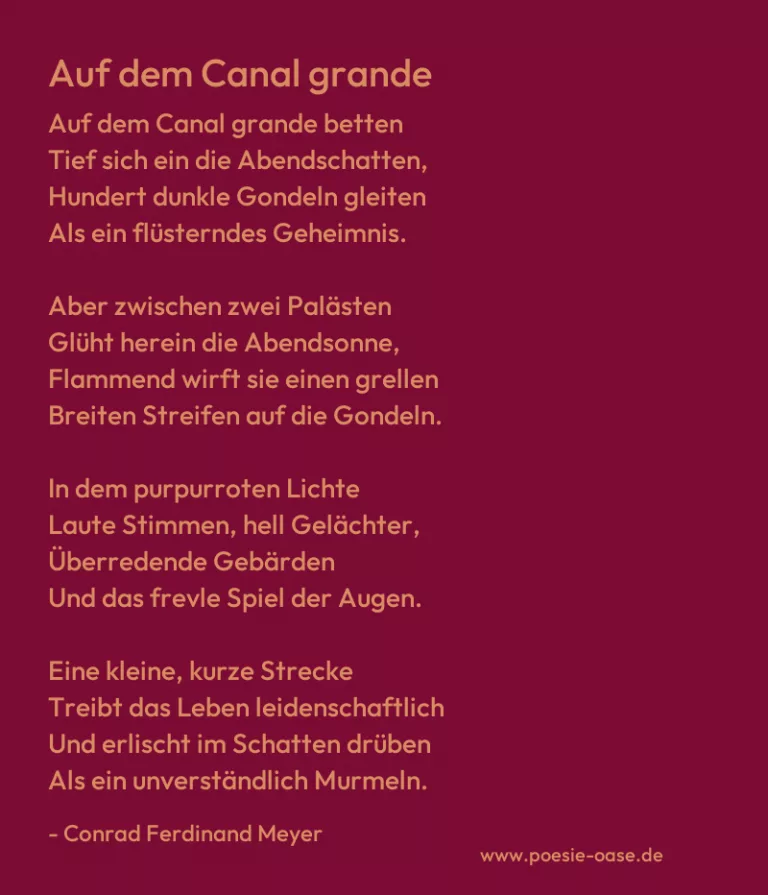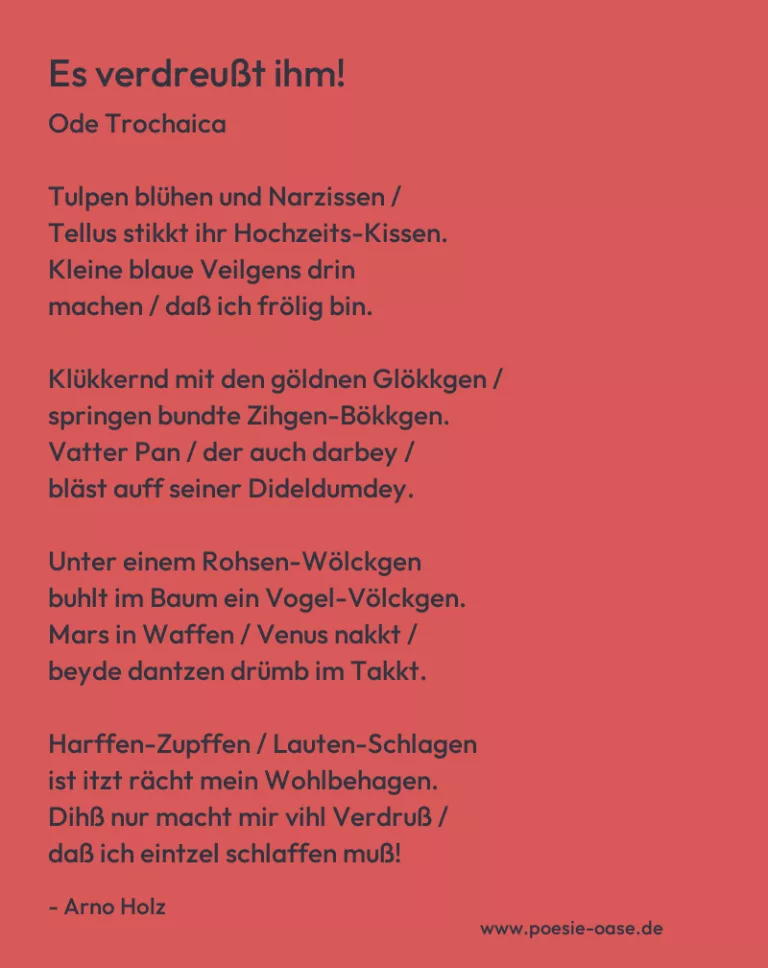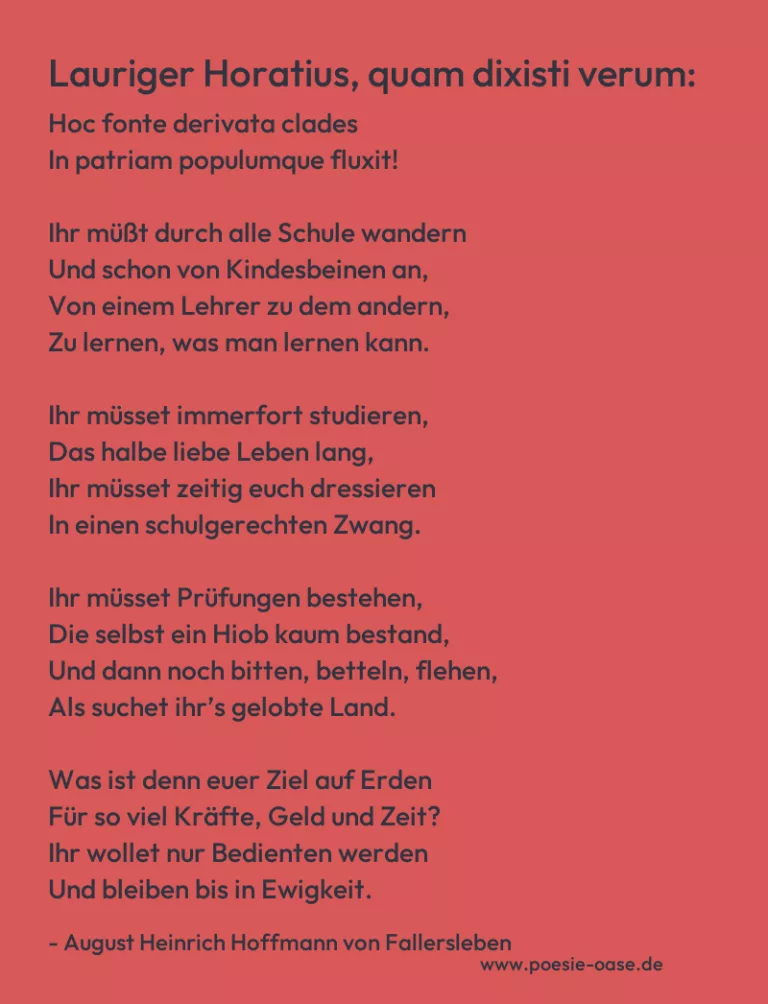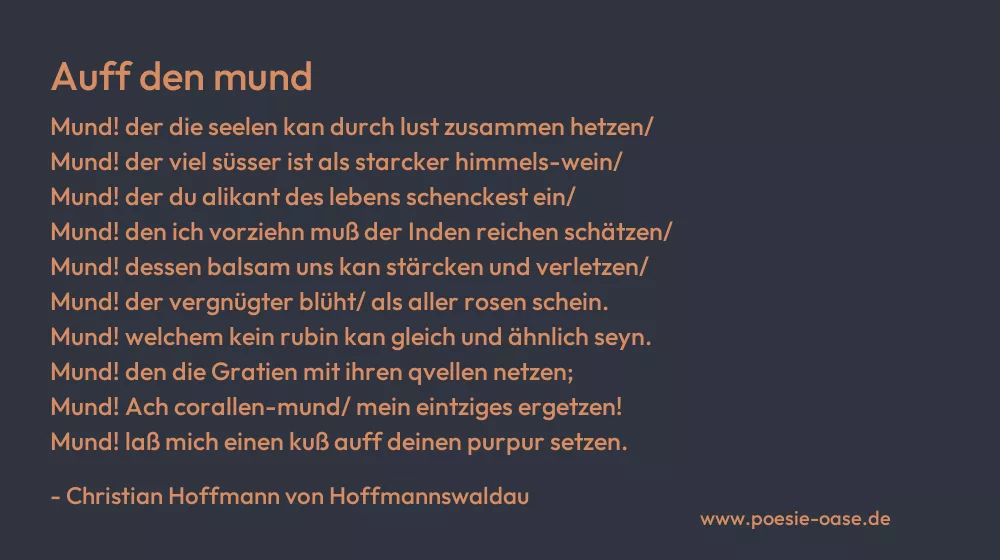Auff den mund
Mund! der die seelen kan durch lust zusammen hetzen/
Mund! der viel süsser ist als starcker himmels-wein/
Mund! der du alikant des lebens schenckest ein/
Mund! den ich vorziehn muß der Inden reichen schätzen/
Mund! dessen balsam uns kan stärcken und verletzen/
Mund! der vergnügter blüht/ als aller rosen schein.
Mund! welchem kein rubin kan gleich und ähnlich seyn.
Mund! den die Gratien mit ihren qvellen netzen;
Mund! Ach corallen-mund/ mein eintziges ergetzen!
Mund! laß mich einen kuß auff deinen purpur setzen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
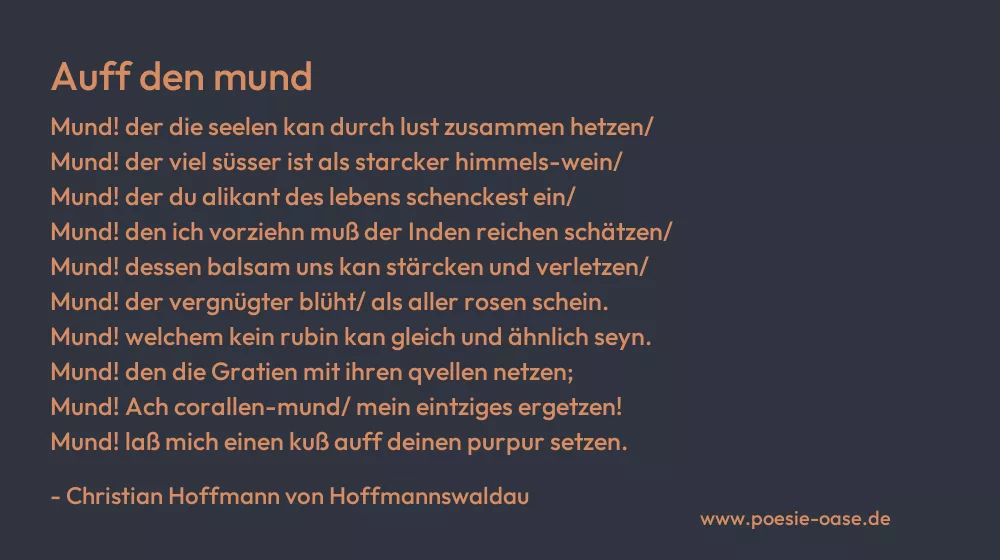
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auff den Mund“ von Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau ist ein barockes Liebesgedicht, das in leidenschaftlicher und bildreicher Sprache die Schönheit und Wirkung eines geliebten Mundes besingt. In der für Hoffmannswaldau typischen, kunstvoll gesteigerten Rhetorik wird der Mund zur Quelle sinnlicher, ja fast überirdischer Lust erhoben – ein zentrales Objekt erotischer Verehrung.
Jede Zeile beginnt mit dem Ausruf „Mund!“, was dem Gedicht eine litaneiartige Struktur gibt und zugleich die Dringlichkeit sowie die Faszination des Sprechers deutlich macht. Der Mund wird nicht nur als physisches Objekt beschrieben, sondern erhält verschiedene Bedeutungsdimensionen: Er „hetzt“ Seelen zusammen durch Lust, ist „süßer als himmlischer Wein“ und wird zum „alikant des Lebens“ – also einem edlen, berauschenden Lebenselixier.
Die Sprache ist stark durch sinnliche Metaphorik geprägt. Der Mund wird mit kostbaren Dingen verglichen: er ist wertvoller als Schätze der „Inden“, blüht schöner als Rosen und übertrifft selbst den Rubin an Glanz und Farbe. Diese Überhöhung mündet in einer doppelten Wirkung: Der Mund kann „stärken und verletzen“ – eine Ambivalenz, die oft in barocker Liebeslyrik vorkommt, in der Lust und Leid eng beieinanderliegen.
Durch die Erwähnung mythologischer Figuren wie den „Gratien“, die den Mund mit ihren Quellen netzen, wird die sinnliche Schönheit in ein fast göttliches Licht gerückt. Der „Corallen-Mund“ – ein häufiges Motiv für rote, begehrenswerte Lippen – wird schließlich zum „eintzigen ergetzen“ des lyrischen Ichs. Der Wunsch nach einem Kuss ist die natürliche, aber auch spannungsvoll zurückgehaltene Auflösung dieser ekstatischen Anrufung.
Insgesamt ist das Gedicht ein typisches Beispiel barocker Erotik: reich an rhetorischen Figuren, überbordend in der Bildsprache, und getragen von der Verehrung des Körpers als Spiegel überhöhter Schönheit. Es zeigt Hoffmannswaldau als Meister des sinnlich-verkünstelten Ausdrucks, der in einem einzigen Motiv – hier dem Mund – eine ganze Welt der Sehnsucht und des Begehrens entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.