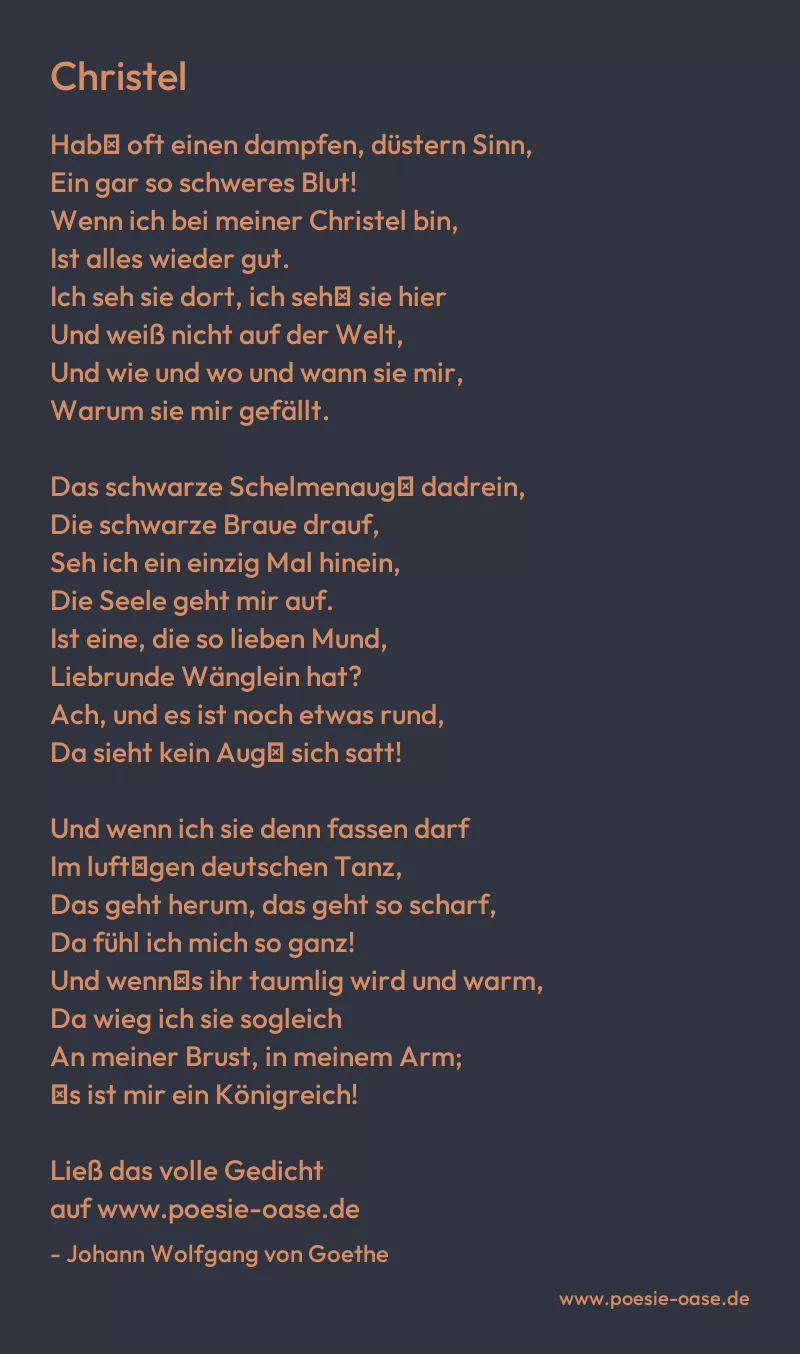Hab′ oft einen dampfen, düstern Sinn,
Ein gar so schweres Blut!
Wenn ich bei meiner Christel bin,
Ist alles wieder gut.
Ich seh sie dort, ich seh′ sie hier
Und weiß nicht auf der Welt,
Und wie und wo und wann sie mir,
Warum sie mir gefällt.
Das schwarze Schelmenaug′ dadrein,
Die schwarze Braue drauf,
Seh ich ein einzig Mal hinein,
Die Seele geht mir auf.
Ist eine, die so lieben Mund,
Liebrunde Wänglein hat?
Ach, und es ist noch etwas rund,
Da sieht kein Aug′ sich satt!
Und wenn ich sie denn fassen darf
Im luft′gen deutschen Tanz,
Das geht herum, das geht so scharf,
Da fühl ich mich so ganz!
Und wenn′s ihr taumlig wird und warm,
Da wieg ich sie sogleich
An meiner Brust, in meinem Arm;
′s ist mir ein Königreich!
Und wenn sie liebend nach mir blickt
Und alles rund vergißt,
Und dann an meine Brust gedrückt
Und weidlich eins geküßt,
Das läuft mir durch das Rückenmark
Bis in die große Zeh′!
Ich bin so schwach, ich bin so stark,
Mir ist so wohl, so weh!
Da möcht′ ich mehr und immer mehr,
Der Tag wird mir nicht lang;
Wenn ich die Nacht auch bei ihr wär′,
Davor wär′ mir nicht bang.
Ich denk′, ich halte sie einmal
Und büße meine Lust;
Und endigt sich nicht meine Qual,
Sterb ich an ihrer Brust!