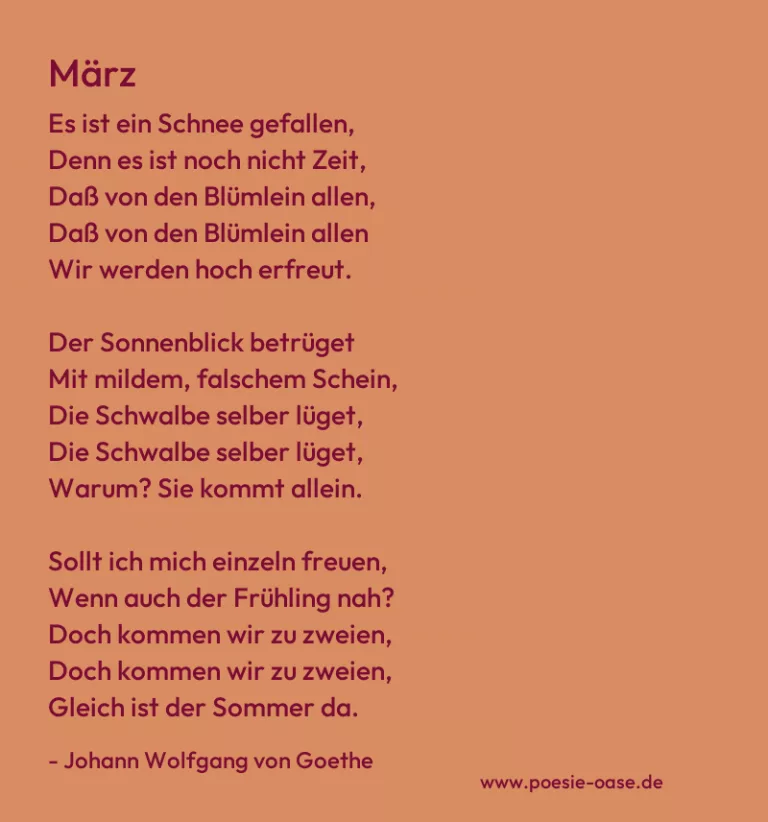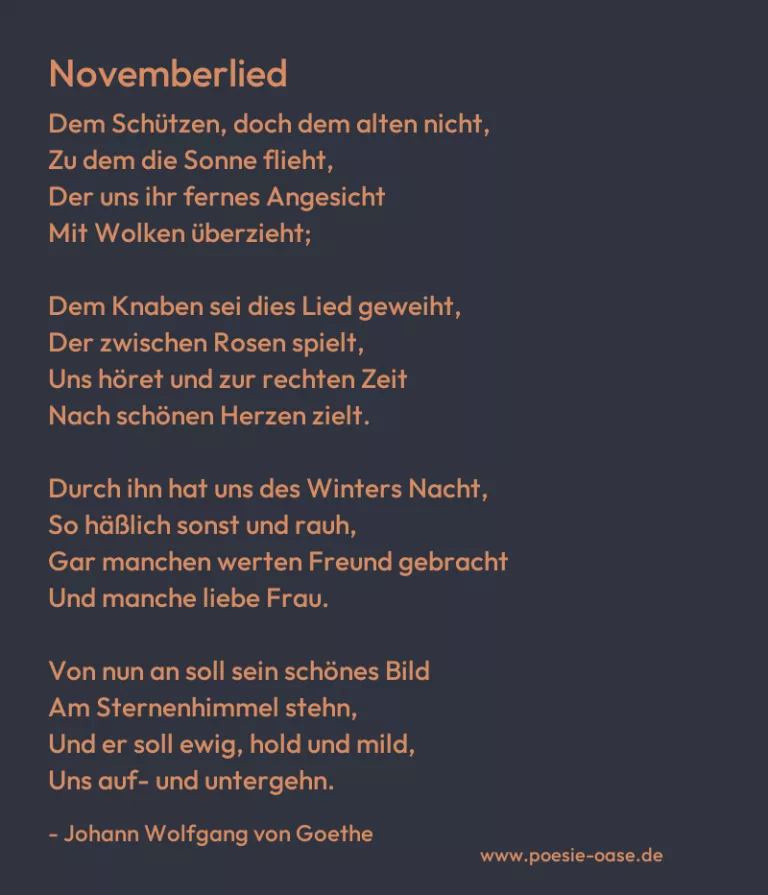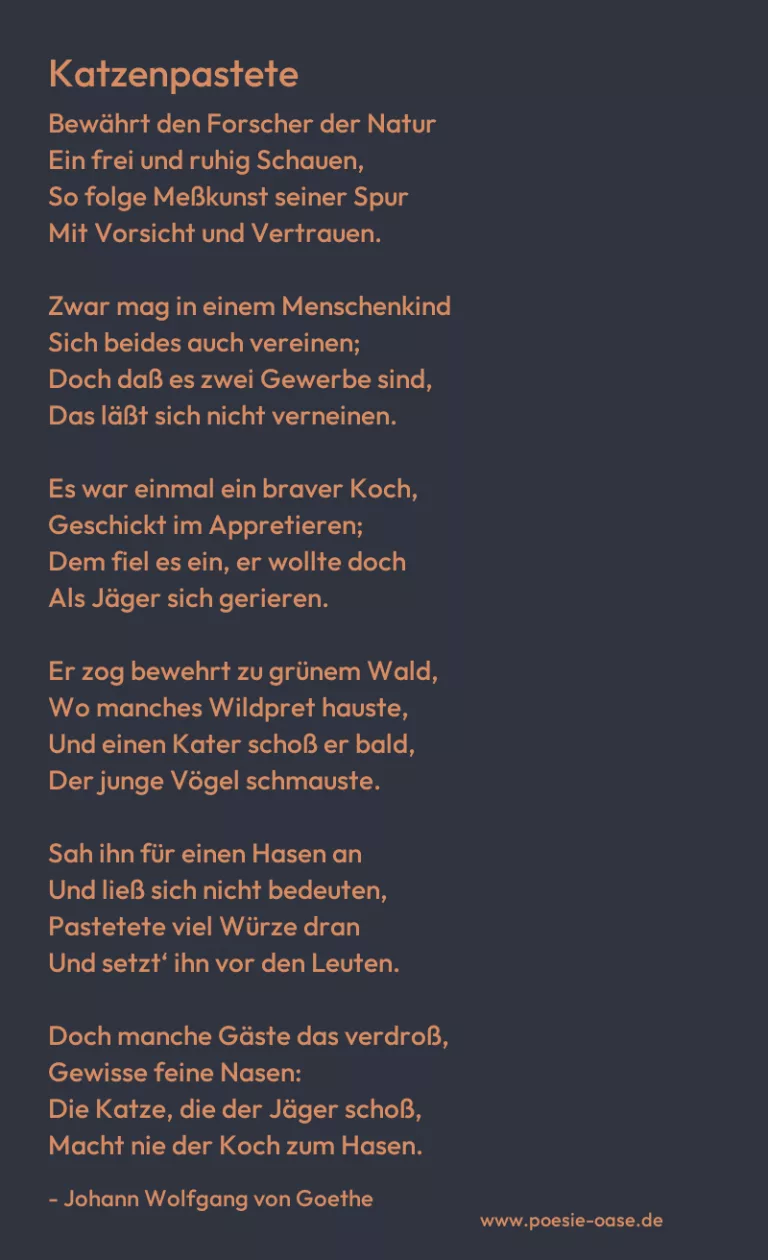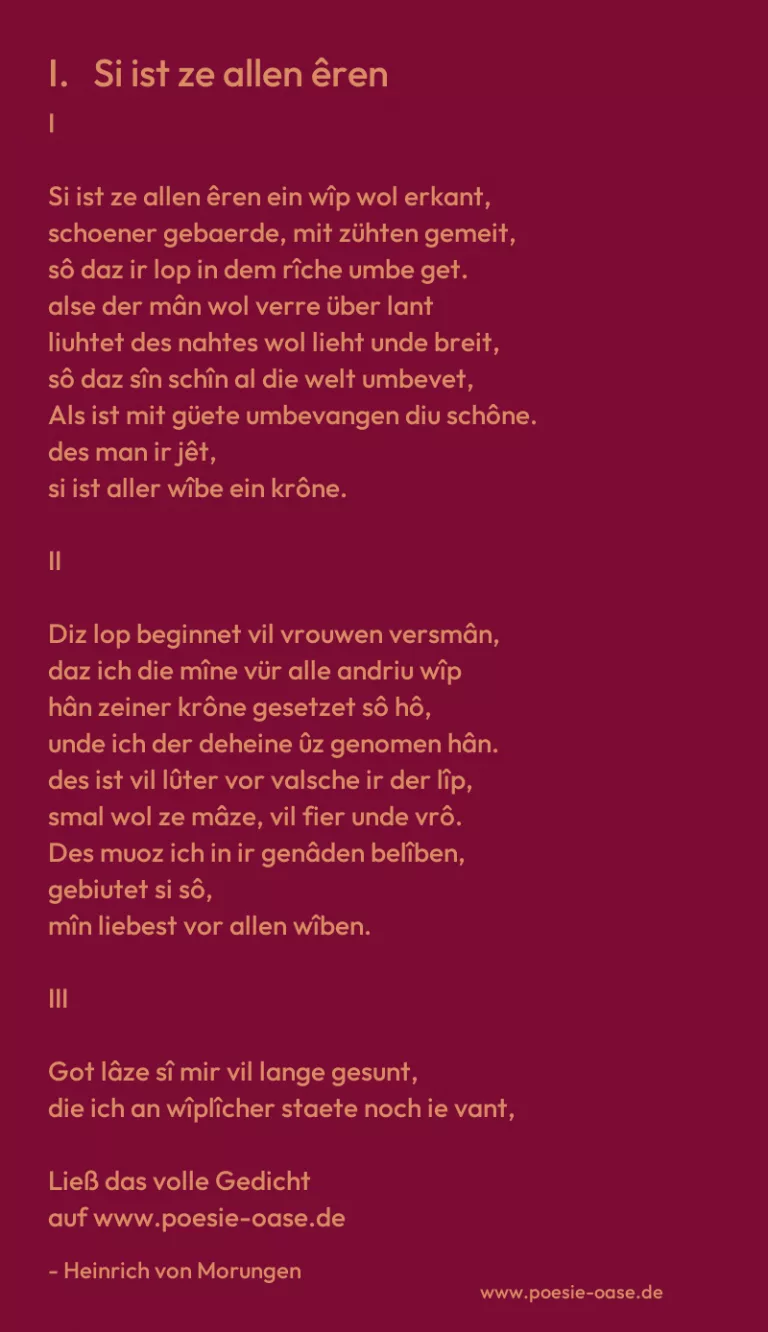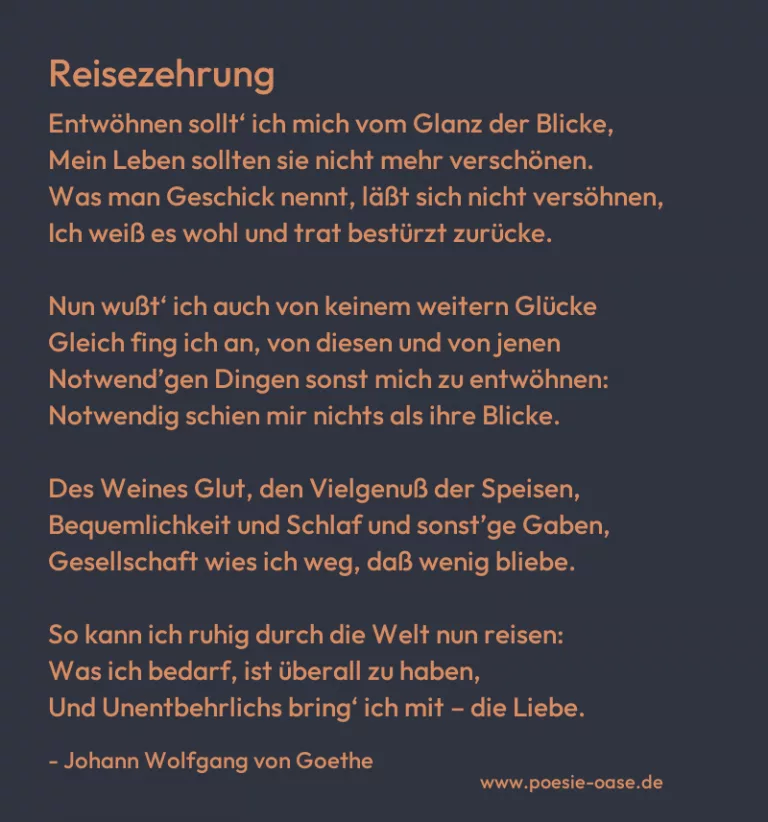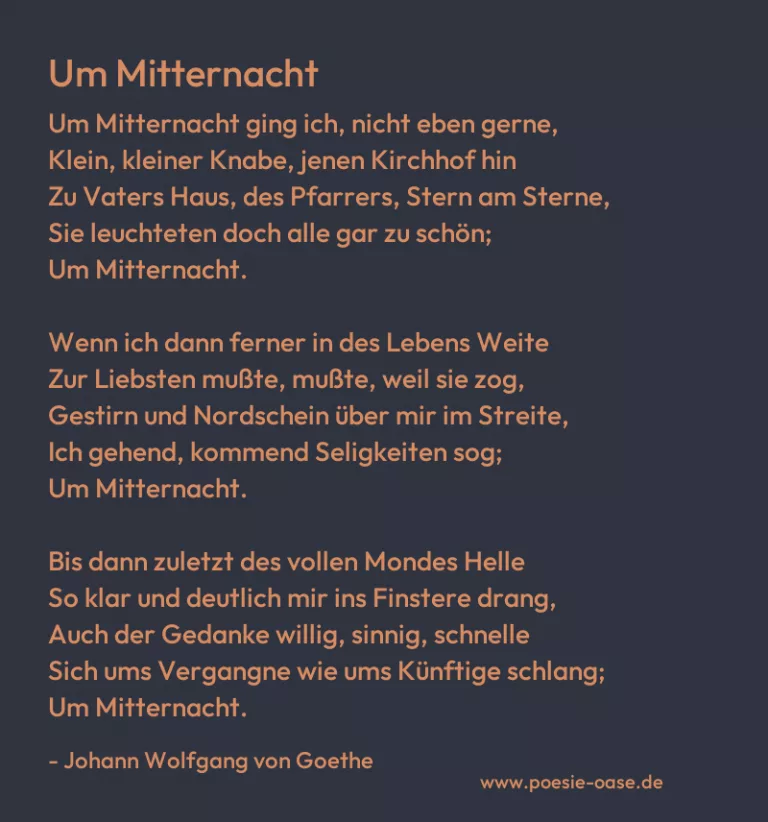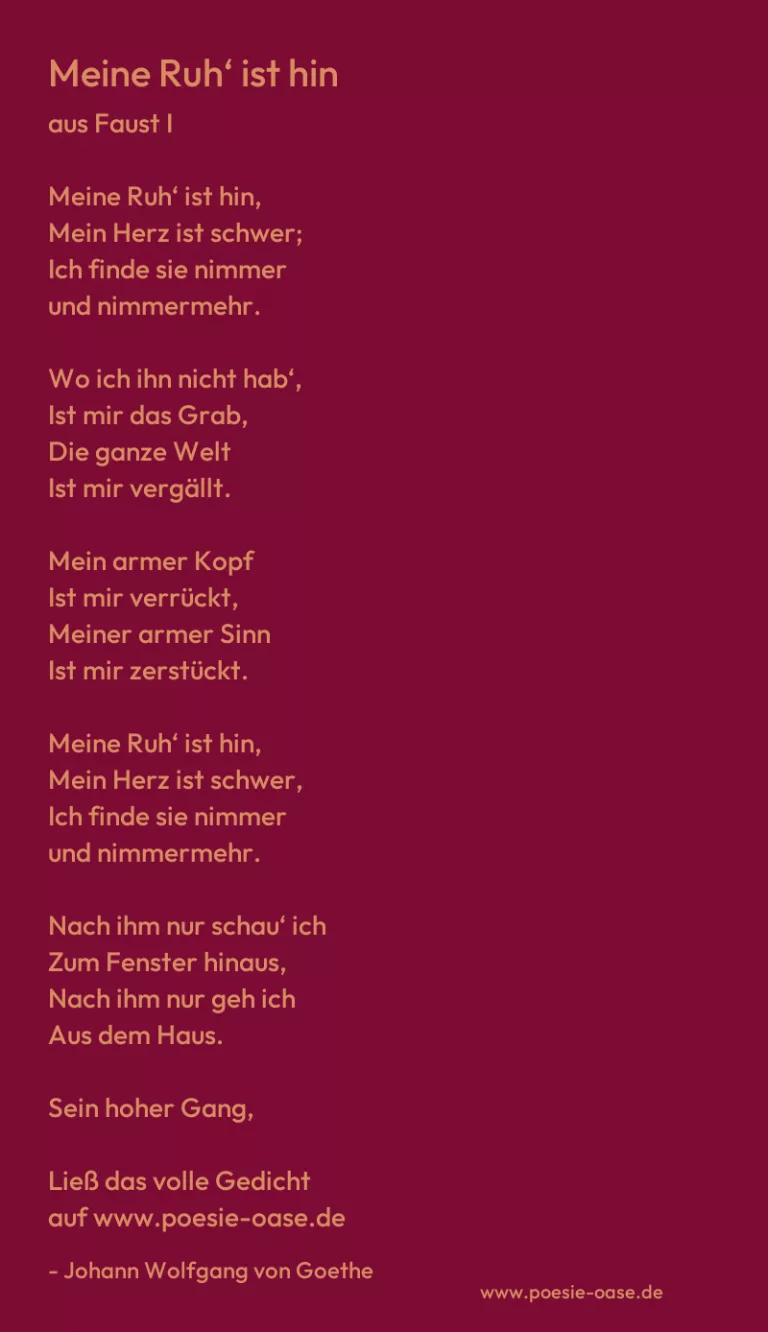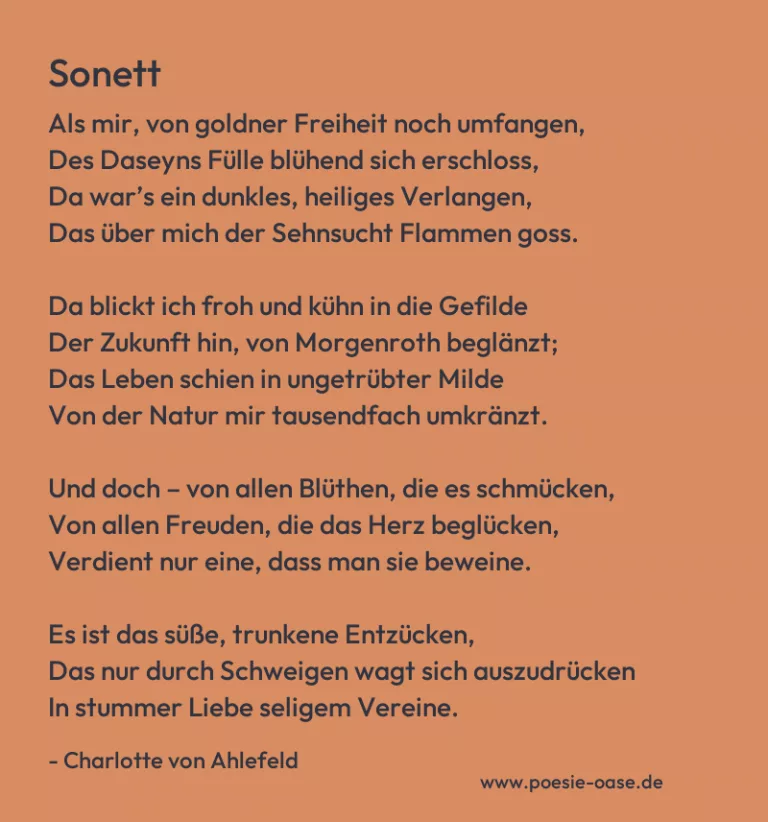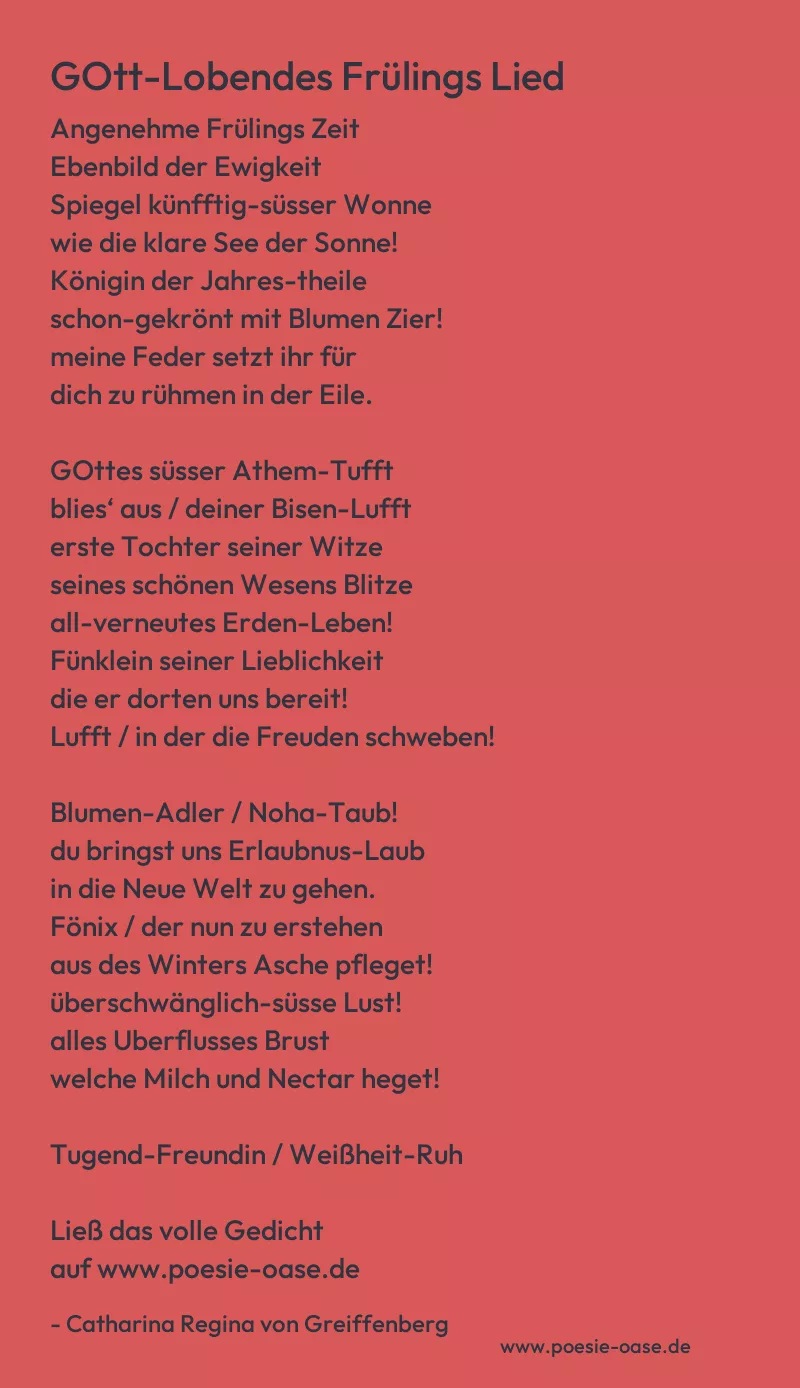Alltag, Angst, Freude, Gedanken, Gemeinfrei, Götter, Herbst, Leichtigkeit, Leidenschaft, Liebe & Romantik, Religion, Sagen, Sommer, Tiere, Universum, Zerstörung
GOtt-Lobendes Frülings Lied
Angenehme Frülings Zeit
Ebenbild der Ewigkeit
Spiegel künfftig-süsser Wonne
wie die klare See der Sonne!
Königin der Jahres-theile
schon-gekrönt mit Blumen Zier!
meine Feder setzt ihr für
dich zu rühmen in der Eile.
GOttes süsser Athem-Tufft
blies‘ aus / deiner Bisen-Lufft
erste Tochter seiner Witze
seines schönen Wesens Blitze
all-verneutes Erden-Leben!
Fünklein seiner Lieblichkeit
die er dorten uns bereit!
Lufft / in der die Freuden schweben!
Blumen-Adler / Noha-Taub!
du bringst uns Erlaubnus-Laub
in die Neue Welt zu gehen.
Fönix / der nun zu erstehen
aus des Winters Asche pfleget!
überschwänglich-süsse Lust!
alles Uberflusses Brust
welche Milch und Nectar heget!
Tugend-Freundin / Weißheit-Ruh
Musen-Schwester! laß mir zu
meine ungestimmte Leyren
die schon lange Zeit must feyren
dich erhebend‘ anzustimmen
und ein Liedlein dir zu Preiß:
zwar auff meine Bauren Weiß
die nicht Sternen-an kan klimmen
Safft aus GOttes Allmacht-qvell
strahle seiner Wunder-Seel
Krafft der unergründten Kräffte
schönstes Himmel-Lauffs geschäffte
Haupt-Ergetzung aller Sachen!
du bleibst von mir unerreicht
keine Macht noch Pracht dir gleicht.
kurz! du bist des höchsten Lachen.
Ich verlieb mich zwar in dich:
doch seh ich noch übersich.
Bist zwar schön: doch nur ein Schatten
künfftig-heller Wunder-Thaten.
Dorthin / die Gedanken fanken
richten ihre Flügelfahrt.
Doch / in dem ich der erwart
will ich GOtt für diese danken.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
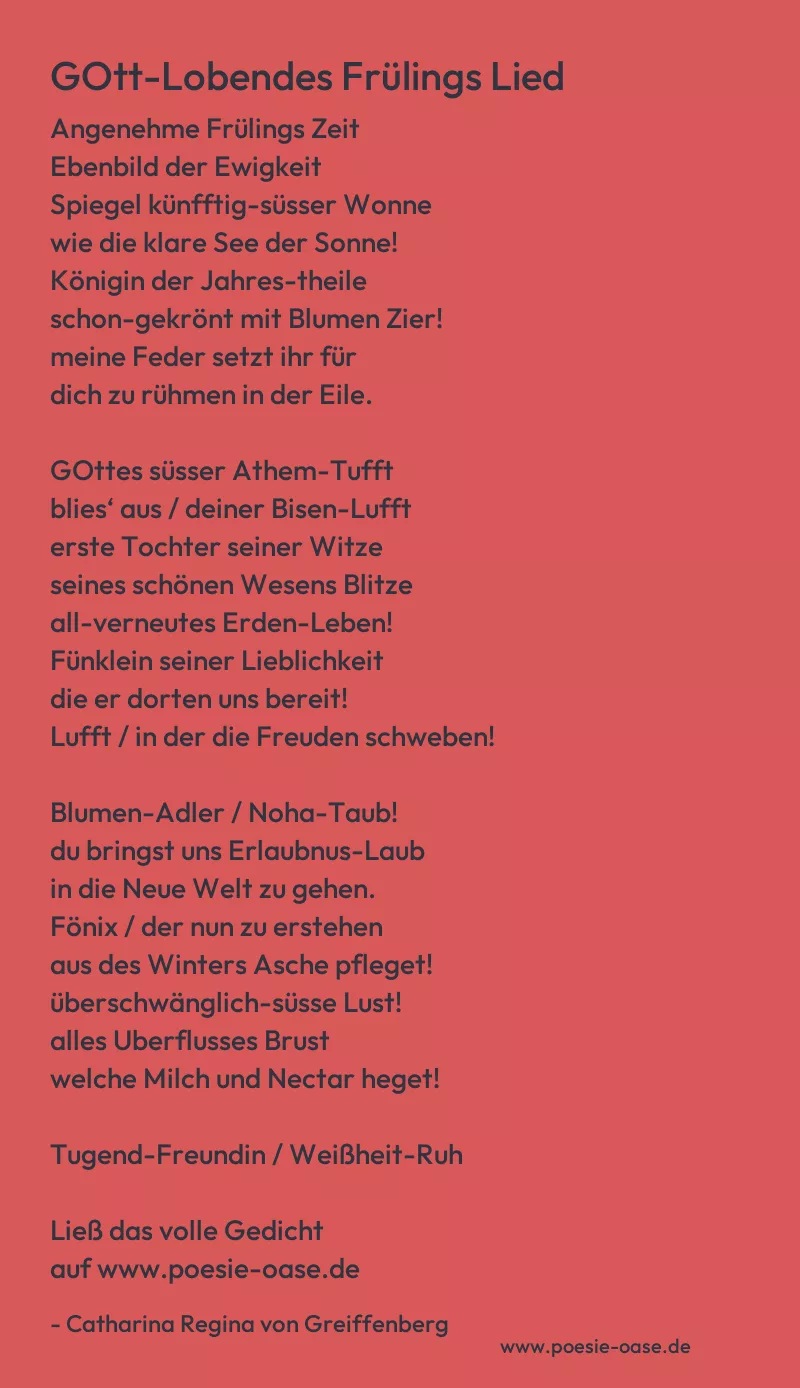
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „GOtt-Lobendes Frülings Lied“ von Catharina Regina von Greiffenberg ist eine hymnische Feier des Frühlings als Sinnbild göttlicher Schöpfungskraft. In barocker Tradition wird die erwachende Natur nicht nur als irdische Freude, sondern als Spiegel der Ewigkeit und als Hinweis auf die göttliche Herrlichkeit verstanden.
Bereits die erste Strophe stellt den Frühling als „Ebenbild der Ewigkeit“ dar. Er ist nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein Abbild der kommenden göttlichen Wonne. Die Natur wird hier als ein Zeichen göttlicher Gnade betrachtet, das dem Menschen Hoffnung und Freude schenkt. Die zweite Strophe führt diesen Gedanken fort: Der Frühlingshauch wird als „GOttes süsser Athem-Tufft“ beschrieben – ein Ausdruck der göttlichen Lebenskraft, die die Welt erneuert.
Die dritte Strophe nutzt eindrucksvolle Bilder aus der biblischen und mythologischen Tradition: Der Frühling wird mit der Taube Noahs verglichen, die das „Erlaubnus-Laub“ bringt und damit den Neubeginn nach der Sintflut ankündigt. Ebenso wird er mit dem Phönix assoziiert, der aus der „Winters Asche“ neu ersteht. Hier wird der Frühling als ein Zeichen für die Wiederauferstehung und das ewige Leben verstanden.
Doch trotz dieser Begeisterung für die Schönheit der Natur sieht das lyrische Ich den Frühling letztlich nur als „Schatten künfftig-heller Wunder-Thaten“. Die Freude über die Natur führt nicht zur reinen Bewunderung des Irdischen, sondern lenkt den Blick auf die himmlische Vollkommenheit. In dieser Erkenntnis endet das Gedicht in einer Danksagung an Gott: Während die Gedanken bereits dem Göttlichen zustreben, wird der gegenwärtige Frühling als ein Geschenk dankbar angenommen.
Das Gedicht verbindet barocke Naturschwärmerei mit tiefem religiösen Empfinden. Die Natur dient nicht als Selbstzweck, sondern als Verweis auf göttliche Macht und als Vorgeschmack auf eine höhere, ewige Wirklichkeit. Die poetische Sprache und die Vielzahl an biblischen und mythologischen Anspielungen verleihen dem Lobpreis eine feierliche, fast ekstatische Stimmung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.