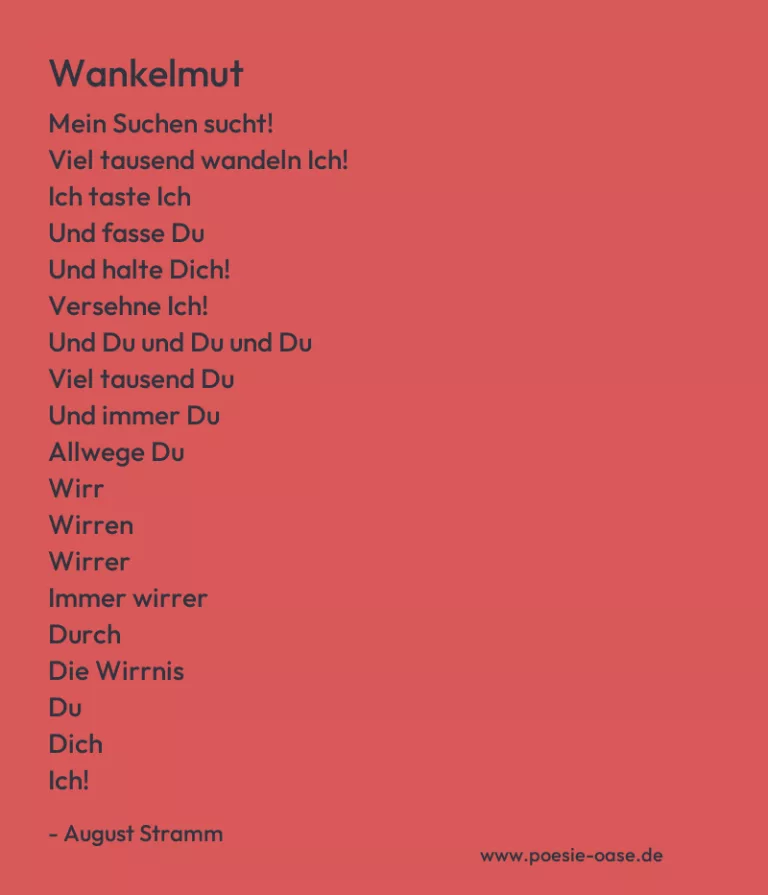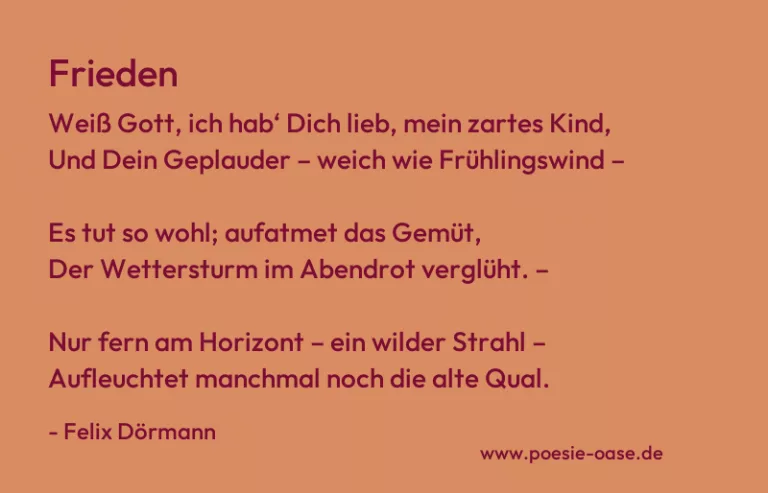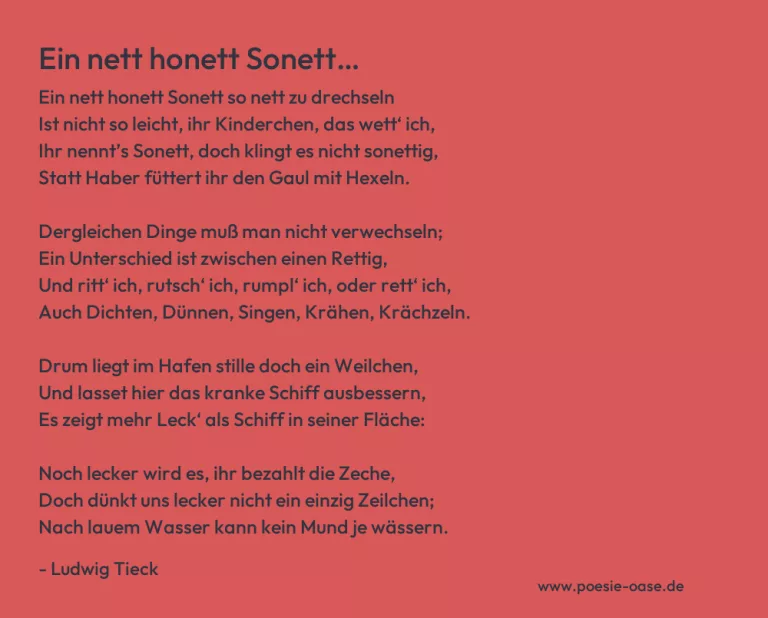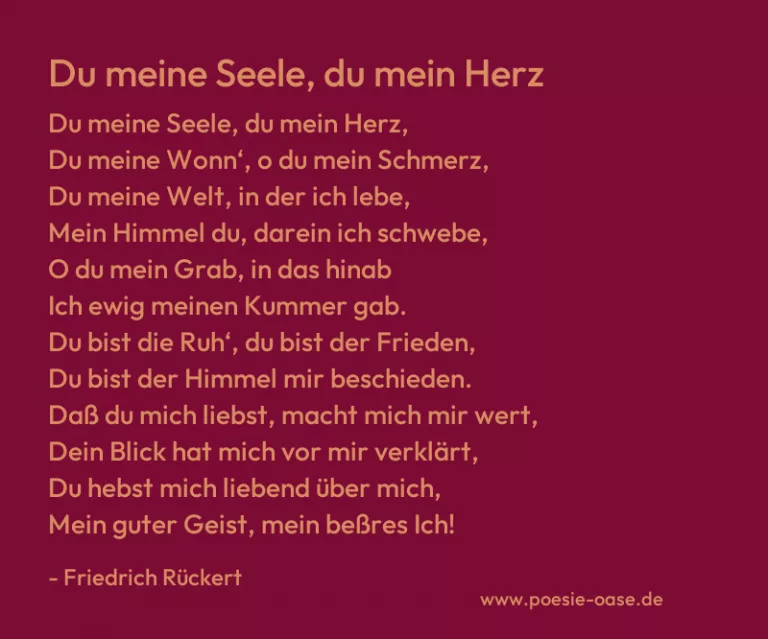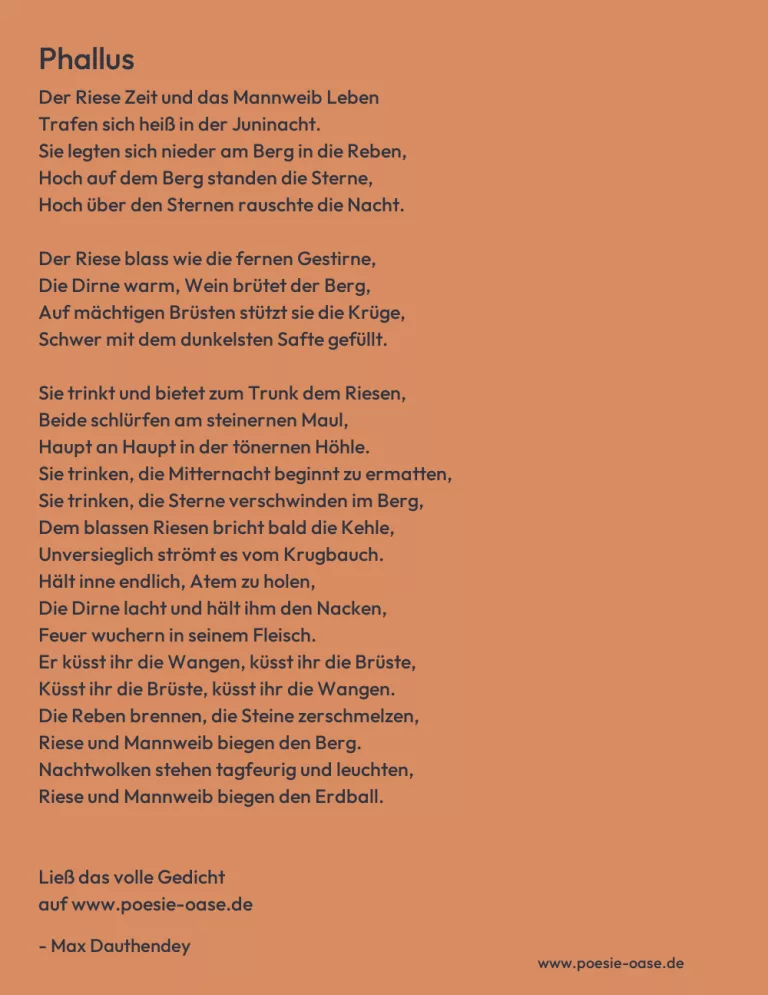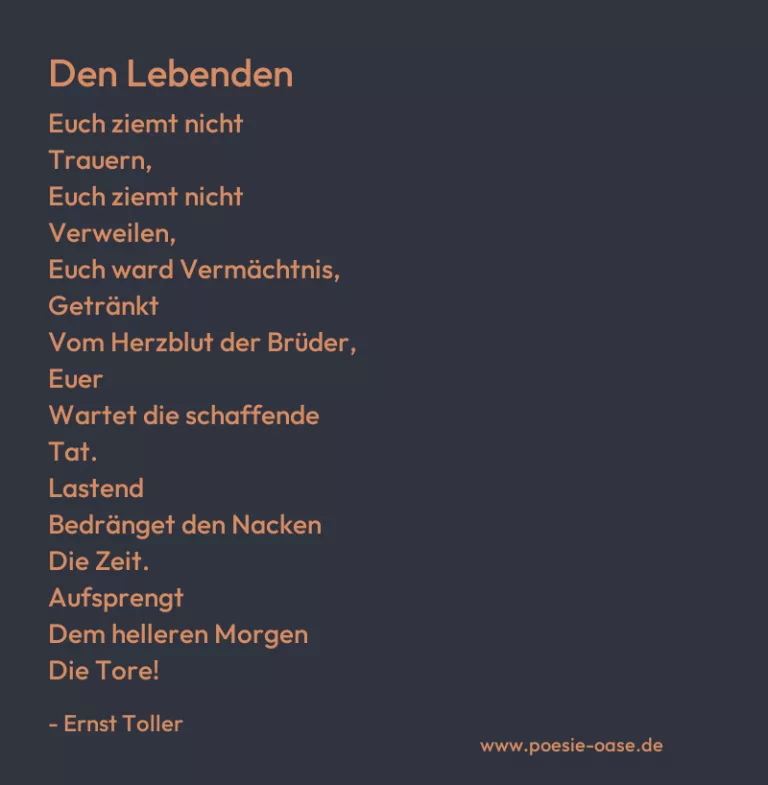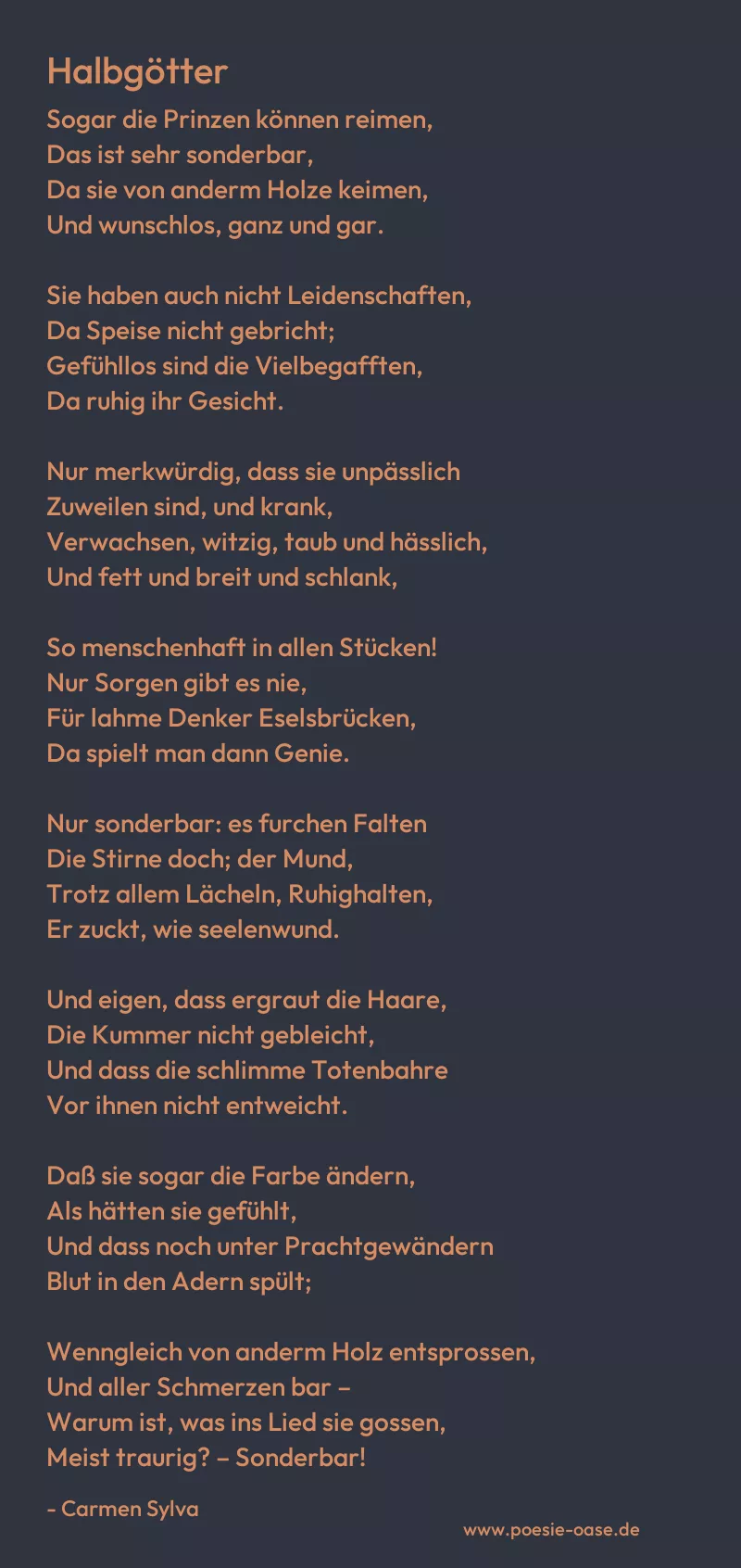Halbgötter
Sogar die Prinzen können reimen,
Das ist sehr sonderbar,
Da sie von anderm Holze keimen,
Und wunschlos, ganz und gar.
Sie haben auch nicht Leidenschaften,
Da Speise nicht gebricht;
Gefühllos sind die Vielbegafften,
Da ruhig ihr Gesicht.
Nur merkwürdig, dass sie unpässlich
Zuweilen sind, und krank,
Verwachsen, witzig, taub und hässlich,
Und fett und breit und schlank,
So menschenhaft in allen Stücken!
Nur Sorgen gibt es nie,
Für lahme Denker Eselsbrücken,
Da spielt man dann Genie.
Nur sonderbar: es furchen Falten
Die Stirne doch; der Mund,
Trotz allem Lächeln, Ruhighalten,
Er zuckt, wie seelenwund.
Und eigen, dass ergraut die Haare,
Die Kummer nicht gebleicht,
Und dass die schlimme Totenbahre
Vor ihnen nicht entweicht.
Daß sie sogar die Farbe ändern,
Als hätten sie gefühlt,
Und dass noch unter Prachtgewändern
Blut in den Adern spült;
Wenngleich von anderm Holz entsprossen,
Und aller Schmerzen bar –
Warum ist, was ins Lied sie gossen,
Meist traurig? – Sonderbar!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
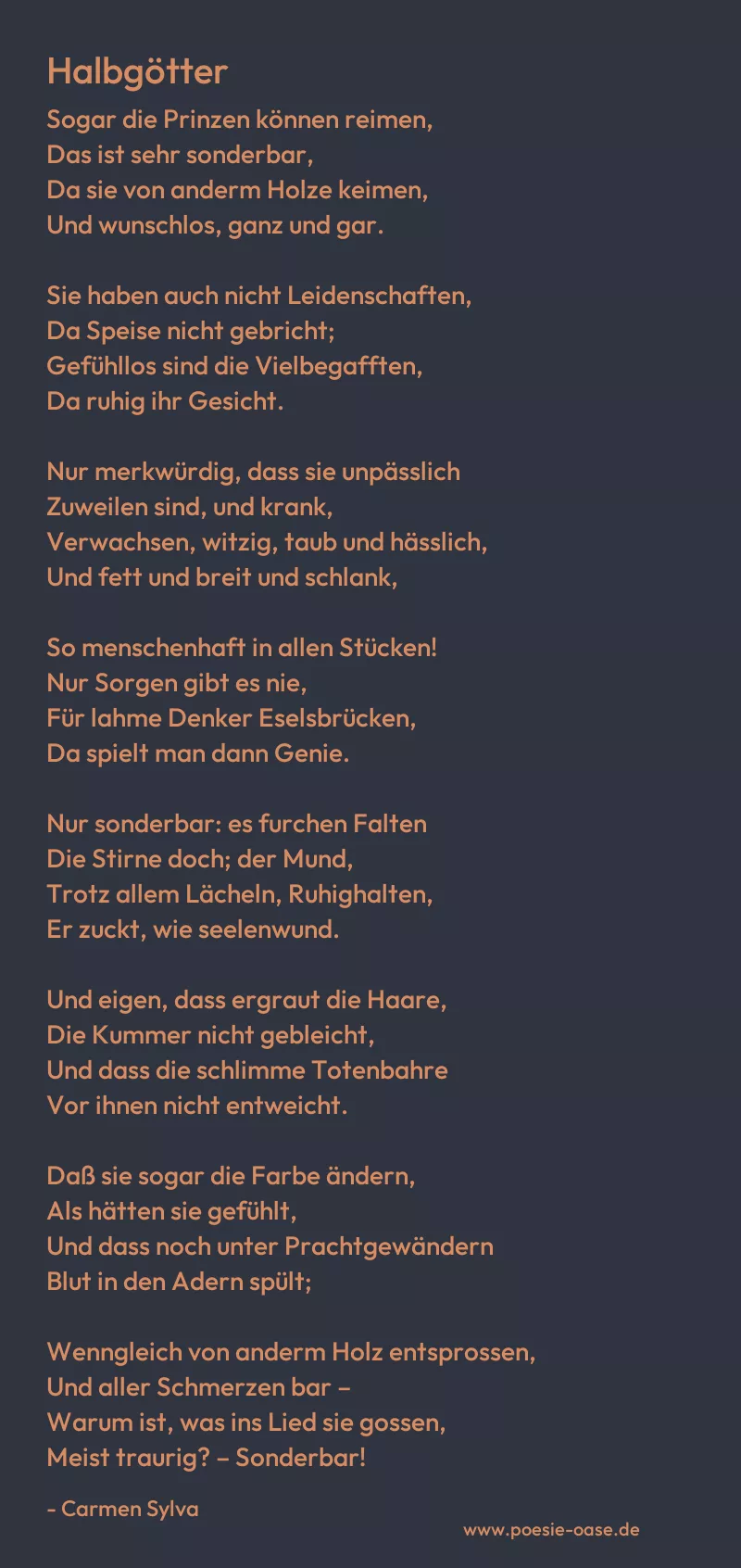
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Halbgötter“ von Carmen Sylva thematisiert die Diskrepanz zwischen dem idealisierten Bild von Prinzen und der menschlichen Realität, die auch sie nicht entbehren können. In der ersten Strophe stellt die Dichterin fest, dass selbst Prinzen reimen können, was an sich schon „sehr sonderbar“ ist, da sie doch von einem anderen „Holz“ zu kommen scheinen – also aus einer höheren, nahezu übermenschlichen Ebene. Der Gedanke, dass Prinzen „wunschlos, ganz und gar“ sind, verweist auf die Vorstellung, dass sie in ihrer privilegierten Stellung keine äußeren Sorgen oder Bedürfnisse haben sollten.
In den folgenden Strophen zeigt die Dichterin jedoch, dass dieser scheinbar perfekte Zustand in Wahrheit fehlerhaft ist. Prinzen sind nicht frei von „Leidenschaften“, da ihre äußeren Umstände – etwa das ständige Vorhandensein von Nahrung und Wohlstand – sie gefühllos und emotionslos machen. Ihre Gesichter bleiben „ruhig“, was auf eine gewisse Kälte und Unempfindlichkeit hinweist. Doch diese scheinbare Überlegenheit wird durch ihre „Unpässlichkeit“ und die „merkwürdigen“ physischen Mängel wie Krankheit und äußere Unregelmäßigkeiten relativiert. Dies spiegelt die Idee wider, dass auch sie letztlich nicht vor den Schwächen und Unvollkommenheiten des menschlichen Körpers gefeit sind.
Die dritte Strophe führt weiter aus, dass Prinzen zwar „genial“ wirken mögen, da sie aufgrund ihrer Position als „vielbegafft“ gelten, aber dennoch auch sie mit menschlichen Schwächen wie „lahme Denker Eselsbrücken“ und anderen Unsicherheiten kämpfen müssen. Ihre vermeintliche Perfektion wird immer wieder durch ihre „furchen Falten“ und den „Mund“, der trotz des Lächelns „zuckt wie seelenwund“, unterbrochen. Hier wird auf die Zerbrechlichkeit und die psychische Belastung hingewiesen, die auch die privilegiertesten Menschen betreffen können.
In der vierten Strophe betont die Dichterin, dass die Prinzen auch im Alter „ergrauen“ und dass der „Kummer“ nicht aus ihrem Leben verschwinden kann. Die „Totenbahre“ bleibt ihnen ebenso unausweichlich, was die Idee verstärkt, dass sie trotz ihres höheren Standes und ihrer prunkvollen Kleidung die gleichen Ängste und das gleiche Schicksal wie „normale“ Menschen erleiden. Die Prinzen, so wird hier gezeigt, sind „menschlich“ in all ihren Aspekten, trotz ihrer vermeintlichen Überlegenheit.
Die letzte Strophe stellt die Frage nach dem Ursprung der melancholischen „Lieder“ und „Traurigkeit“, die trotz des äußeren Glanzes in den Herzen der Prinzen wohnen. Die Dichterin fragt sich, warum die „Prachtgewänder“ der Prinzen sie nicht vor der menschlichen Erfahrung von Leid und Trauer schützen können. Die Antwort bleibt offen, aber das Gedicht deutet darauf hin, dass das, was an menschlicher Erfahrung in die Welt der Prinzen eindringt, sich unvermeidlich in ihren „Liedern“ und ihrem Wesen widerspiegelt.
Carmen Sylva beleuchtet in diesem Gedicht auf eine subtile Weise die Unvollkommenheit und die menschliche Verwundbarkeit von Menschen, die scheinbar in einer höheren Position stehen. Es ist eine kritische Reflexion über den Gegensatz zwischen äußeren Privilegien und inneren menschlichen Erfahrungen von Schmerz, Alter und Verlust.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.