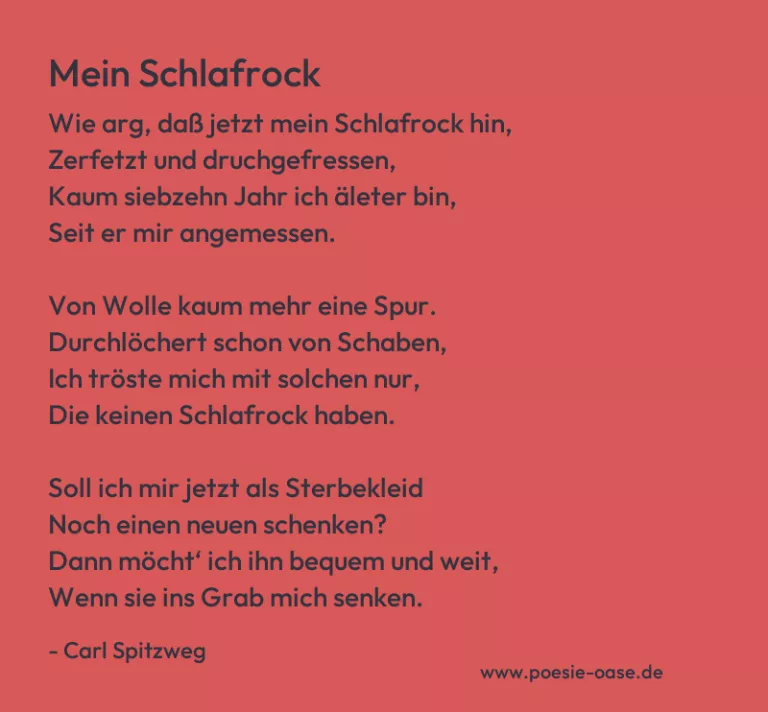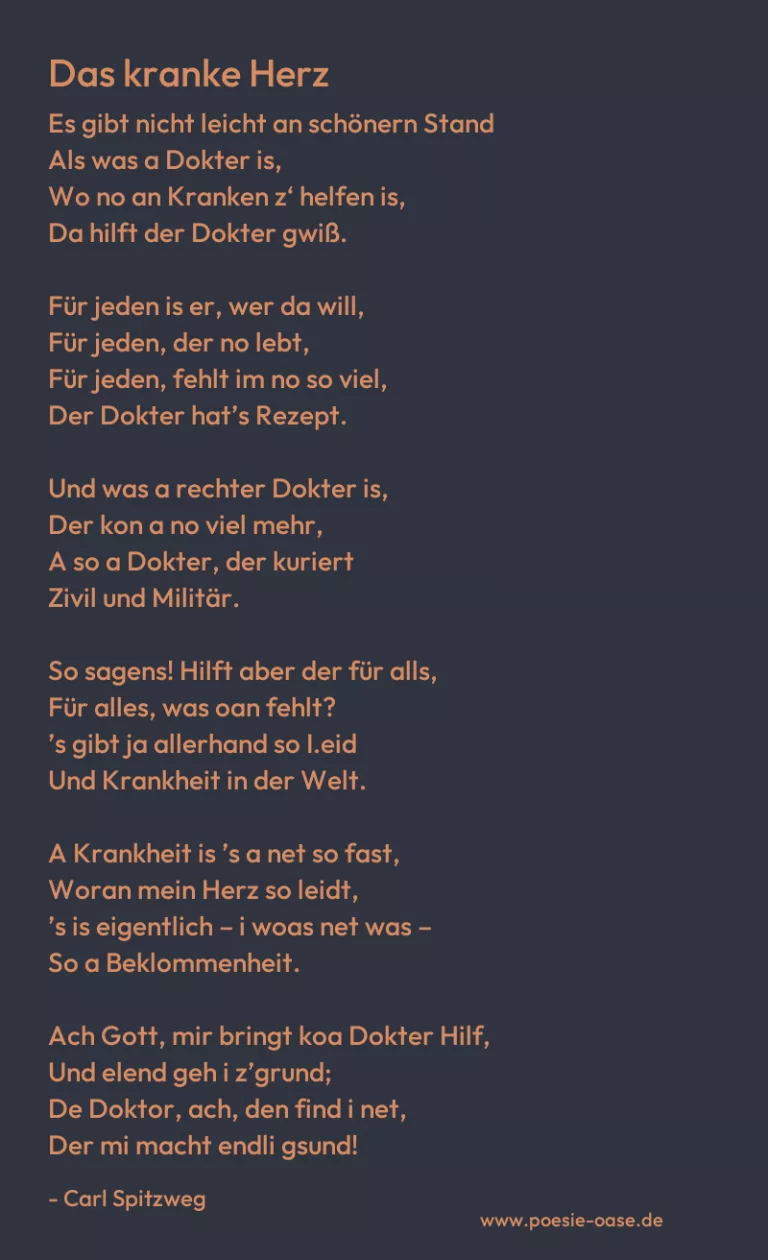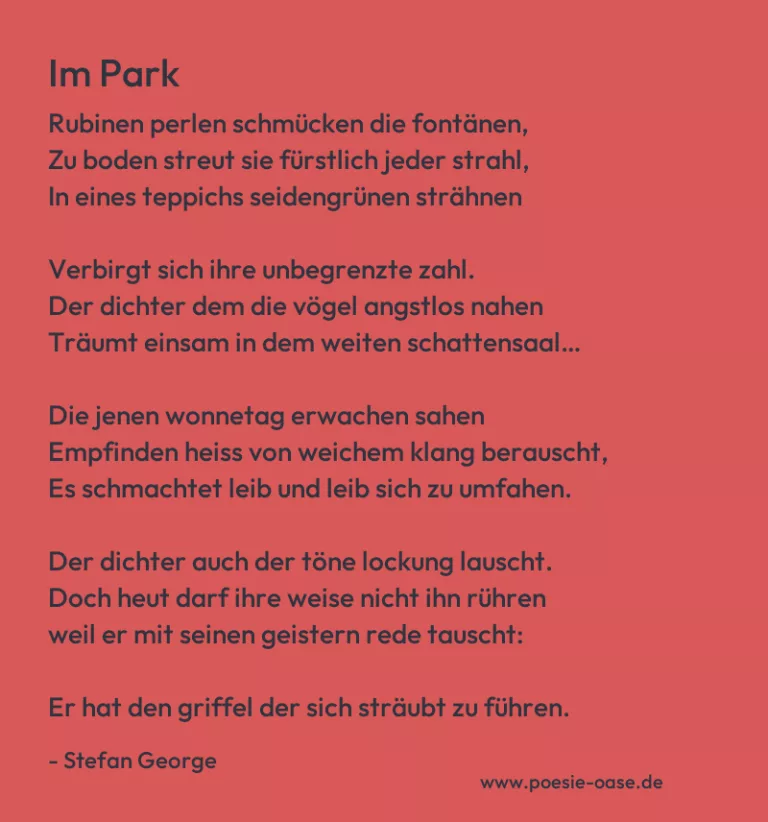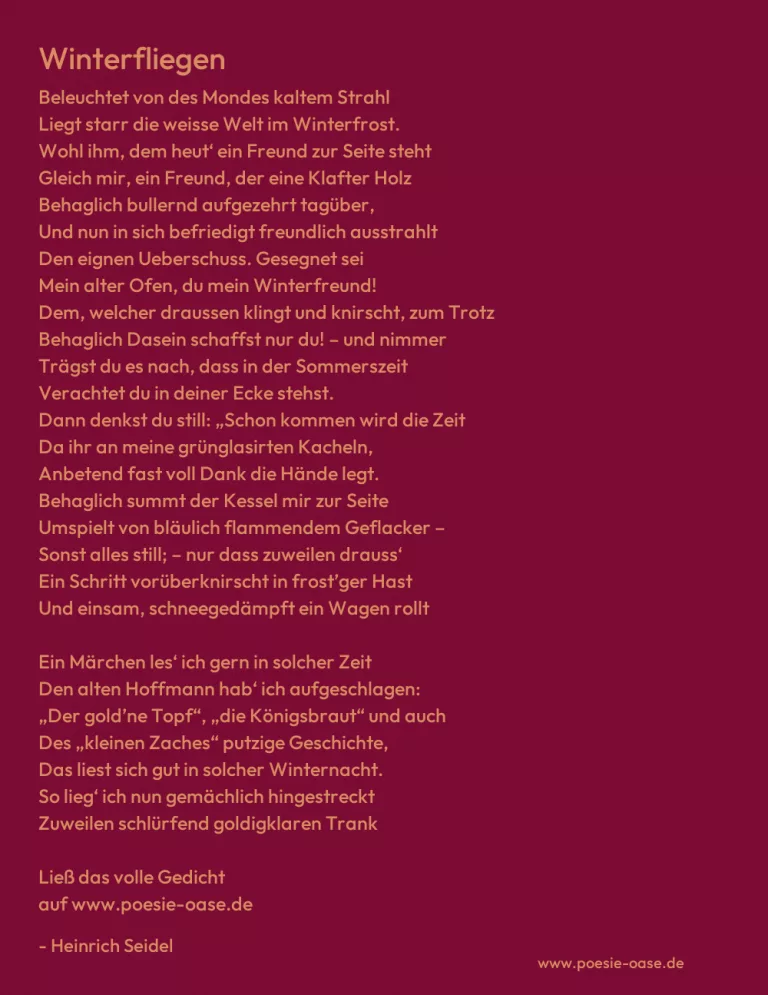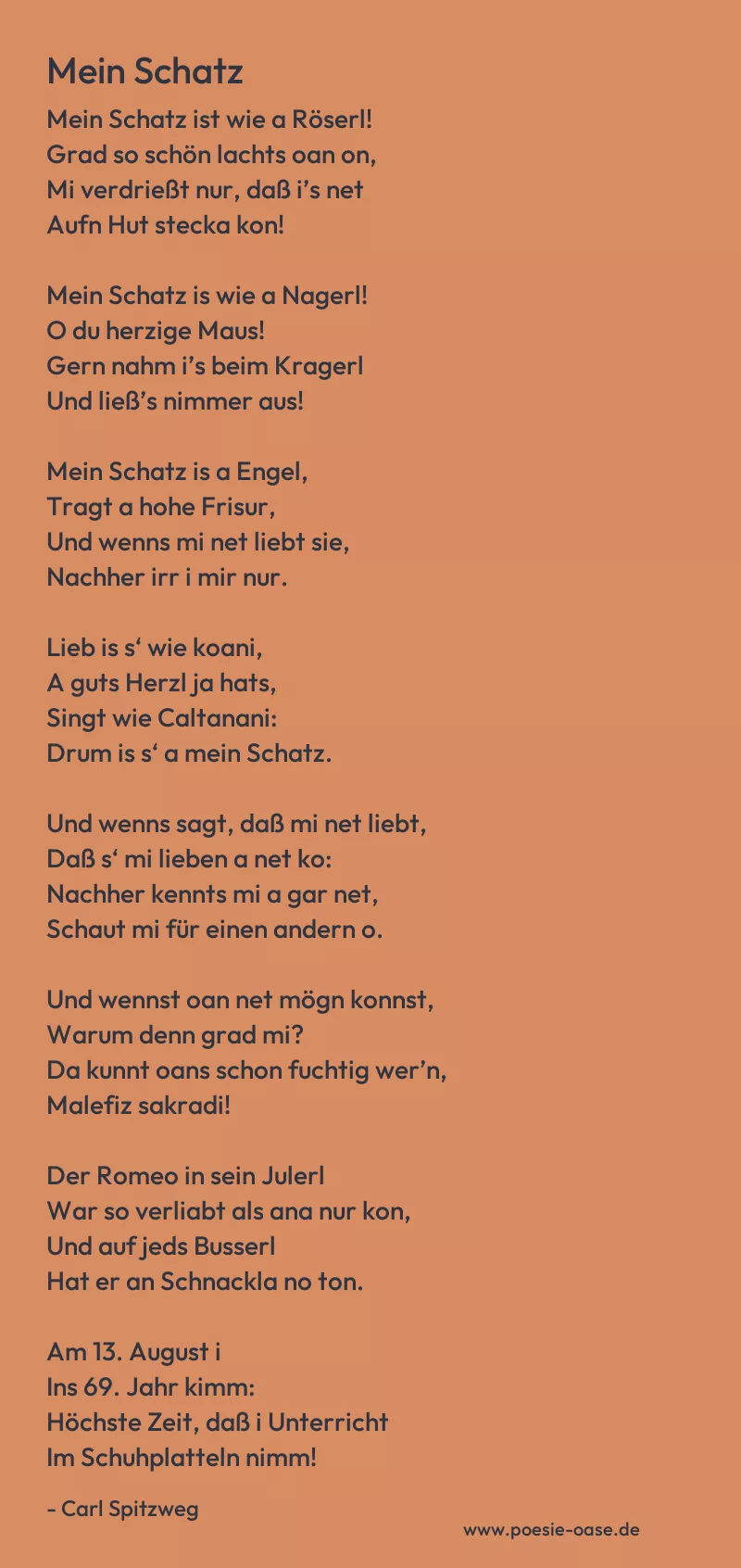Mein Schatz ist wie a Röserl!
Grad so schön lachts oan on,
Mi verdrießt nur, daß i’s net
Aufn Hut stecka kon!
Mein Schatz is wie a Nagerl!
O du herzige Maus!
Gern nahm i’s beim Kragerl
Und ließ’s nimmer aus!
Mein Schatz is a Engel,
Tragt a hohe Frisur,
Und wenns mi net liebt sie,
Nachher irr i mir nur.
Lieb is s‘ wie koani,
A guts Herzl ja hats,
Singt wie Caltanani:
Drum is s‘ a mein Schatz.
Und wenns sagt, daß mi net liebt,
Daß s‘ mi lieben a net ko:
Nachher kennts mi a gar net,
Schaut mi für einen andern o.
Und wennst oan net mögn konnst,
Warum denn grad mi?
Da kunnt oans schon fuchtig wer’n,
Malefiz sakradi!
Der Romeo in sein Julerl
War so verliabt als ana nur kon,
Und auf jeds Busserl
Hat er an Schnackla no ton.
Am 13. August i
Ins 69. Jahr kimm:
Höchste Zeit, daß i Unterricht
Im Schuhplatteln nimm!