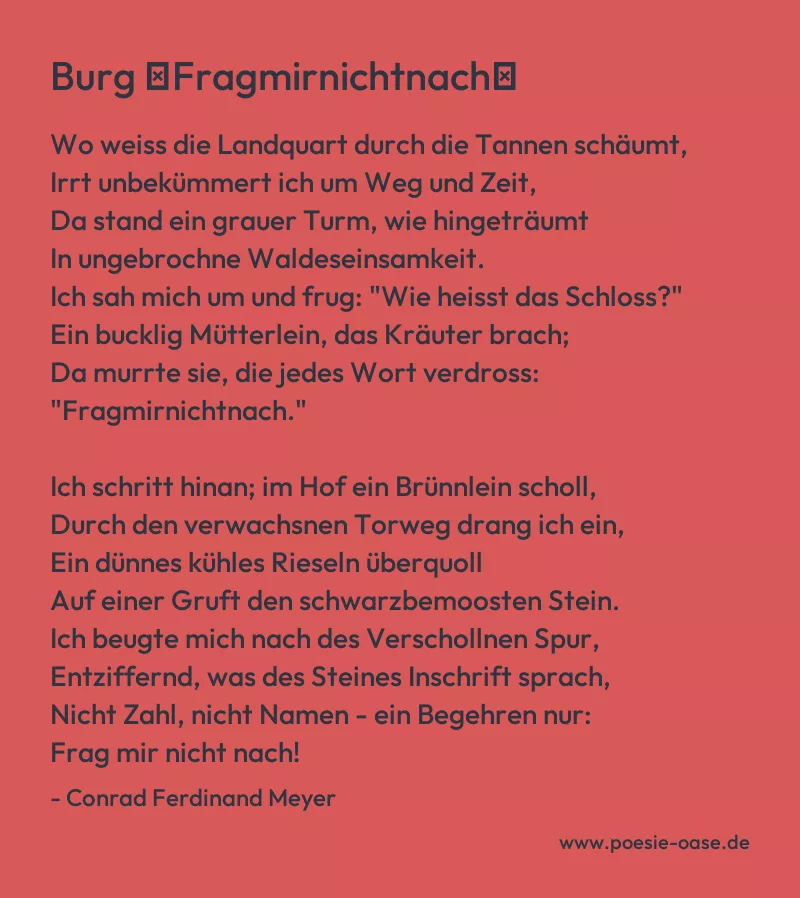Burg ′Fragmirnichtnach′
Wo weiss die Landquart durch die Tannen schäumt,
Irrt unbekümmert ich um Weg und Zeit,
Da stand ein grauer Turm, wie hingeträumt
In ungebrochne Waldeseinsamkeit.
Ich sah mich um und frug: „Wie heisst das Schloss?“
Ein bucklig Mütterlein, das Kräuter brach;
Da murrte sie, die jedes Wort verdross:
„Fragmirnichtnach.“
Ich schritt hinan; im Hof ein Brünnlein scholl,
Durch den verwachsnen Torweg drang ich ein,
Ein dünnes kühles Rieseln überquoll
Auf einer Gruft den schwarzbemoosten Stein.
Ich beugte mich nach des Verschollnen Spur,
Entziffernd, was des Steines Inschrift sprach,
Nicht Zahl, nicht Namen – ein Begehren nur:
Frag mir nicht nach!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
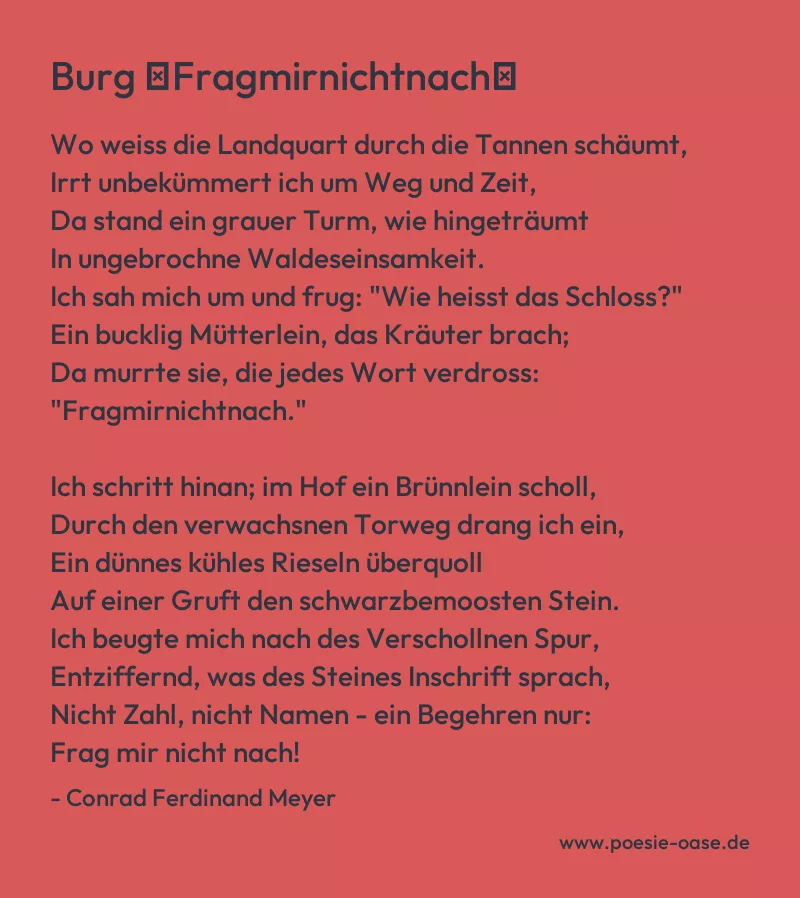
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Burg ′Fragmirnichtnach′“ von Conrad Ferdinand Meyer ist eine eindringliche Auseinandersetzung mit der menschlichen Neugier und dem Geheimnisvollen. Es beschreibt die Begegnung eines lyrischen Ichs mit einer verlassenen Burg und den Menschen, die mit ihr verbunden sind. Die zentrale Metapher ist das „Fragmirnichtnach“, das zum Titel des Gedichts wird und die zentrale Botschaft verkörpert.
Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung der malerischen Umgebung: Die Landquart rauscht durch die Tannen, das lyrische Ich verirrt sich in der Zeit. Die Burg erscheint wie eine Vision, eingebettet in die unberührte Natur. Die Frage nach dem Namen des Schlosses wird von einer alten Frau mit der trotzigen Antwort „Fragmirnichtnach“ beantwortet. Diese erste Begegnung etabliert sofort die Atmosphäre des Geheimnisvollen und des Widerstands gegen das Wissen.
Im zweiten Teil des Gedichts dringt das lyrische Ich in die Burg ein, wo es auf einen Brunnen und einen Friedhof trifft. Das kalte Rieseln des Wassers über dem Grabstein erzeugt eine beklemmende Stimmung. Die Suche nach der Inschrift führt zu keiner Antwort, sondern nur zu dem Verlangen „Frag mir nicht nach!“. Dieser Schluss verstärkt das Gefühl der Geheimhaltung und der Abweisung jeglicher Fragen. Die Burg wird somit zu einem Symbol für die Vergangenheit, das Unbekannte und die Grenzen des menschlichen Wissens.
Meyer nutzt in diesem Gedicht eine klare und prägnante Sprache. Die Bilder sind anschaulich und erzeugen eine starke visuelle Wirkung. Die Verwendung des Reimschemas und des rhythmischen Aufbaus verstärkt die Sogwirkung des Gedichts und unterstreicht die zentrale Botschaft. „Fragmirnichtnach“ wird zu einem Leitthema, das die Neugier des lyrischen Ichs und die Grenzen des menschlichen Erkenntnisstrebens reflektiert. Das Gedicht hinterfragt letztendlich die Natur unserer Fragen und die Akzeptanz von Geheimnissen im Leben.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.