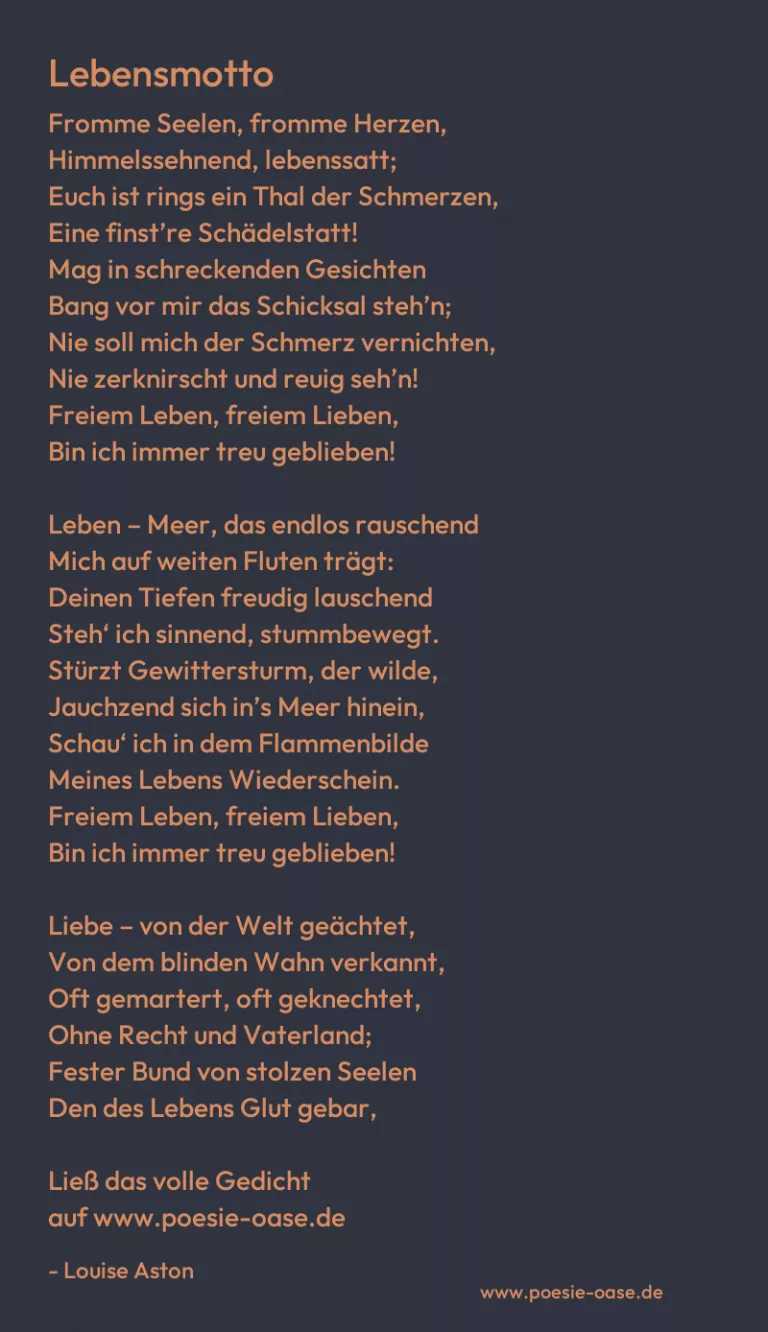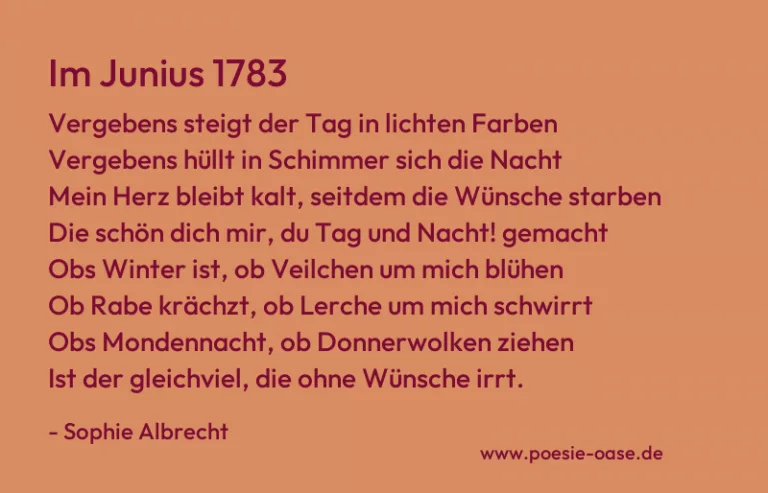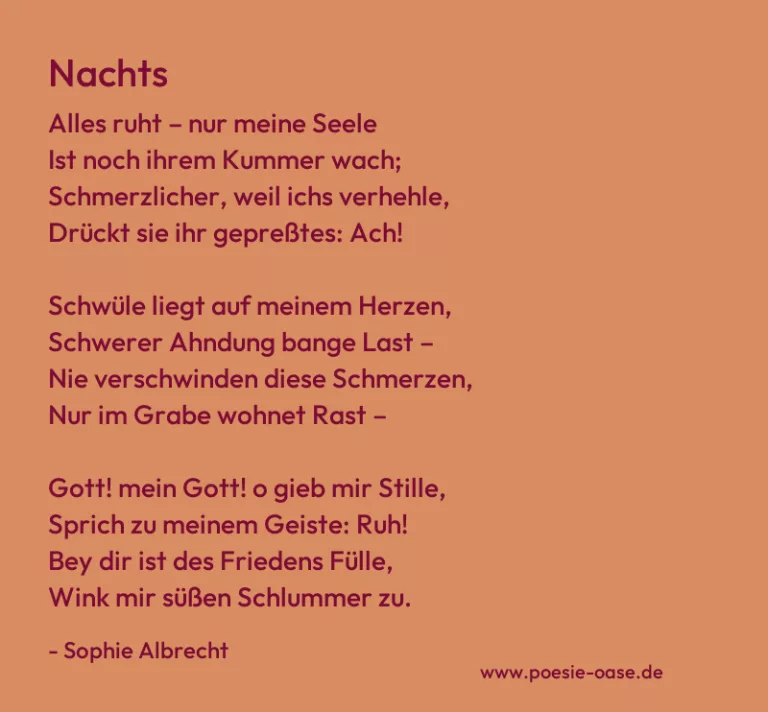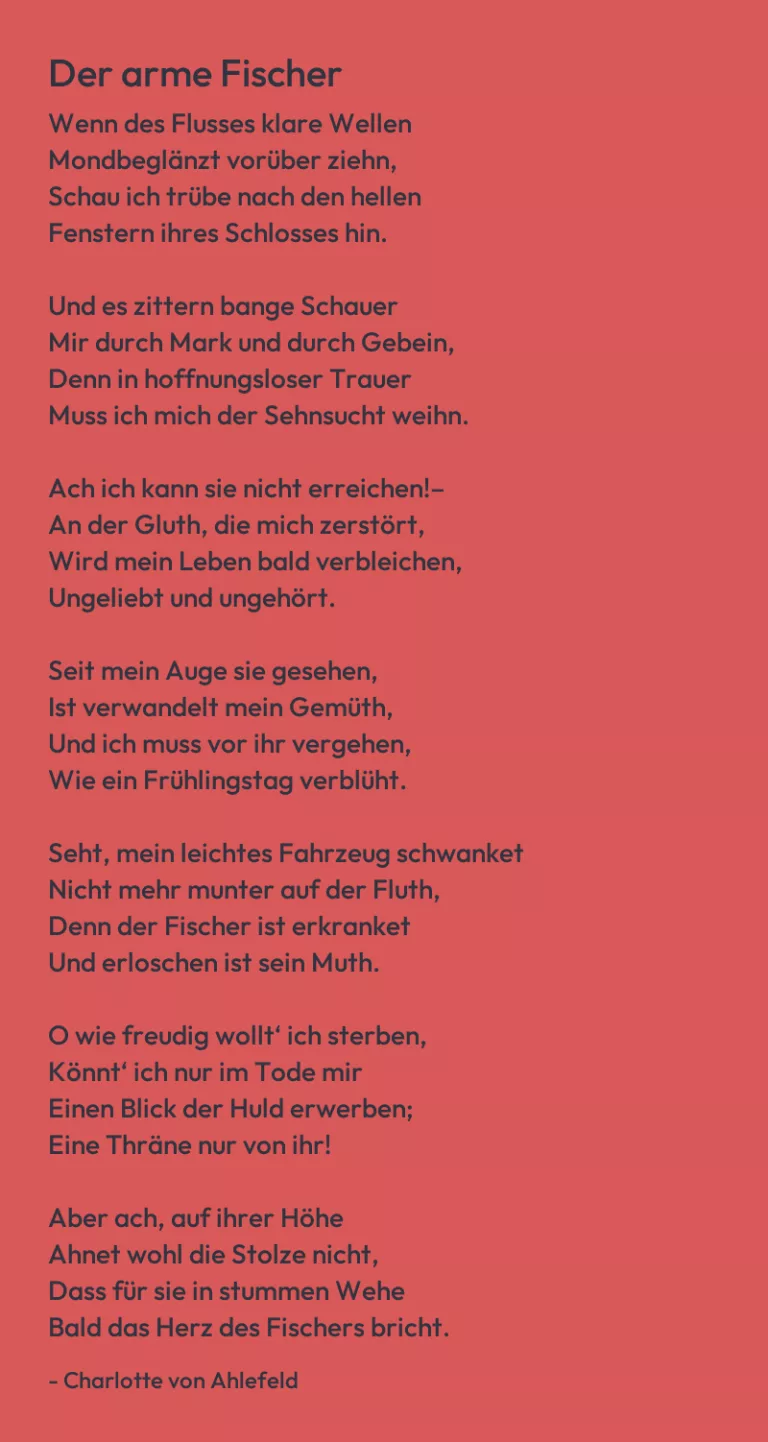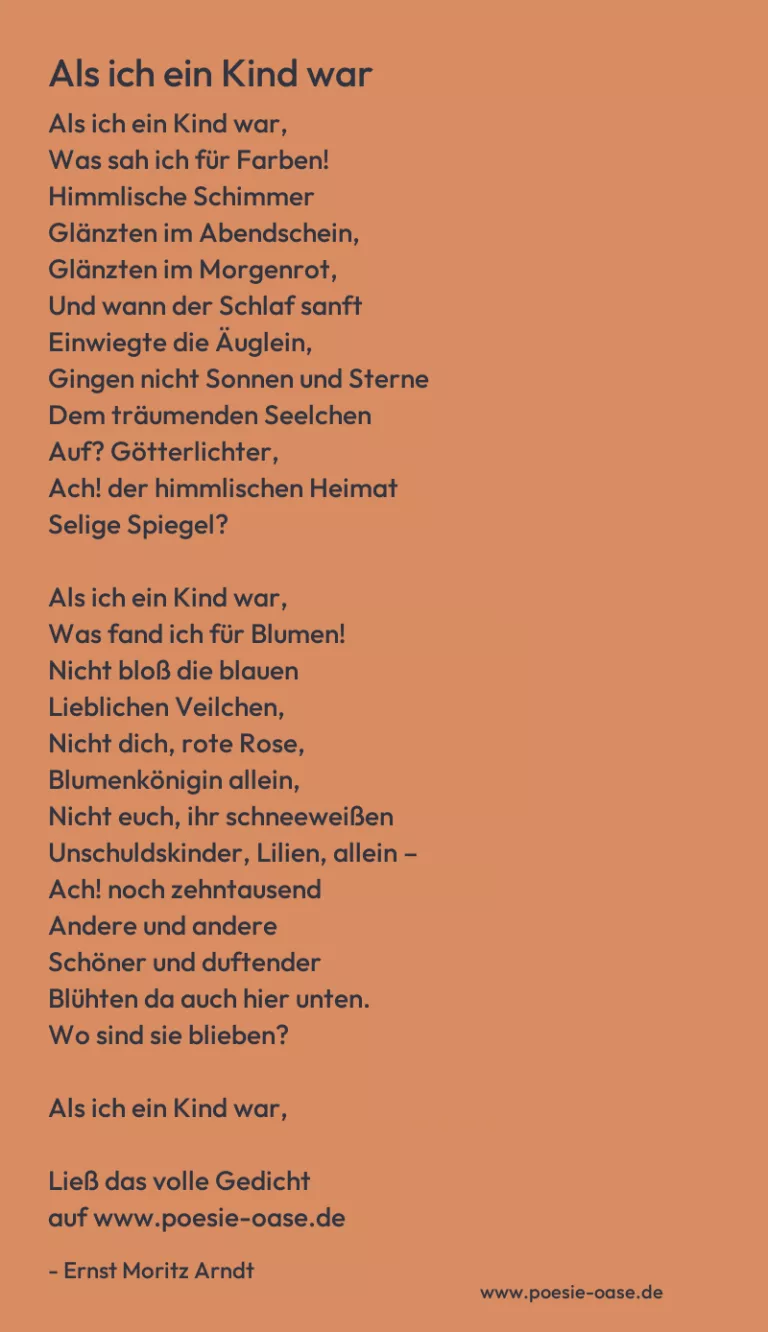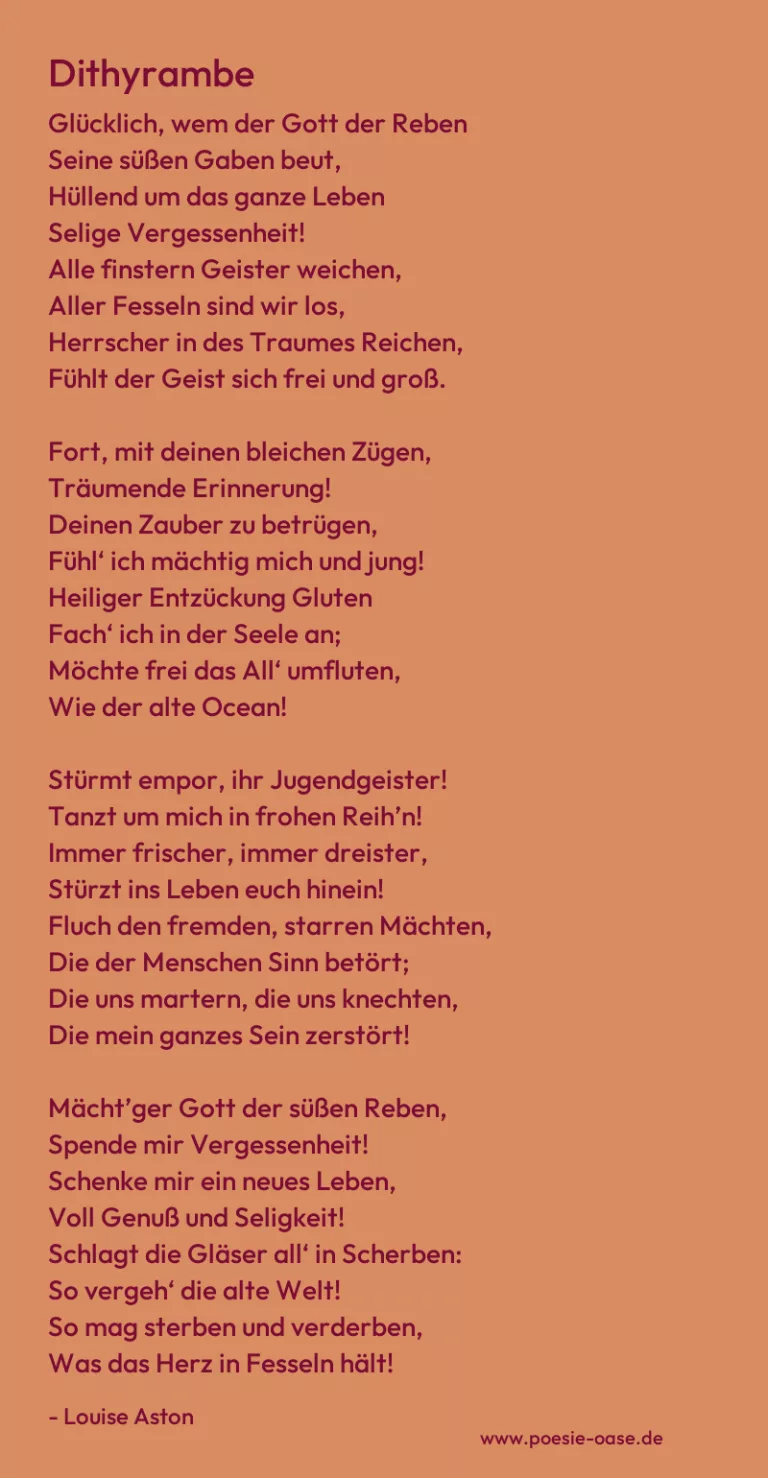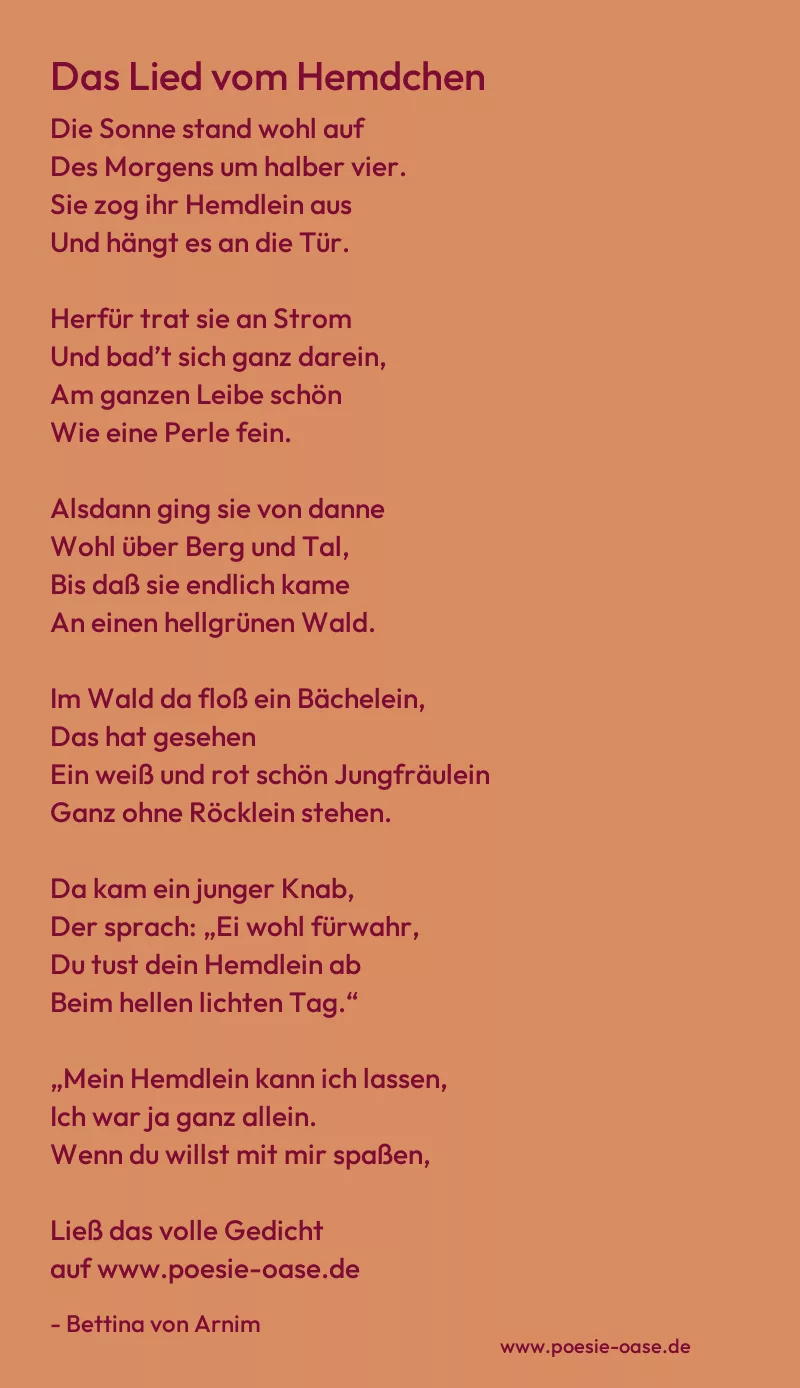Die Sonne stand wohl auf
Des Morgens um halber vier.
Sie zog ihr Hemdlein aus
Und hängt es an die Tür.
Herfür trat sie an Strom
Und bad’t sich ganz darein,
Am ganzen Leibe schön
Wie eine Perle fein.
Alsdann ging sie von danne
Wohl über Berg und Tal,
Bis daß sie endlich kame
An einen hellgrünen Wald.
Im Wald da floß ein Bächelein,
Das hat gesehen
Ein weiß und rot schön Jungfräulein
Ganz ohne Röcklein stehen.
Da kam ein junger Knab,
Der sprach: „Ei wohl fürwahr,
Du tust dein Hemdlein ab
Beim hellen lichten Tag.“
„Mein Hemdlein kann ich lassen,
Ich war ja ganz allein.
Wenn du willst mit mir spaßen,
Nehm ich mein Hemdelein.“
„Dein Leben will ich dir nehmen“,
So sprach der junge Knab,
„Du sollst mir nimmer buhlen
Wohl mit dem jungen Tag.
Ich halt dich mit den Händen,
Drück tot dein Herzelein,
Daß du magst nimmer wenden
Die Augen zum klaren Schein.“
Als dies die Sonne tat schauen,
Da eilt sie schnell davon
Wohl über Berg und Täler,
Bis sie nach Hause kam.
Sie hängt ihr Hemdelein ab,
Sie hängt ihr Hemdelein um,
Daß wenn mein junger Buhler kommt,
Mich nimmer bringet um.
Nun liegt die Sach ganz klar am Tag,
Die Welt ist Nebels voll,
Kein Kraut, kein Wein geraten mag,
Die Jungfern wissen’s wohl.