Dämmerläuten schüttet in den veilchenblauen Abend
weiße Blütenflocken. Kleine Flocken
blank wie Muschelperlen rieseln· tanzen·
schwärmen weich wie dünne blasse Daunen·
wirbelnd· wölkend. Schwere Blütenbäume
streuen goldne Garben. Wilde Gärten
tragen mich in blaue Wundernächte·
große wilde Gärten. Tiefe Beete
schwanken brennend auf· wie Traumgewässer
still und spiegelnd. Silberkähne heben
mich von braunen Uferwiesen
in das Leuchten. Über Scharlachfluten
dunklen Mohns· der rot in Flammensäulen
züngelt· treibt der Nachen. Bleiche Lilien
tropfen schillernd drüberhin wie Wellen.
Düfte aus kristallnen Nächten tauchend·
schlingen wirr und hängen sich ins Haar·
und sie locken . . leise· leise . .
und die grünen klaren Tiefen flimmern . .
Purpurstrahlen schießen . . leise sink ich . .
süß umfängt mich müder Laut von Geigen . .
schwingt· sinkt· gleitende Paläste
funkeln fern. Licht stürzt
über mich. Weit· grün
schwebt ein Glänzen . .
Beata Beatrix
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
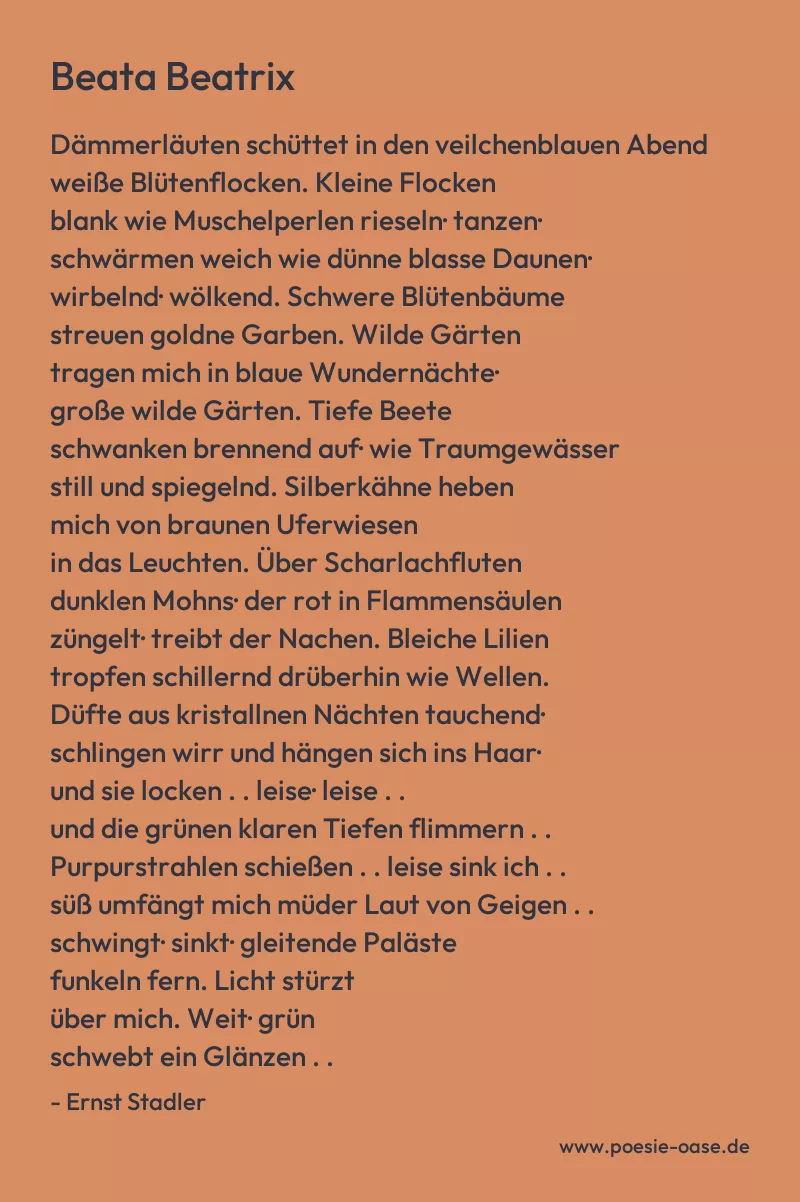
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Beata Beatrix“ von Ernst Stadler ist eine impressionistische Evokation einer mystischen Erfahrung, möglicherweise einer Ekstase oder eines Traumes, die von einer intensiven Sinnlichkeit geprägt ist. Der Titel verweist auf Dante Gabriel Rossettis Gemälde, das Beatrix, Dantes Muse, nach ihrem Tod darstellt. Stadlers Gedicht greift die Thematik der Transzendenz und des Übernatürlichen auf, indem es eine Welt voller Farben, Düfte und Geräusche erschafft, die das Bewusstsein des Sprechers umhüllen und in einen Zustand der Auflösung und des Glücks versetzen.
Die ersten Zeilen beschreiben eine Atmosphäre der Abenddämmerung, die von einem sanften, fast zeremoniellen Charakter ist. Die Bilder von „veilchenblauen Abenden“, „weißen Blütenflocken“ und „goldnen Garben“ erzeugen eine Atmosphäre der Ruhe und Schönheit. Die Verwendung von Adjektiven wie „weich“, „blass“, „silberkähn“ und „kristallnen“ verstärkt den Eindruck von Zerbrechlichkeit und Transparenz, die sich durch das gesamte Gedicht zieht. Die Natur wird hier nicht als statische Kulisse, sondern als aktiver Teilnehmer an der Erfahrung dargestellt. Sie „schüttet“, „rieselt“, „schwärmt“ und „trägt“ den Sprecher in tiefere Bereiche.
Im weiteren Verlauf des Gedichts intensiviert sich die sinnliche Erfahrung. Die Farben werden lebendiger, die Düfte intensiver. Bilder wie „Scharlachfluten“ und „purpurstrahlen“ deuten auf ein aufsteigendes Gefühl von Leidenschaft und Ekstase. Die Erwähnung von „Mohn“ und „Lilien“ – beides Symbolen für Tod und Reinheit – verstärkt die ambivalente Natur der Erfahrung. Das Gedicht oszilliert zwischen sinnlicher Wahrnehmung und einer Ahnung des Übersinnlichen. Der Sprecher befindet sich in einem Zustand des Übergangs, in dem er sich der Auflösung seines Selbst nähert, während er gleichzeitig von einer überwältigenden Schönheit und Freude erfasst wird.
Die letzten Zeilen des Gedichts kulminieren in einem Gefühl der Hingabe und des Verlusts. Die „Purpurstrahlen“ und „müden Laut von Geigen“ deuten auf einen Zustand des Unbewusstseins oder des Todes. Das „Licht“, das „über“ den Sprecher „stürzt“, könnte als Metapher für die göttliche Gnade oder das Auflösen des Selbst in einem transzendenten Bereich interpretiert werden. Das „grüne Glänzen“ am Ende könnte ein Zeichen für das Erreichen einer neuen Ebene der Existenz sein, möglicherweise ein Paradies oder ein Zustand der Erleuchtung. Das Gedicht ist somit eine poetische Reflexion über die menschliche Sehnsucht nach Transzendenz und die Erfahrung der Mystik.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
