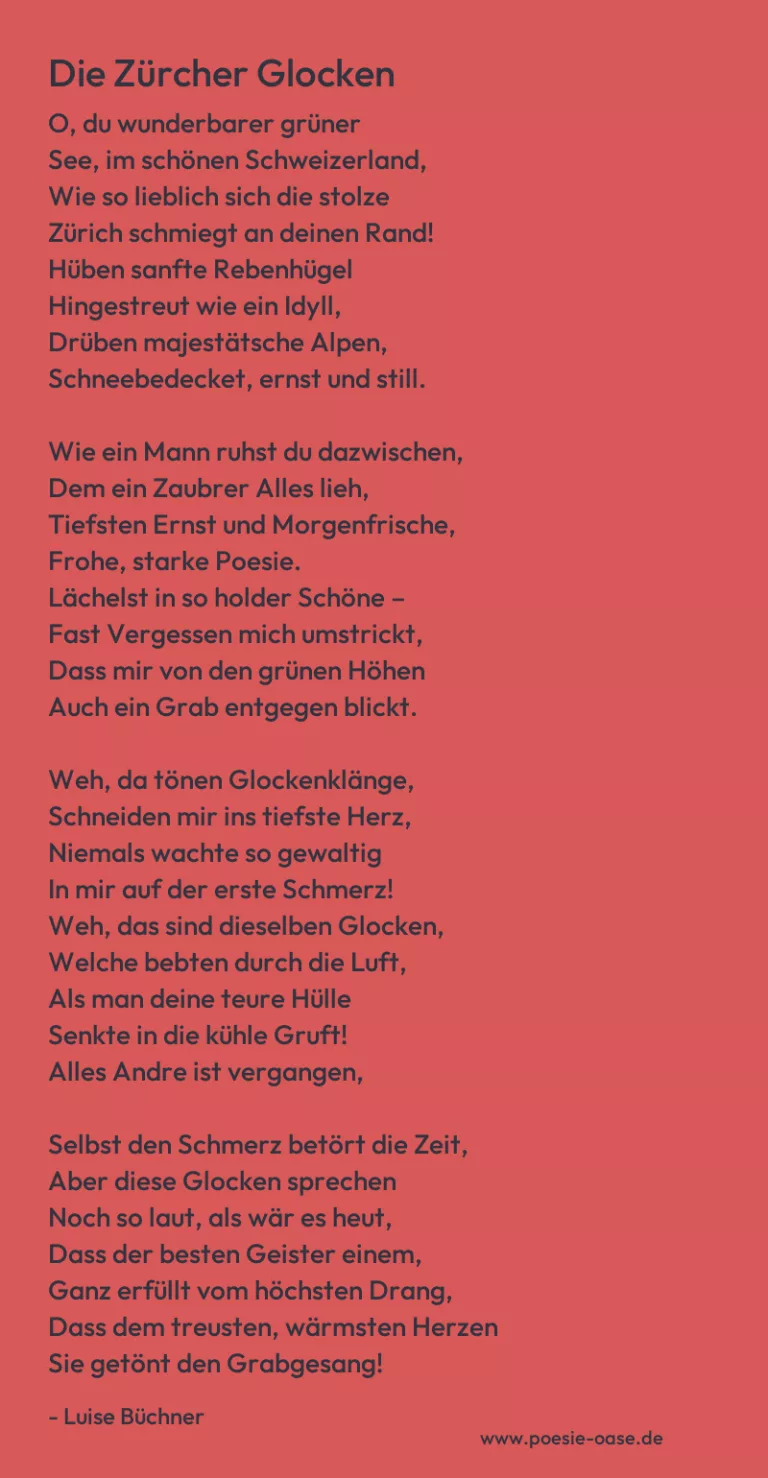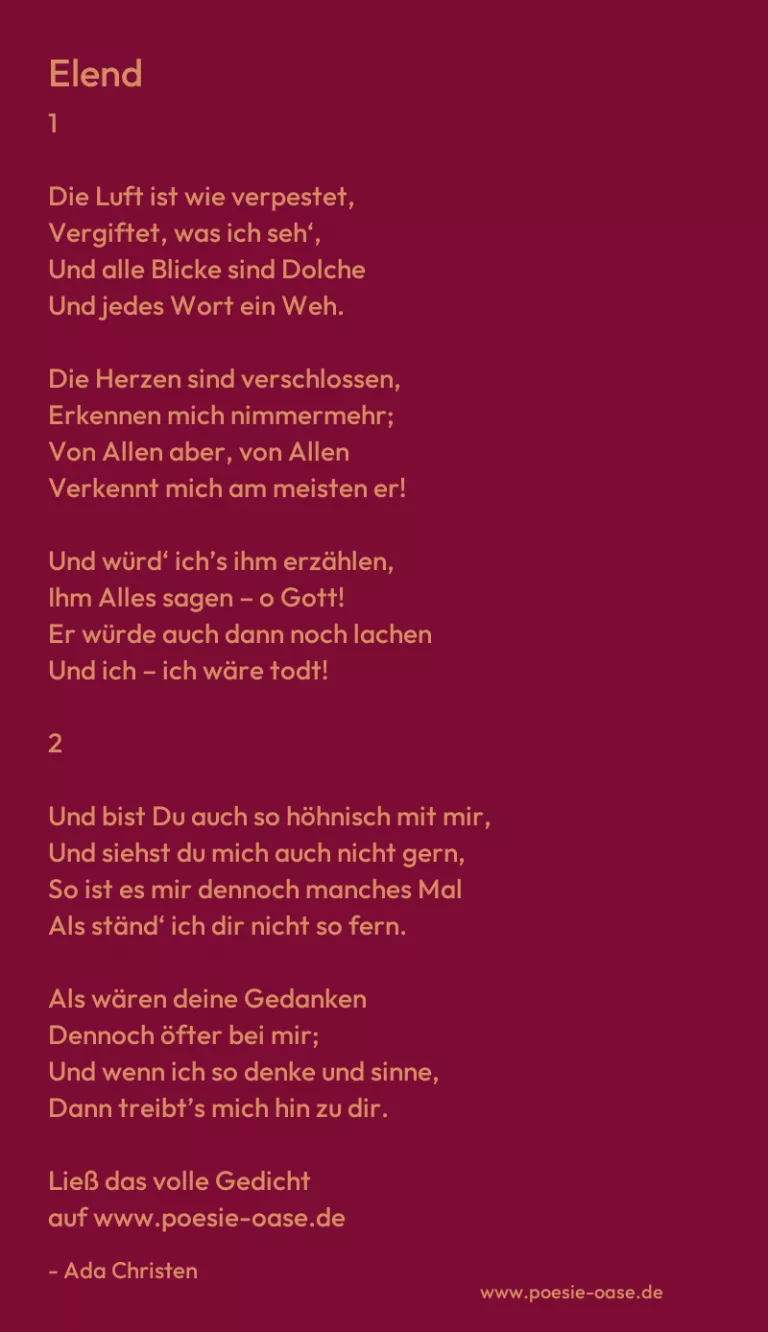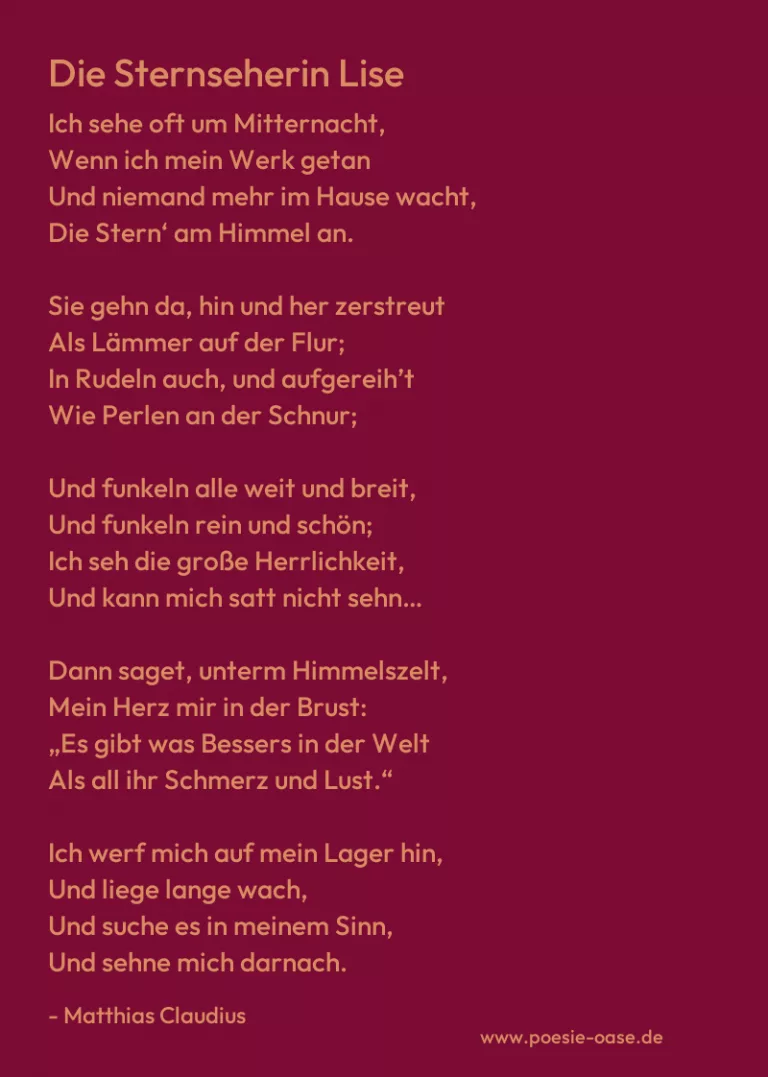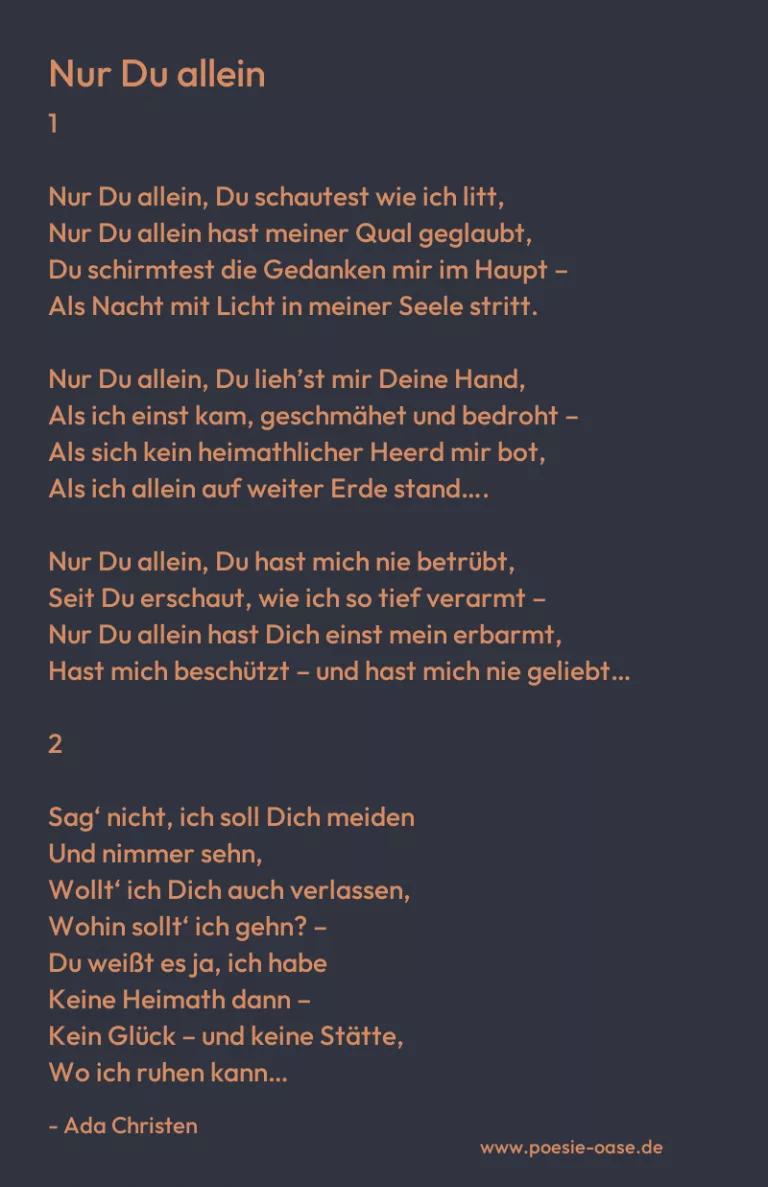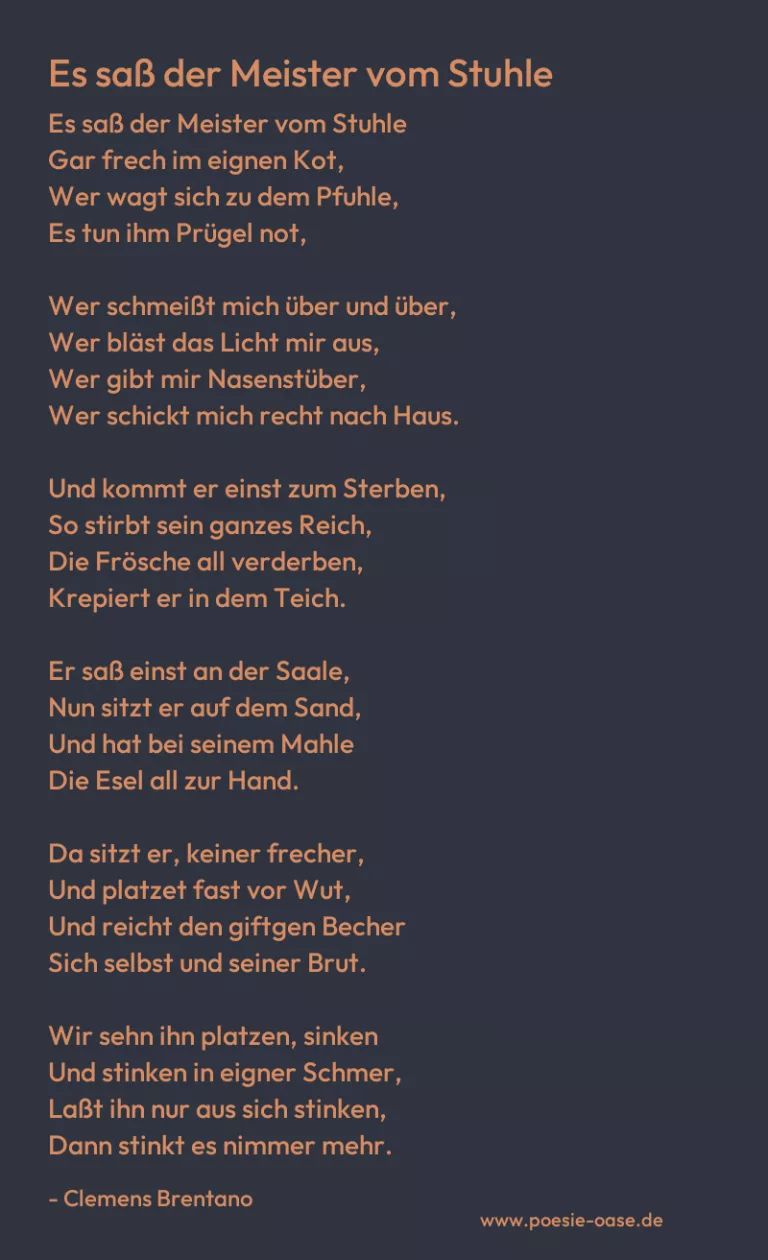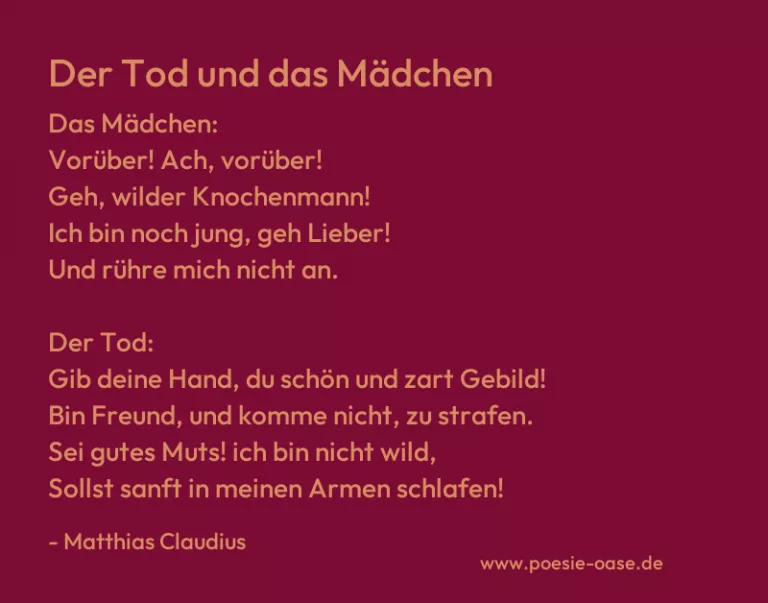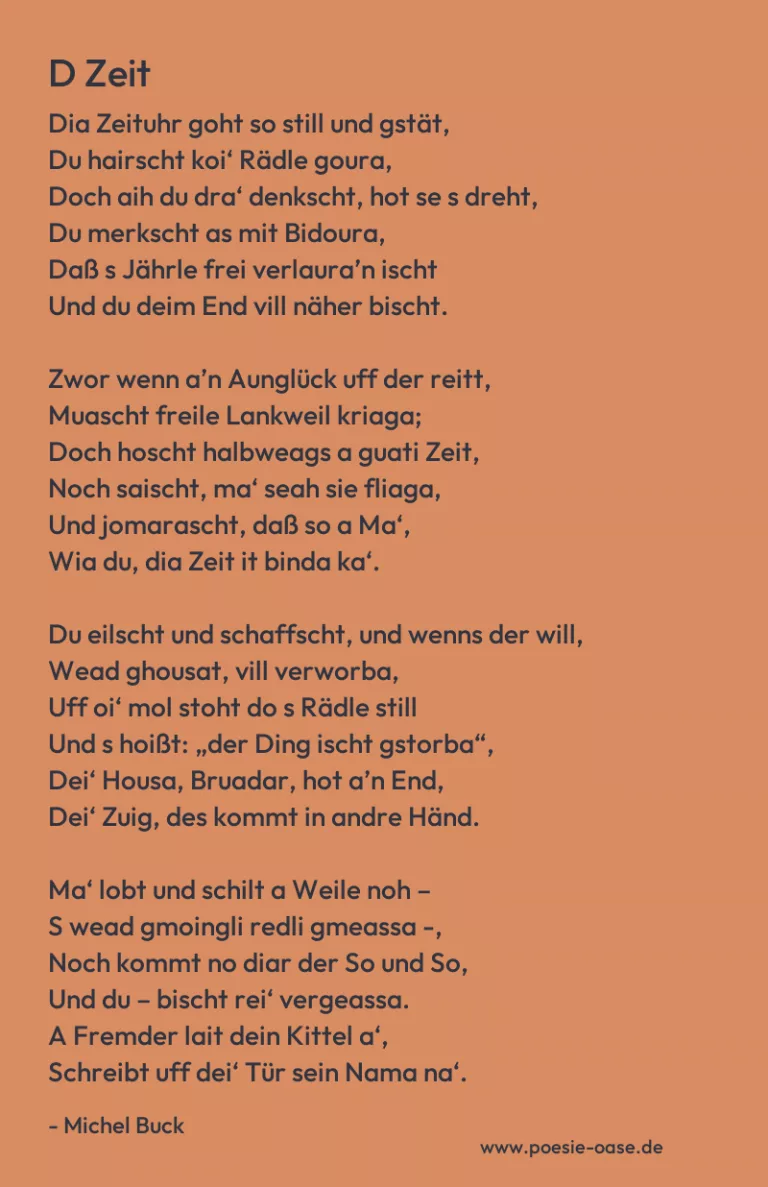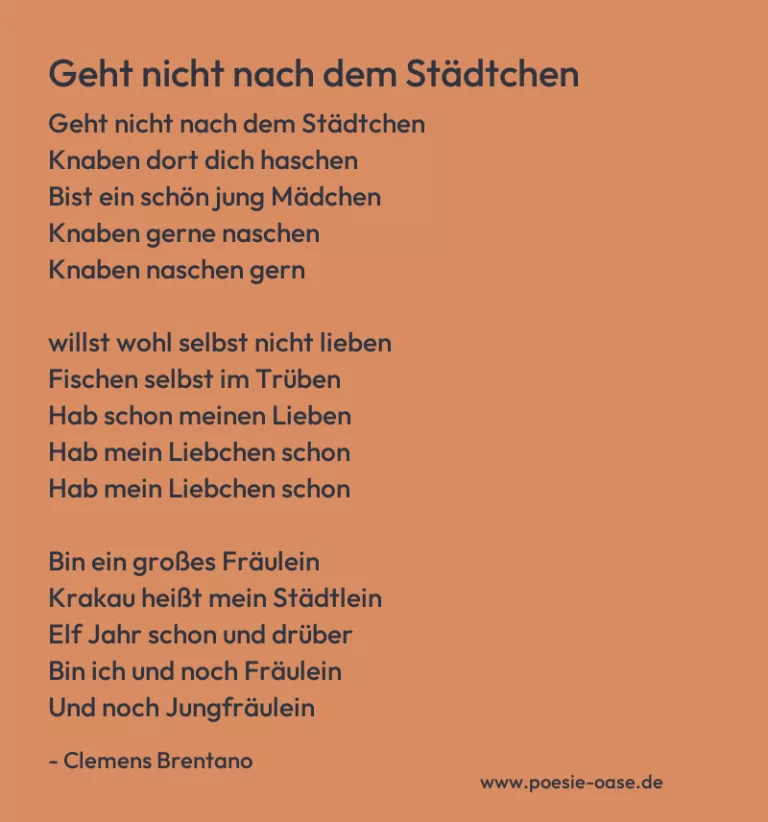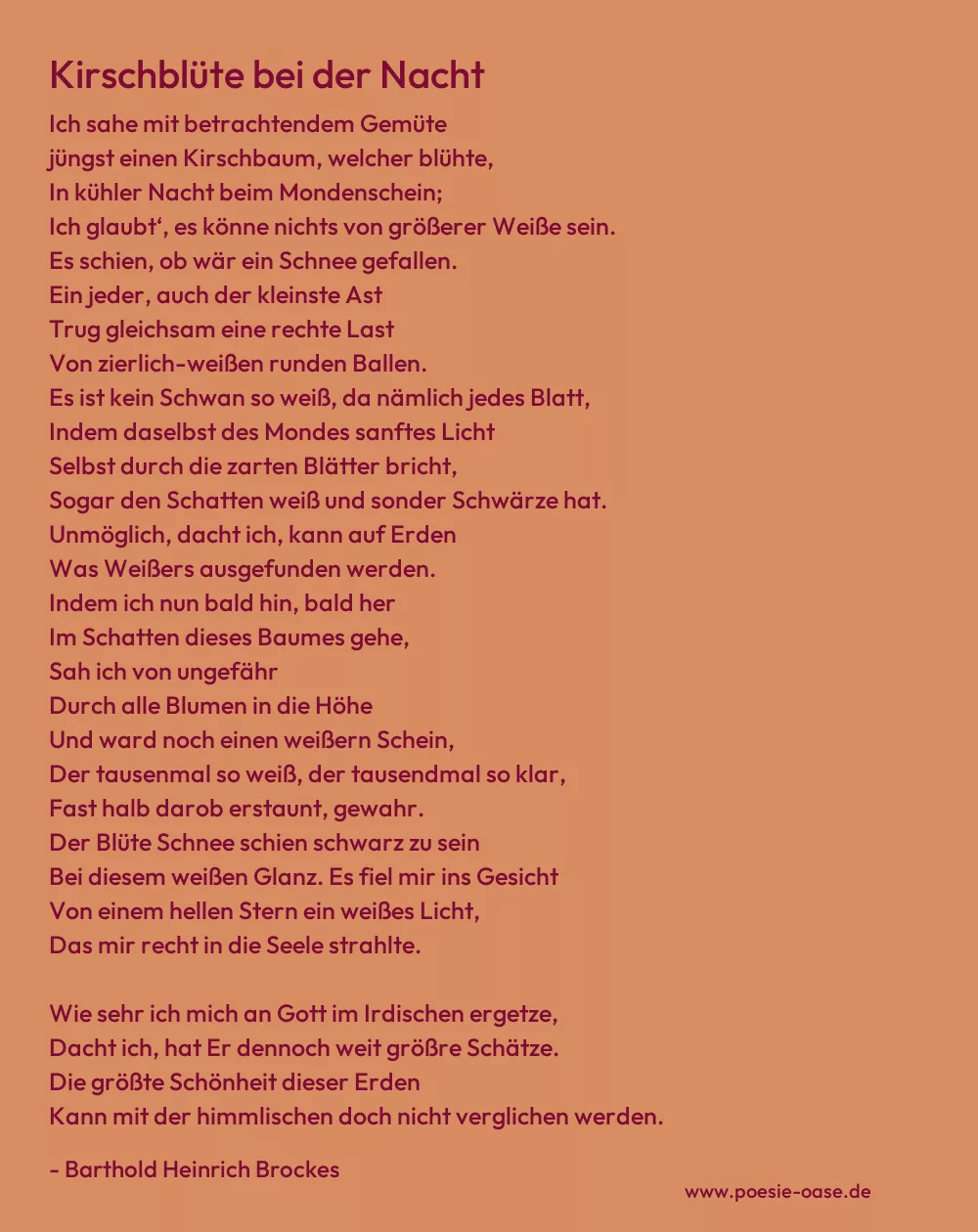Angst, Feiern, Frühling, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Harmonie, Himmel & Wolken, Hoffnung, Liebe & Romantik, Natur, Religion, Unschuld, Winter
Kirschblüte bei der Nacht
Ich sahe mit betrachtendem Gemüte
jüngst einen Kirschbaum, welcher blühte,
In kühler Nacht beim Mondenschein;
Ich glaubt‘, es könne nichts von größerer Weiße sein.
Es schien, ob wär ein Schnee gefallen.
Ein jeder, auch der kleinste Ast
Trug gleichsam eine rechte Last
Von zierlich-weißen runden Ballen.
Es ist kein Schwan so weiß, da nämlich jedes Blatt,
Indem daselbst des Mondes sanftes Licht
Selbst durch die zarten Blätter bricht,
Sogar den Schatten weiß und sonder Schwärze hat.
Unmöglich, dacht ich, kann auf Erden
Was Weißers ausgefunden werden.
Indem ich nun bald hin, bald her
Im Schatten dieses Baumes gehe,
Sah ich von ungefähr
Durch alle Blumen in die Höhe
Und ward noch einen weißern Schein,
Der tausenmal so weiß, der tausendmal so klar,
Fast halb darob erstaunt, gewahr.
Der Blüte Schnee schien schwarz zu sein
Bei diesem weißen Glanz. Es fiel mir ins Gesicht
Von einem hellen Stern ein weißes Licht,
Das mir recht in die Seele strahlte.
Wie sehr ich mich an Gott im Irdischen ergetze,
Dacht ich, hat Er dennoch weit größre Schätze.
Die größte Schönheit dieser Erden
Kann mit der himmlischen doch nicht verglichen werden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
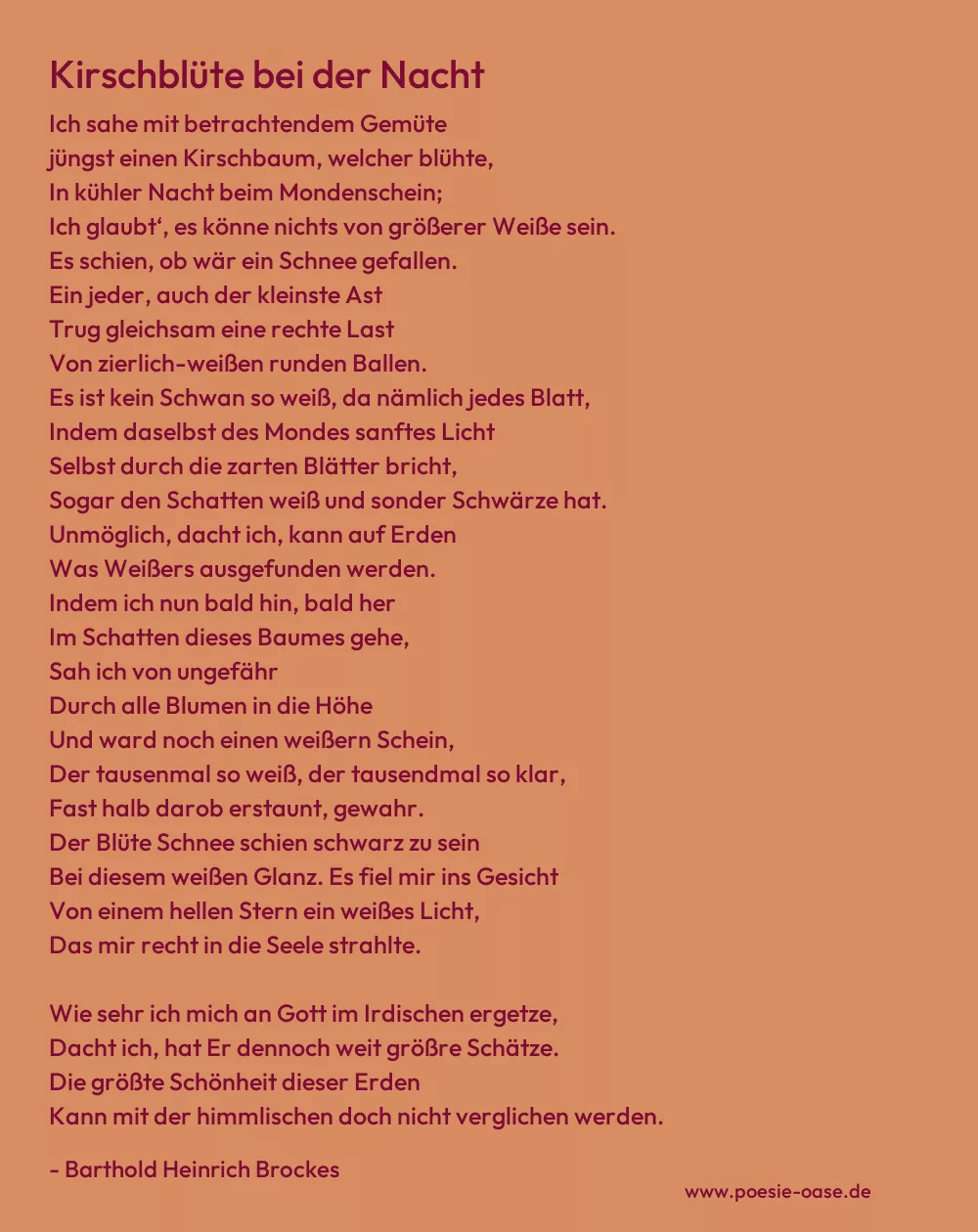
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Kirschblüte bei der Nacht“ von Barthold Heinrich Brockes ist eine kontemplative Naturbetrachtung, die sich zu einer spirituellen Erkenntnis steigert. Es verbindet die sinnliche Wahrnehmung von Schönheit mit einer transzendierenden Einsicht über die Grenzen des Irdischen hinaus. Im Mittelpunkt steht die nächtliche Beobachtung eines in voller Blüte stehenden Kirschbaums, dessen weiße Pracht im Mondlicht als Inbegriff irdischer Schönheit erscheint.
Der Sprecher beschreibt die Szene mit Staunen und Präzision: Der blühende Kirschbaum wirkt wie vom Schnee bedeckt, seine Blüten sind so makellos, dass sie selbst mit dem Weiß eines Schwans konkurrieren. Die Beschreibung steigert sich zur Behauptung, dass selbst die Schatten im Mondlicht weiß erscheinen – ein poetisches Bild für die Reinheit und Durchlichtung der Erscheinung. Die sinnliche Wahrnehmung wird dabei als zutiefst ästhetisches, fast überirdisches Erlebnis geschildert.
Doch während der Sprecher im Schatten des Baumes wandelt, richtet er den Blick durch das Blätterwerk zum Himmel – und erlebt eine noch tiefere Form von Schönheit: das Licht eines Sterns, das so rein und hell ist, dass selbst die weißen Blüten dagegen „schwarz zu sein“ scheinen. Dieser Moment ist der Wendepunkt des Gedichts, in dem sich das Irdische als bloßer Abglanz des Himmlischen erweist. Die Erkenntnis kommt nicht durch Belehrung, sondern durch das unmittelbare Erleben – durch das Licht „das mir recht in die Seele strahlte“.
In den abschließenden Versen zieht das lyrische Ich eine klare Folgerung: So schön die Natur auch ist – und gerade weil sie so schön ist –, verweist sie doch nur auf noch größere, göttliche Herrlichkeit. Die „größte Schönheit dieser Erden“ verblasst gegenüber der himmlischen. Diese Gegenüberstellung zeigt Brockes’ typische Verbindung von Naturfreude und Frömmigkeit: Die Natur ist nicht nur zum Genießen da, sondern auch ein Spiegel göttlicher Größe.
„Kirschblüte bei der Nacht“ ist somit ein Gedicht, das in der Tradition der Naturmystik steht. Es feiert die Schönheit der Schöpfung, ohne im Ästhetischen zu verharren. Vielmehr wird das sinnliche Staunen zur Brücke für eine metaphysische Einsicht – die Blüte wird zum Symbol für die göttliche Ordnung, und das Licht des Sterns zum Zeichen einer höheren Wahrheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.