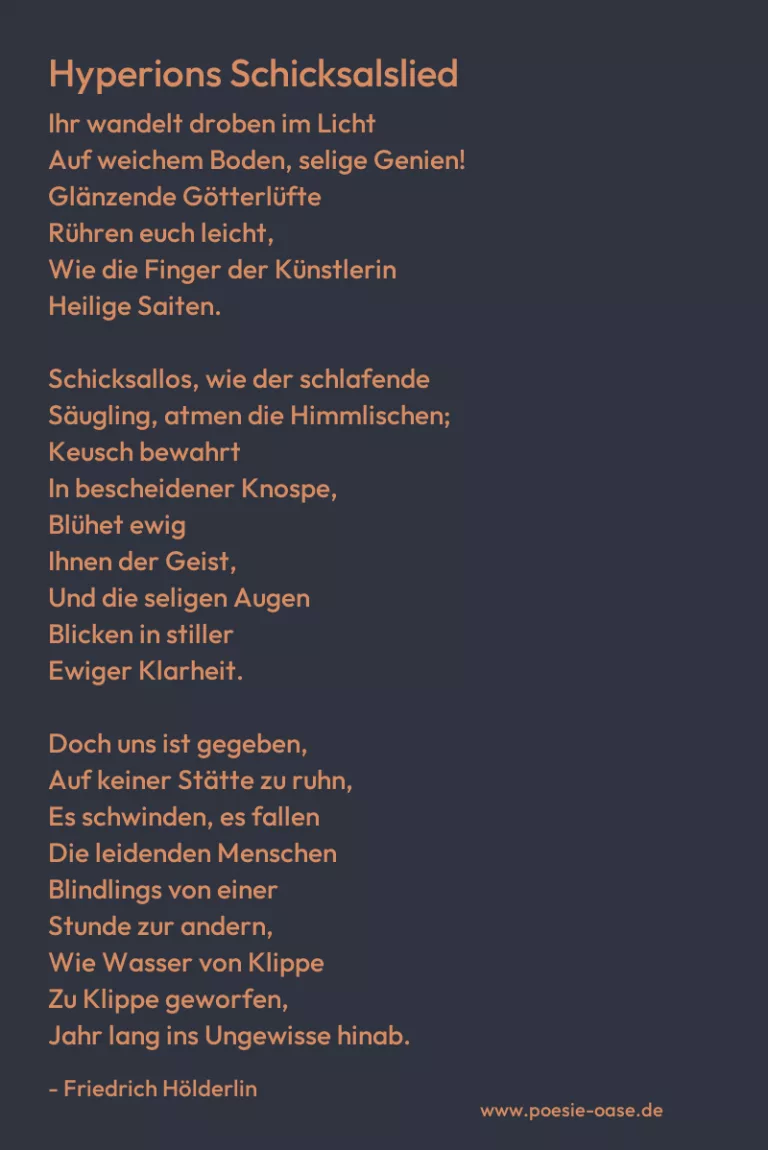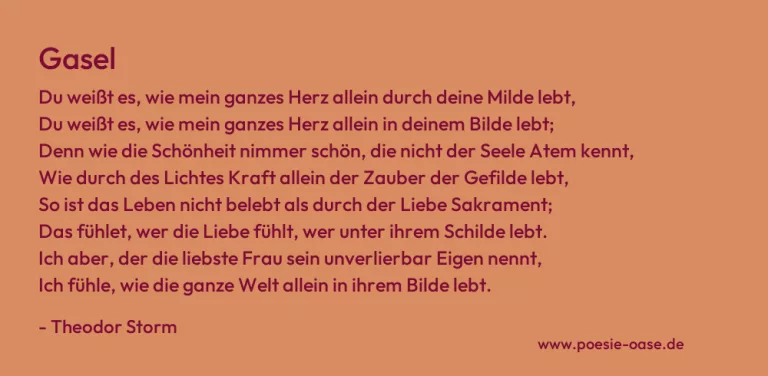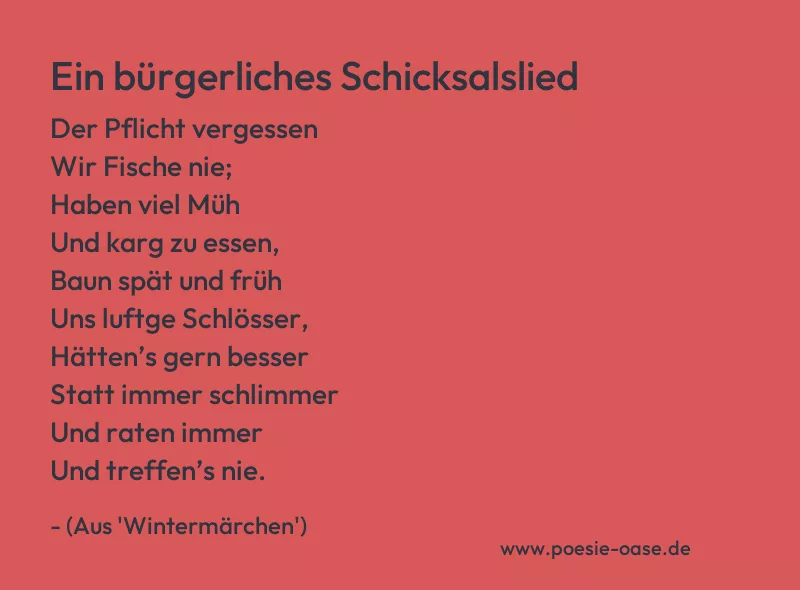Ein bürgerliches Schicksalslied
Der Pflicht vergessen
Wir Fische nie;
Haben viel Müh
Und karg zu essen,
Baun spät und früh
Uns luftge Schlösser,
Hätten’s gern besser
Statt immer schlimmer
Und raten immer
Und treffen’s nie.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
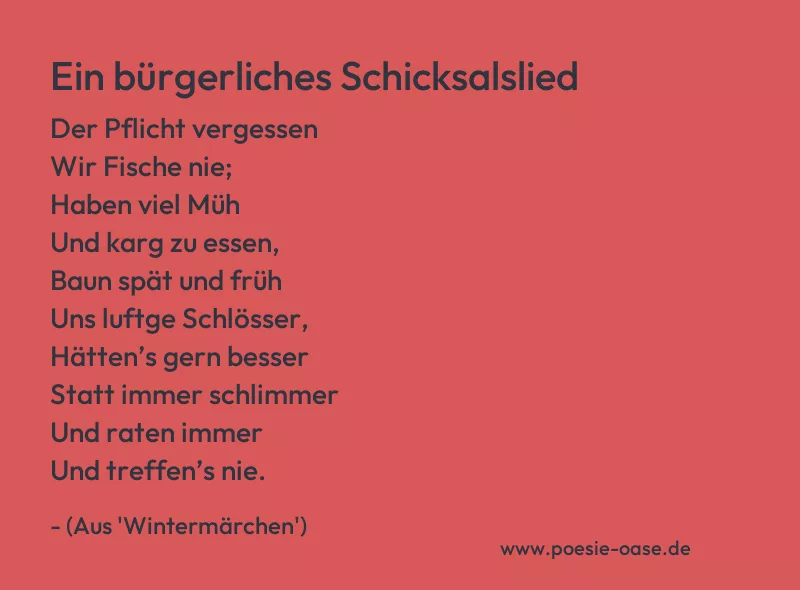
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein bürgerliches Schicksalslied“ von Heinrich Heine aus dem Werk „Wintermärchen“ thematisiert die tragische Lage des „Bürgers“ und den ewigen Kampf gegen unerreichbare Wünsche. Der erste Vers „Der Pflicht vergessen, wir Fische nie“ verweist auf das Vergessen der Pflichten, was gleichzeitig ein Bild für das Leben der Bürger ist, die zwischen Arbeit und dem Streben nach Besserem gefangen sind. Die Fische, die an das Bild von Schwimmen und Freiheit erinnern, werden jedoch durch die „Pflichten“ gefangen gehalten, was die Unfähigkeit zur Selbstverwirklichung verdeutlicht.
Im weiteren Verlauf des Gedichts wird die harte Lebensrealität der Bürger beschrieben: „Haben viel Müh und karg zu essen.“ Der Alltag ist von harter Arbeit geprägt, und dennoch ist das Leben von Entbehrungen und materieller Knappheit gezeichnet. Dies stellt einen Kontrast zu den „luftge Schlösser“ dar, die sich die Menschen „bauen“ – ein Symbol für unerfüllte Träume und Sehnsüchte nach einem besseren Leben, das jedoch immer unerreichbar bleibt.
Die wiederkehrende Frustration der Bürger wird in der Zeile „Hätten’s gern besser, statt immer schlimmer“ ausgedrückt. Ihre Wünsche nach Verbesserung und Wohlstand enden stets in der Enttäuschung. Das ständige „Raten“ und „Treffen nie“ unterstreicht die Orientierungslosigkeit und das Fehlen von Erfüllung in ihrem Leben. Sie streben nach Zielen, die sich stets entziehen, was den existenziellen Kampf der Bürger in der Gesellschaft verdeutlicht.
Heine nutzt hier eine klare, fast volksliedhafte Sprache, um die Schwermut und das Unglück des bürgerlichen Lebens zu vermitteln. Das Gedicht wird zur klagenden Reflexion über die Unmöglichkeit, die eigenen Träume in einer Welt voller Zwänge und Entbehrungen zu verwirklichen. Es hinterlässt den Eindruck eines endlosen, vergeblichen Strebens, das von der ewigen Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit geprägt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.