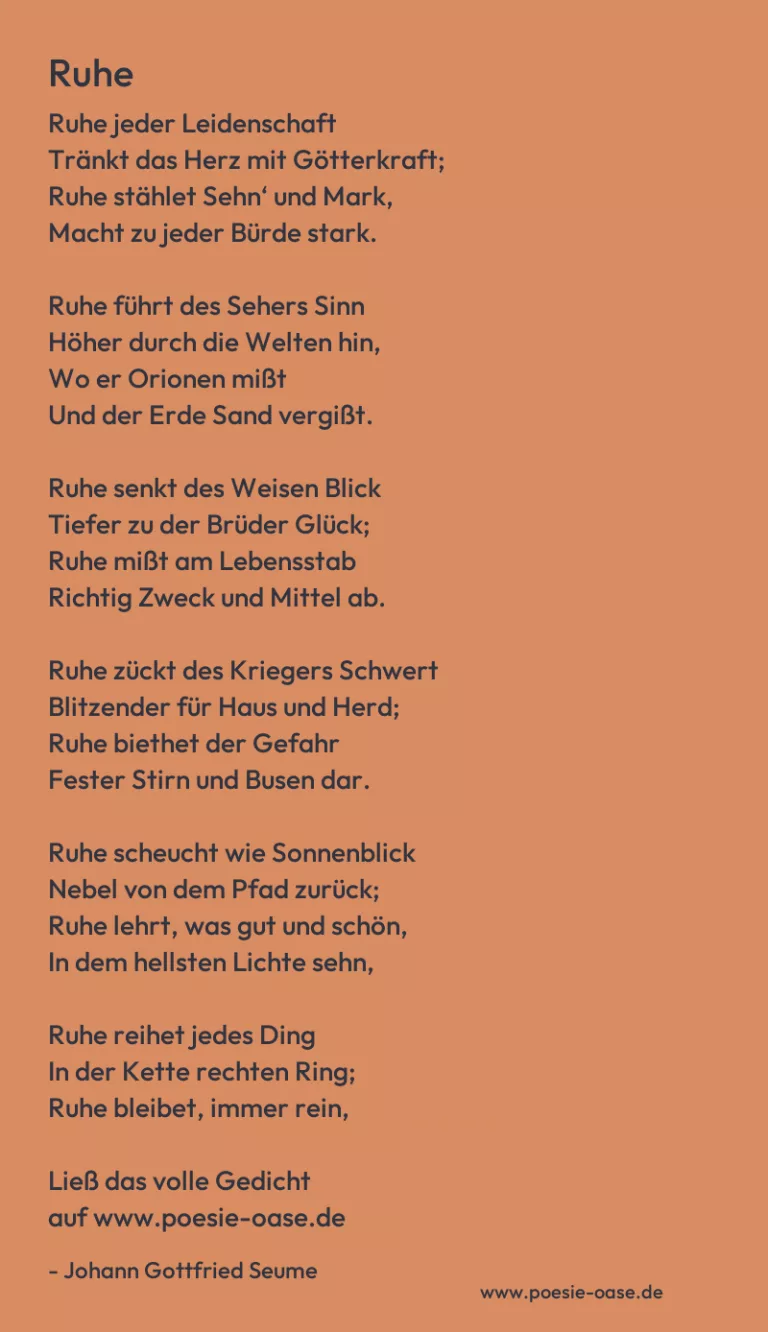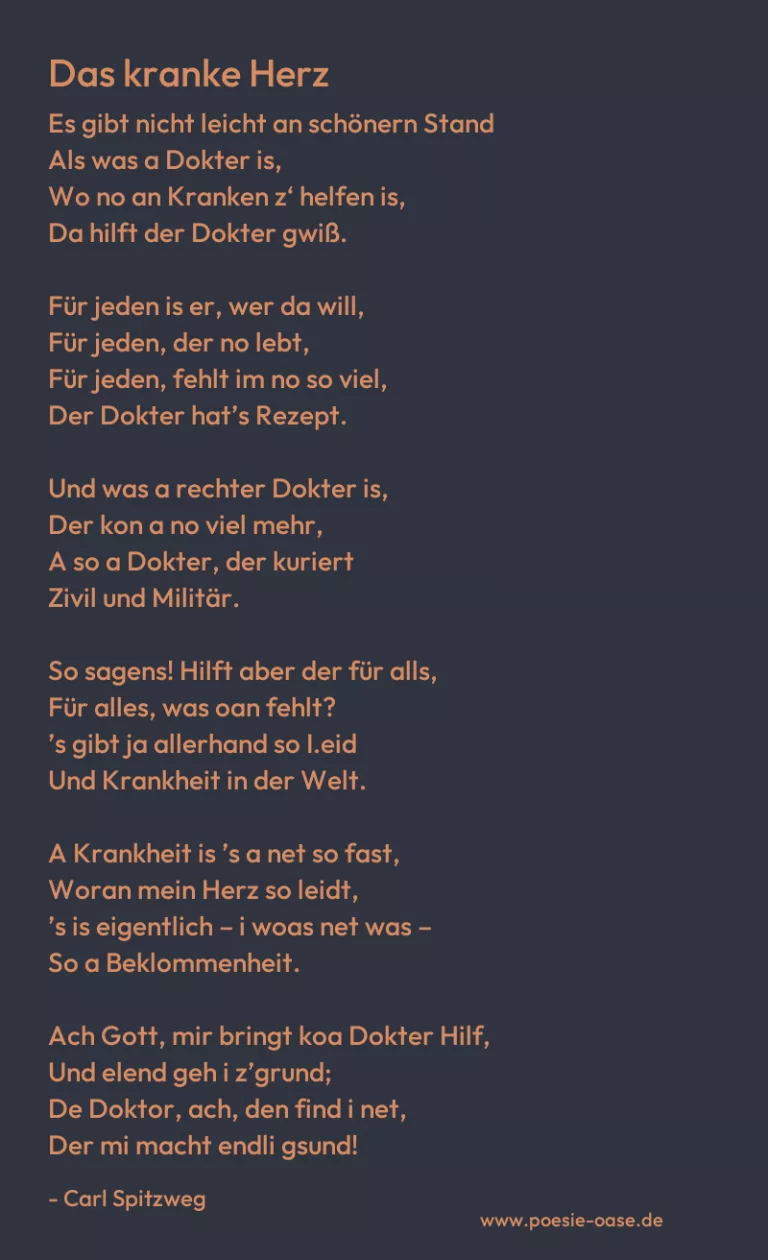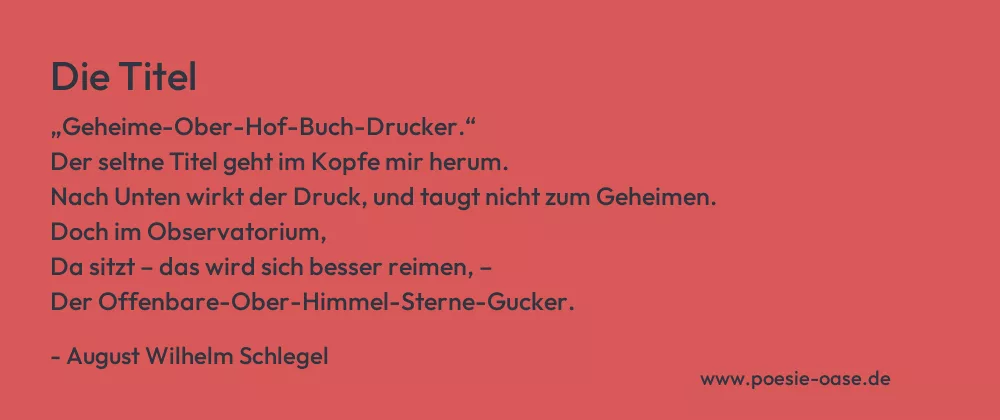Die Titel
„Geheime-Ober-Hof-Buch-Drucker.“
Der seltne Titel geht im Kopfe mir herum.
Nach Unten wirkt der Druck, und taugt nicht zum Geheimen.
Doch im Observatorium,
Da sitzt – das wird sich besser reimen, –
Der Offenbare-Ober-Himmel-Sterne-Gucker.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
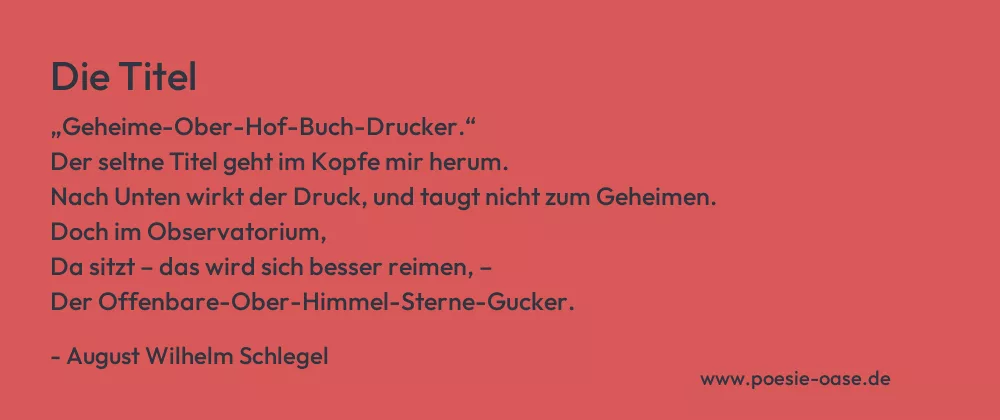
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Titel“ von August Wilhelm Schlegel spielt mit der Absurdität und der Ironie von langen, prunkvollen Titeln, die oft mehr Schein als Substanz vermitteln. Der Sprecher nimmt den „Geheime-Ober-Hof-Buch-Drucker“ als Beispiel für einen Titel, der durch seine Länge und Komplexität mehr verwirrt als informiert und gleichzeitig die Bedeutung oder Funktion des Trägers des Titels in Frage stellt.
Zu Beginn wird der Titel „Geheime-Ober-Hof-Buch-Drucker“ eingeführt, der in seiner Länge fast absurd wirkt und wenig Klarheit über die tatsächliche Rolle oder Bedeutung des Titels gibt. Der Sprecher erkennt, dass dieser Titel, der „nach unten wirkt“, eigentlich nicht in der Lage ist, das „Geheime“ zu bewahren, da er vielmehr durch seine eigene Komplexität das Gegenteil erreicht: er macht die Bedeutung und die Funktion des Titels unklar und offen. Schlegel kritisiert hier, wie Titel oft übermäßig aufgebläht werden, ohne wirklich etwas zu verbergen oder eine tiefere Bedeutung zu haben.
Im Kontrast dazu stellt der Sprecher im zweiten Teil des Gedichts den „Offenbaren-Ober-Himmel-Sterne-Gucker“ vor, der auf humorvolle Weise die Absurdität der langen Titel weiterführt. Dieser Titel klingt in seiner Selbstbezeichnung fast noch übertriebener und bietet eine gewisse Komik, da der Sprecher in seinem „Observatorium“ die Sterne beobachtet, während er sich gleichzeitig mit einer eher trivialen, vielleicht sogar lächerlichen Rolle befasst. Der Hinweis auf das Observatorium verstärkt die Vorstellung eines scheinbar bedeutungsvollen Titels, der jedoch genauso wenig Substanz besitzt wie der erste.
Schlegel verwendet diesen humorvollen und ironischen Ton, um zu zeigen, wie gesellschaftliche Titel und die damit verbundene Bedeutung oft eine leere Hülle sind, die mehr mit der Selbstwahrnehmung derjenigen zu tun hat, die sie tragen, als mit einer tatsächlichen Funktion oder Bedeutung. Die Kunst des Titelgebens wird hier als etwas dargestellt, das nicht unbedingt die wahre Bedeutung oder den Wert einer Person oder ihrer Arbeit widerspiegelt, sondern vielmehr eine Fassade ist, die die wahre Essenz verdeckt.
Insgesamt spielt das Gedicht mit der Idee von Titeln als sozialer Konstruktion, die mehr durch ihren Klang und die Erwartungen, die sie wecken, definiert wird als durch den tatsächlichen Inhalt oder die Funktion der betreffenden Person. Schlegel kritisiert auf humorvolle Weise, wie der äußere Schein oft wichtiger wird als der wahre Wert oder die tatsächliche Bedeutung, die hinter solchen Bezeichnungen steckt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.