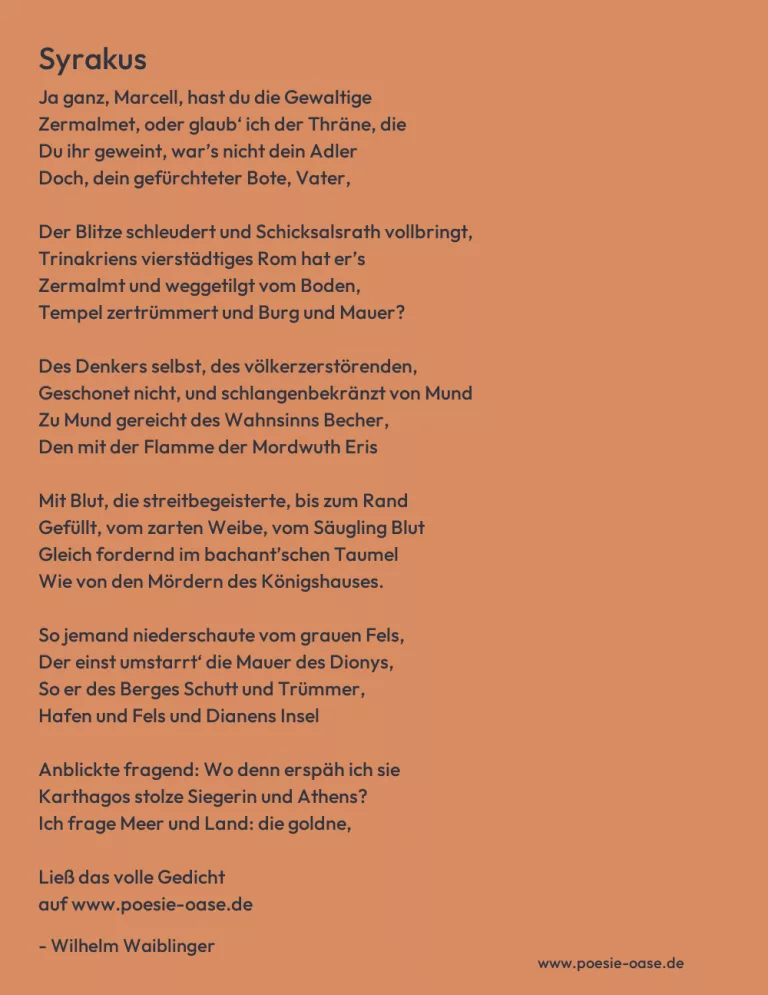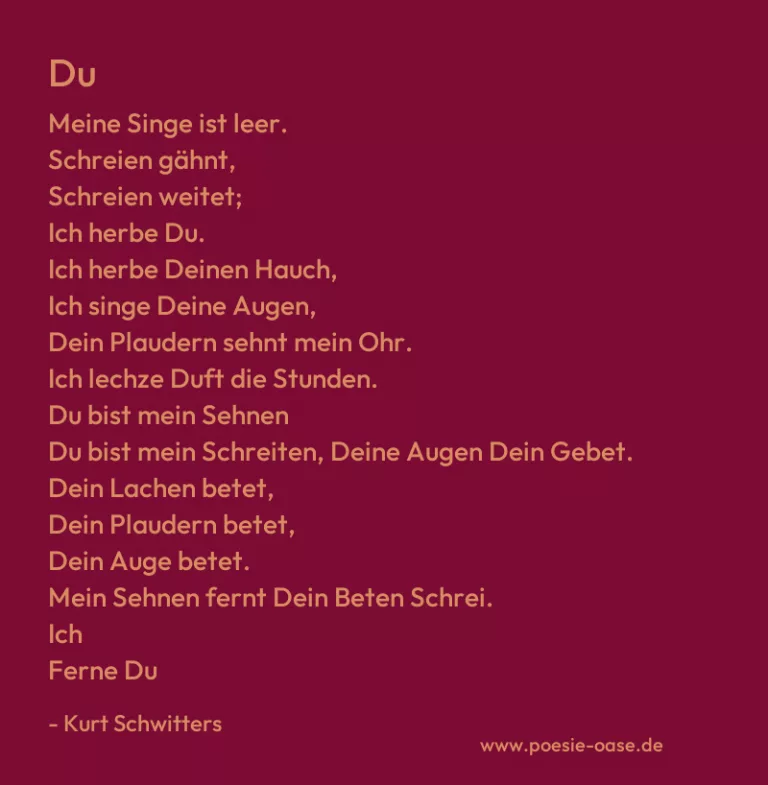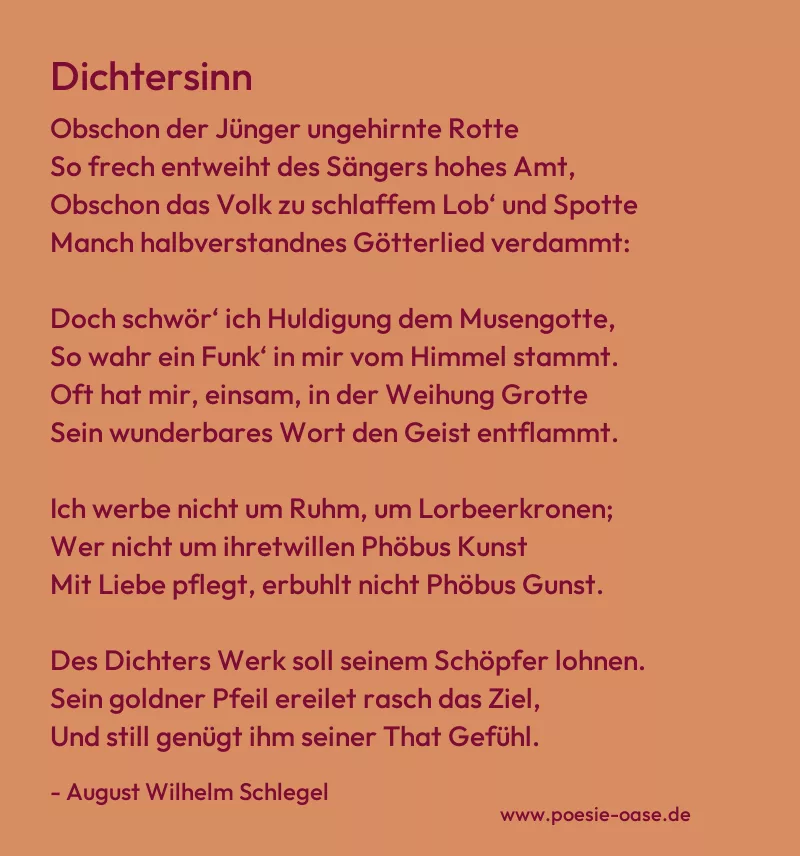Dichtersinn
Obschon der Jünger ungehirnte Rotte
So frech entweiht des Sängers hohes Amt,
Obschon das Volk zu schlaffem Lob‘ und Spotte
Manch halbverstandnes Götterlied verdammt:
Doch schwör‘ ich Huldigung dem Musengotte,
So wahr ein Funk‘ in mir vom Himmel stammt.
Oft hat mir, einsam, in der Weihung Grotte
Sein wunderbares Wort den Geist entflammt.
Ich werbe nicht um Ruhm, um Lorbeerkronen;
Wer nicht um ihretwillen Phöbus Kunst
Mit Liebe pflegt, erbuhlt nicht Phöbus Gunst.
Des Dichters Werk soll seinem Schöpfer lohnen.
Sein goldner Pfeil ereilet rasch das Ziel,
Und still genügt ihm seiner That Gefühl.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
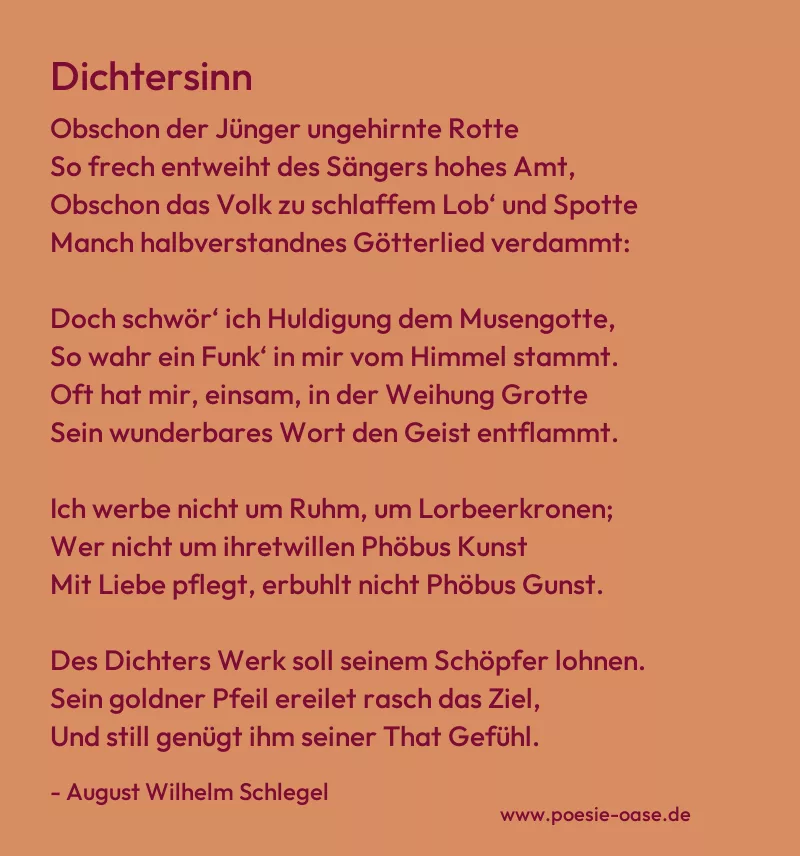
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Dichtersinn“ von August Wilhelm Schlegel befasst sich mit dem wahren Wesen des Dichterberufs und der poetischen Kunst. Es kritisiert die oberflächliche Anerkennung und den Missbrauch von Kunst, während es gleichzeitig die tiefe, innige Beziehung des Dichters zu seiner Muse betont.
Zu Beginn des Gedichts kritisiert der Sprecher die Entweihung der poetischen Kunst durch eine „ungehirnte Rotte“, die das hohe Amt des Sängers entwürdigt. Die „schlaffen“ und halb verstandenen Urteile des Volkes, das Gedichte verdammt, sind ein Spiegel der oberflächlichen Rezeption von Kunst, die oft vom wahren Sinn und der Tiefe eines Werkes entfernt ist. Schlegel stellt hier die Trennung zwischen der breiten Masse und der echten künstlerischen Schöpfung dar, die oft von Unverständnis und Spott begleitet wird.
Trotz dieser Entweihung schwört der Sprecher jedoch ewige Huldigung dem Musengott – der Muse der Poesie – und bekennt, dass sein dichterisches Schaffen durch göttliche Inspiration erleuchtet wird. Diese „Weihung Grotte“ ist ein Ort der Einkehr und der inneren Erhebung, an dem der Dichter mit göttlicher Hilfe seinen kreativen Funken entfacht. Diese Darstellung verleiht der Kunst eine übernatürliche und fast religiöse Dimension, bei der das Gedicht als Werkzeug für eine tiefere Verbindung mit dem Göttlichen dient.
Schlegel macht deutlich, dass wahre Kunst nicht aus dem Streben nach Ruhm oder äußeren Auszeichnungen entsteht. Der Dichter, der „nicht um Lorbeerkronen“ oder „Ruhm“ werbe, ist ein wahrer Künstler. Die Kunst, die auf Liebe und Hingabe an die Muse basiert, ist das, was dem Dichter die „Gunst“ der Musen sichert. Dies stellt die oberflächliche Vorstellung in Frage, dass Kunst für Ruhm oder Anerkennung gemacht wird, und hebt die intrinsische Bedeutung der Kunst hervor, die aus der Leidenschaft und der inneren Berufung des Künstlers hervorgeht.
Im letzten Teil des Gedichts betont Schlegel, dass das Werk des Dichters nicht dem äußeren Lohn oder den Lorbeeren dient, sondern einer höheren Erfüllung. Das Werk soll seinem „Schöpfer“ – in diesem Fall der Muse oder dem göttlichen Funken – „lohnen“, was bedeutet, dass der wahre Lohn eines Dichters nicht in äußerer Anerkennung, sondern in der tiefen Zufriedenheit und dem „Gefühl“ liegt, dass er mit seiner Kunst etwas Göttliches getroffen hat. Die „goldene Pfeil“ des Dichters trifft das „Ziel“, was auf das perfekte und wahre Werk hinweist, das durch Leidenschaft und wahre Inspiration zustande kommt.
Insgesamt stellt das Gedicht die wahre Bedeutung der Kunst als eine göttliche Berufung dar, die nicht auf äußere Belohnungen oder die Anerkennung der Masse aus ist. Schlegel hebt die innere Erfüllung und den tiefen, mystischen Zusammenhang zwischen dem Dichter und seiner Muse hervor, die als Quelle aller wahren Kunst angesehen wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.