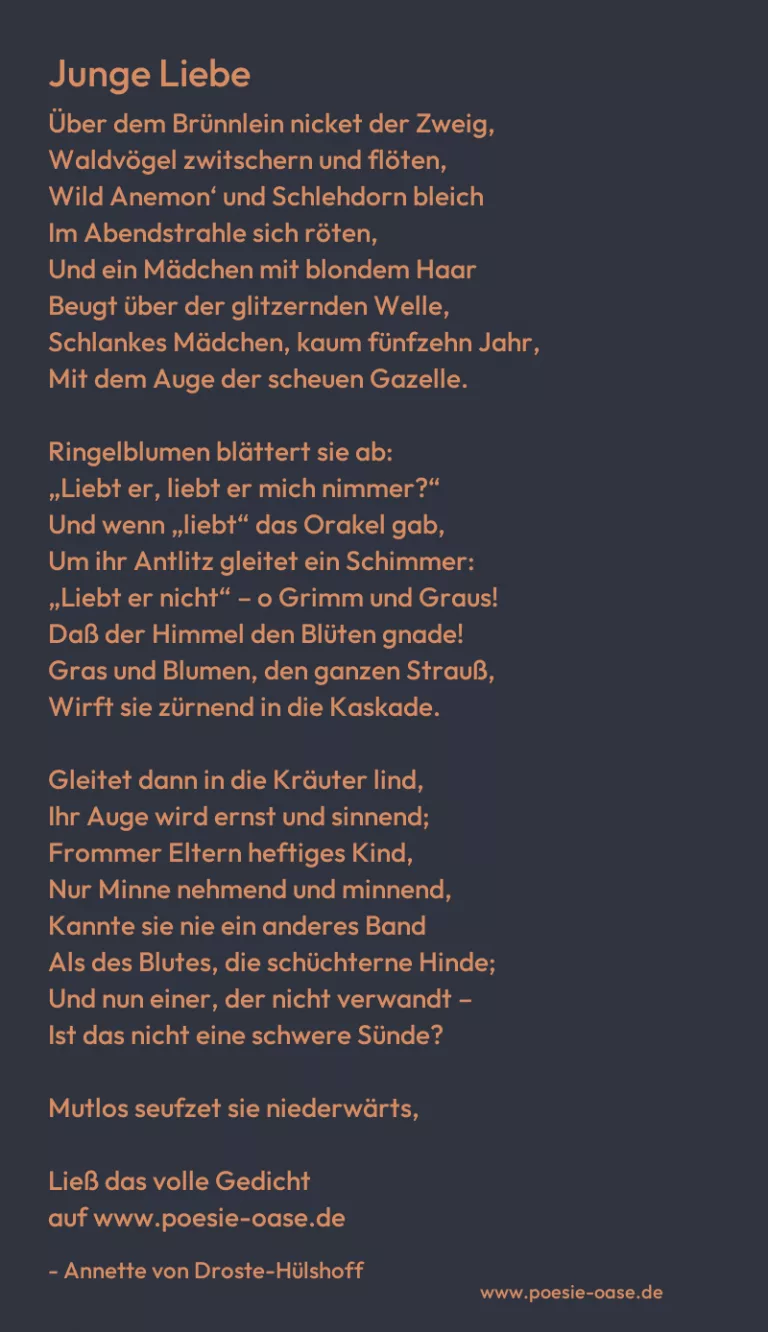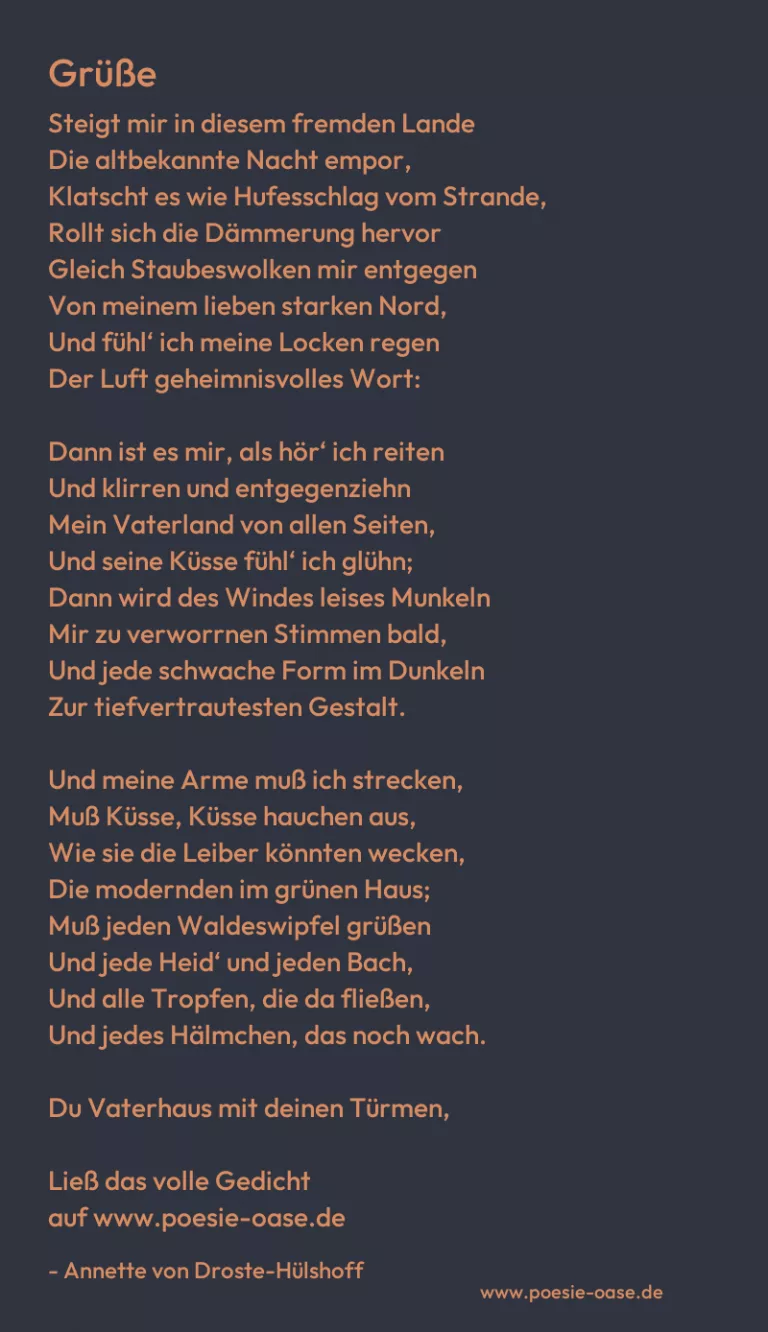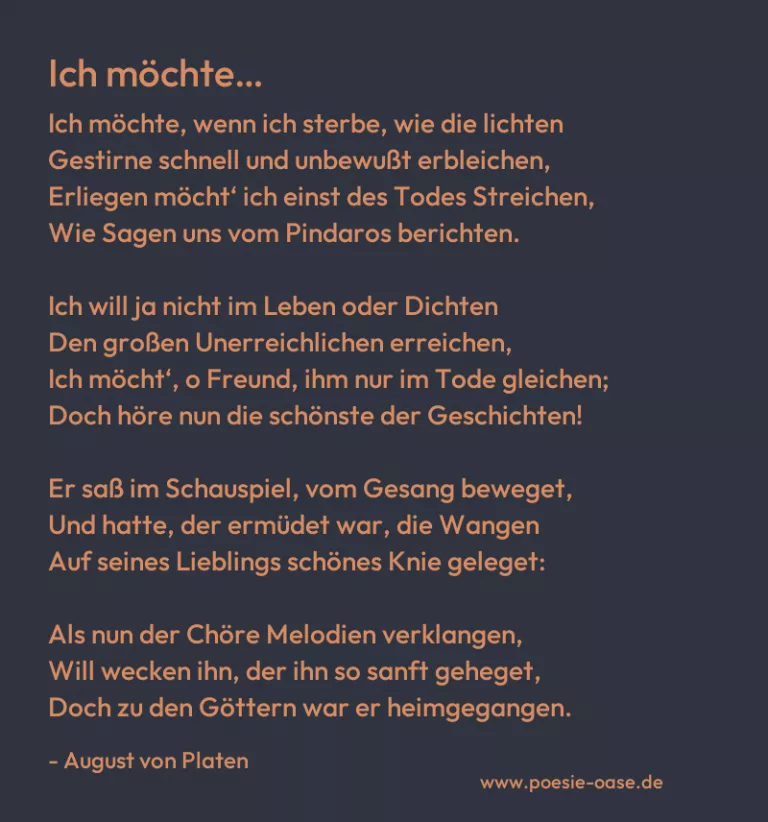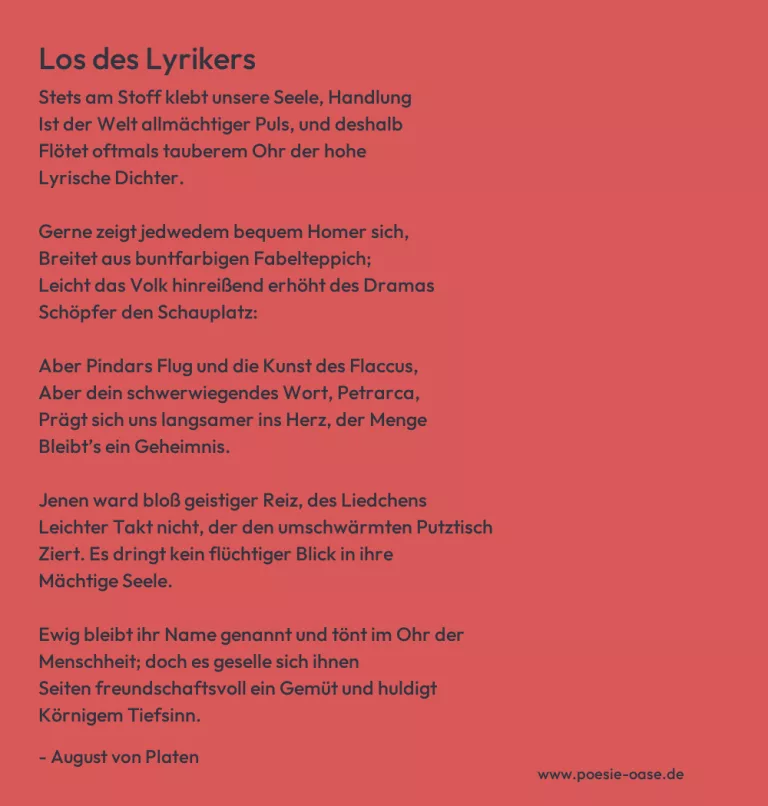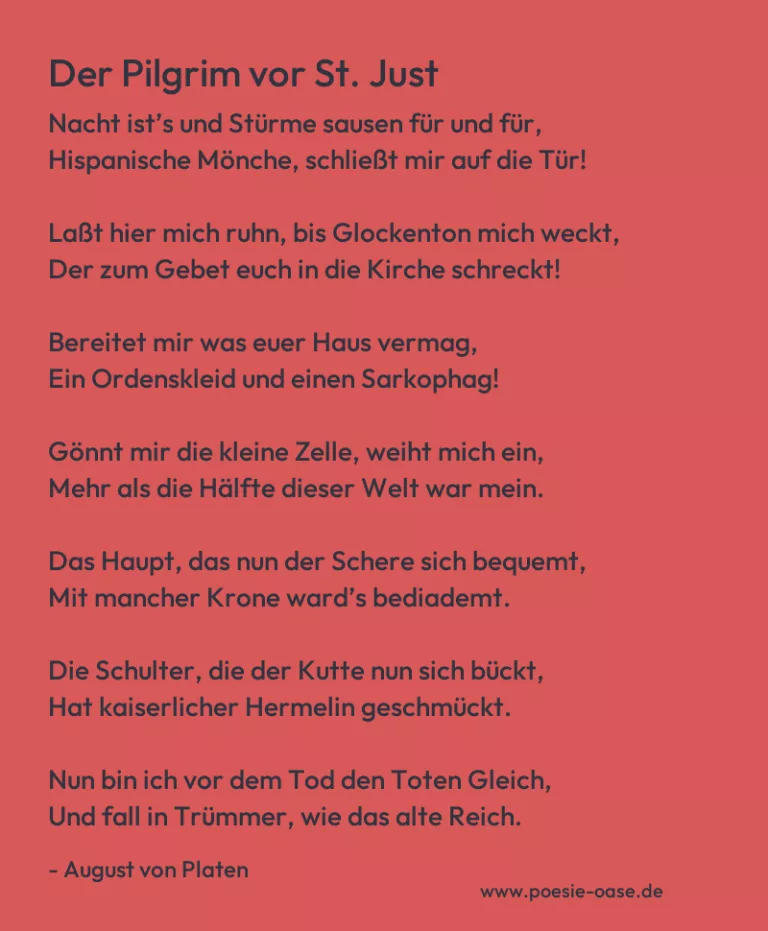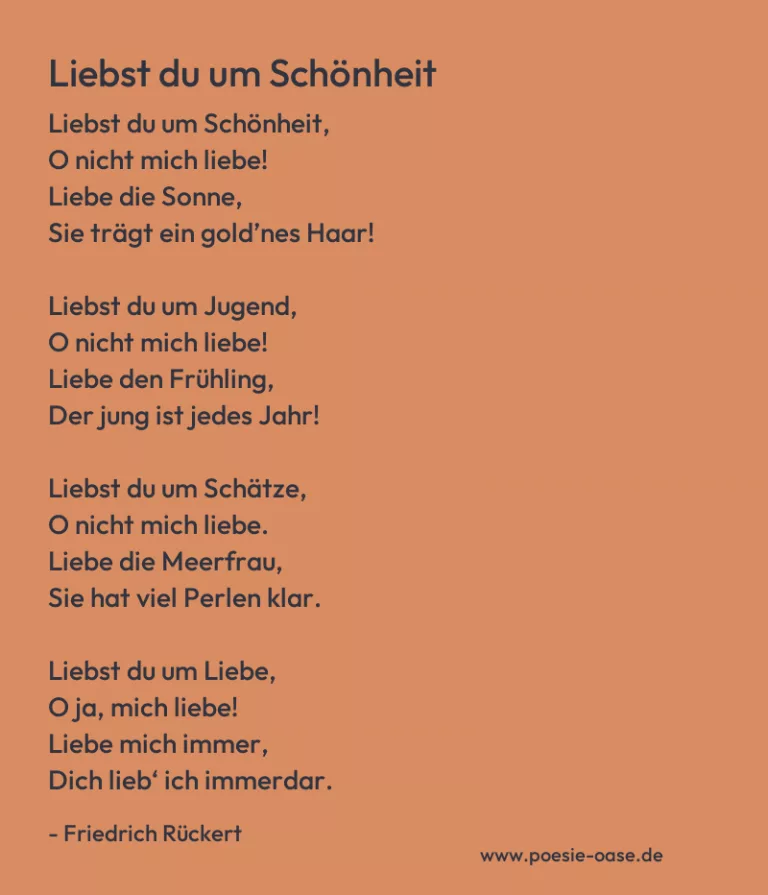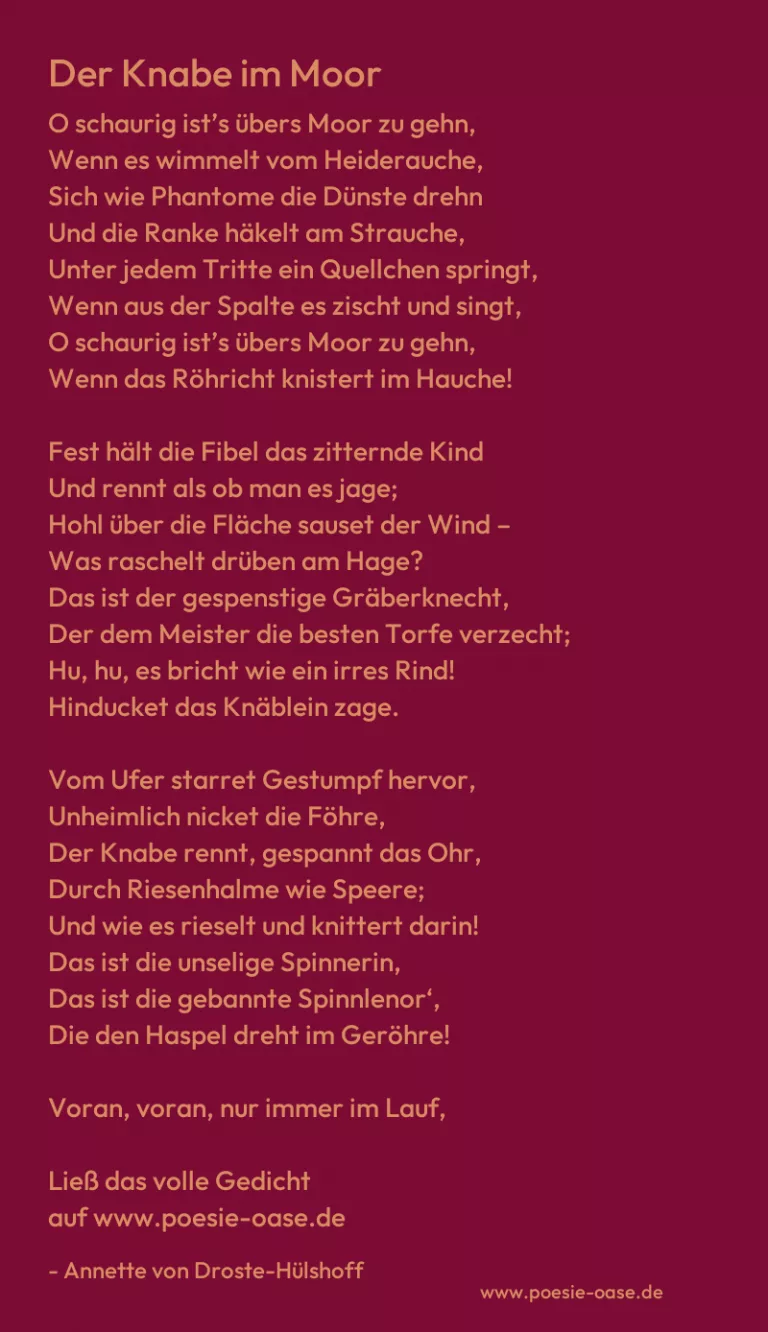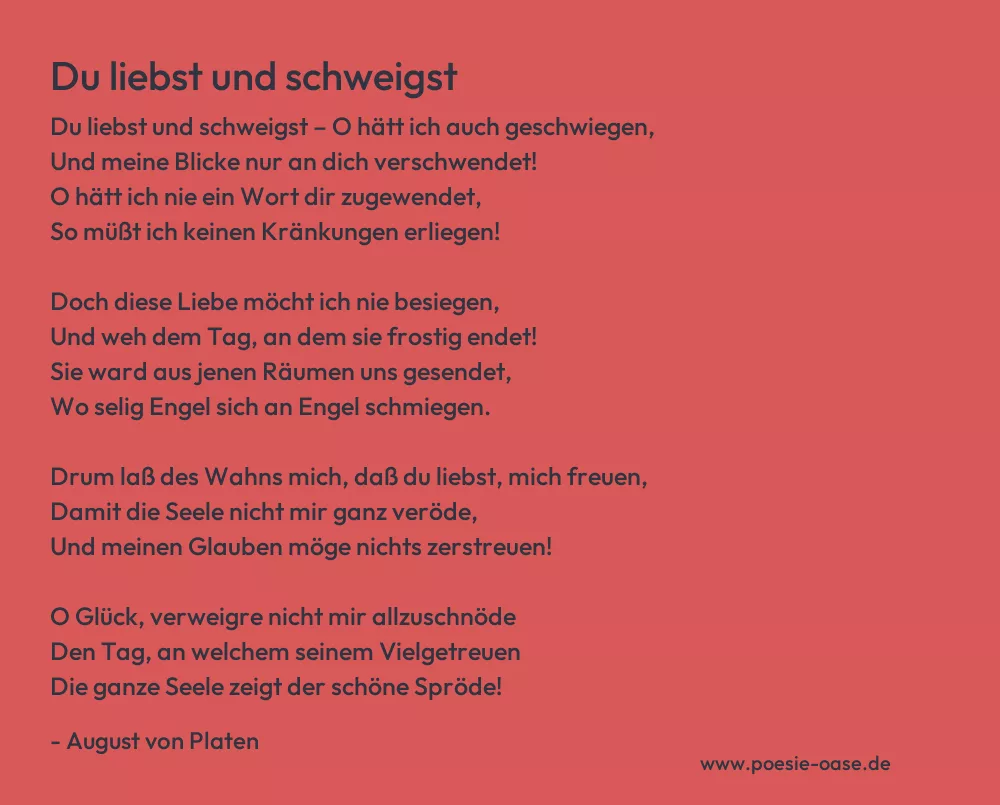Du liebst und schweigst
Du liebst und schweigst – O hätt ich auch geschwiegen,
Und meine Blicke nur an dich verschwendet!
O hätt ich nie ein Wort dir zugewendet,
So müßt ich keinen Kränkungen erliegen!
Doch diese Liebe möcht ich nie besiegen,
Und weh dem Tag, an dem sie frostig endet!
Sie ward aus jenen Räumen uns gesendet,
Wo selig Engel sich an Engel schmiegen.
Drum laß des Wahns mich, daß du liebst, mich freuen,
Damit die Seele nicht mir ganz veröde,
Und meinen Glauben möge nichts zerstreuen!
O Glück, verweigre nicht mir allzuschnöde
Den Tag, an welchem seinem Vielgetreuen
Die ganze Seele zeigt der schöne Spröde!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
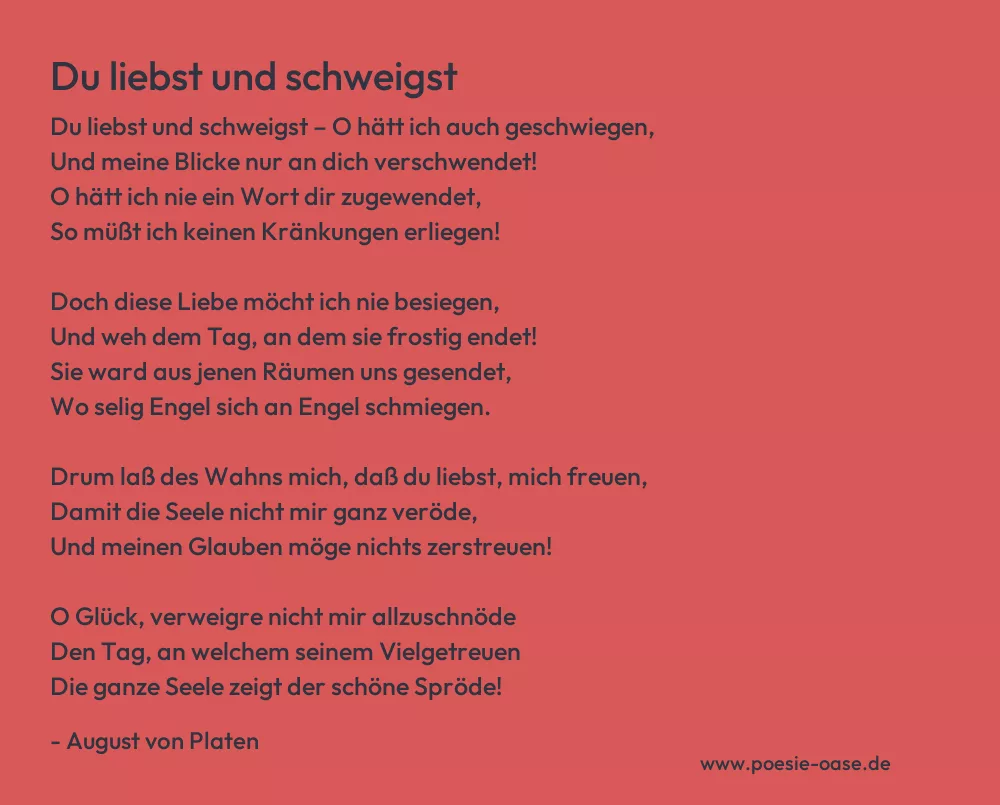
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Du liebst und schweigst“ von August von Platen thematisiert die schmerzhafte, unerwiderte Liebe und den inneren Konflikt des lyrischen Ichs. Der Sprecher drückt den Wunsch aus, er hätte in seiner Liebe geschwiegen und nie seine Gefühle preisgegeben, da dies zu Kränkungen und emotionalem Schmerz geführt hat. Der Ausdruck „Du liebst und schweigst“ verweist auf das stille, aber tief empfundene Gefühl der Liebe, die jedoch im Schweigen verbleibt und dadurch noch intensiver und ungenießbarer wird.
Trotz des Schmerzes und der unerwiderten Zuneigung möchte der Sprecher seine Liebe nicht aufgeben oder „besiegen“. Er beschreibt diese Liebe als eine Kraft, die von einem höheren, fast göttlichen Ort kommt, wo „selig Engel sich an Engel schmiegen“. Diese metaphorische Darstellung der Liebe als etwas Heiliges und Unantastbares lässt erkennen, dass die Liebe für den Sprecher eine große Bedeutung hat und er trotz der Qualen nicht darauf verzichten möchte. Die Liebe wird hier als unvergängliche und überirdische Kraft idealisiert, die nicht dem irdischen Leid unterworfen ist.
In der dritten Strophe wendet sich der Sprecher an die „Wahnsinnigen“, um sich von der Vorstellung zu befreien, dass er seine Liebe aufgeben sollte. Diese Liebe soll ihm Freude bringen, auch wenn sie mit Schmerz verbunden ist, und der Sprecher hofft, dass sie seine Seele nicht verhärten lässt. Diese Hoffnung auf eine reinigende, belebende Wirkung der Liebe spiegelt den inneren Widerstand gegen den Verlust von Glauben und Hoffnung wider, selbst wenn der Schmerz überwältigend scheint.
Zum Schluss fordert der Sprecher das „Glück“ auf, ihm nicht zu verweigern, dass der geliebte Mensch ihm „die ganze Seele zeigt“. Dies deutet auf die Sehnsucht nach einer ersehnten und doch unerreichbaren Offenbarung der wahren Gefühle des anderen hin. Die „schöne Spröde“ symbolisiert hier eine kühle, unerreichbare Liebe, deren wahre Tiefe der Sprecher sich erhofft, aber nie ganz erreicht. Das Gedicht endet mit einer Mischung aus Hoffnung und Resignation, die die Komplexität der unerwiderten Liebe und die Zerrissenheit des lyrischen Ichs zeigt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.