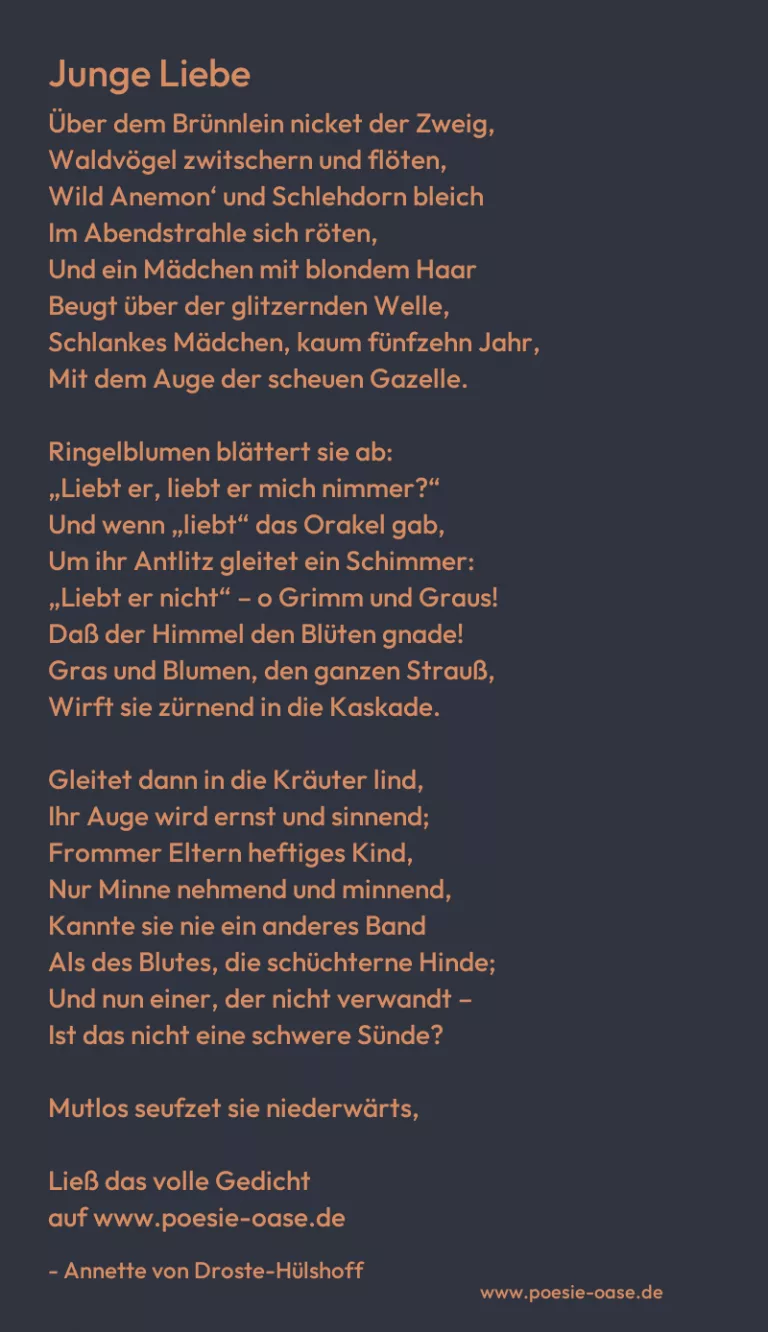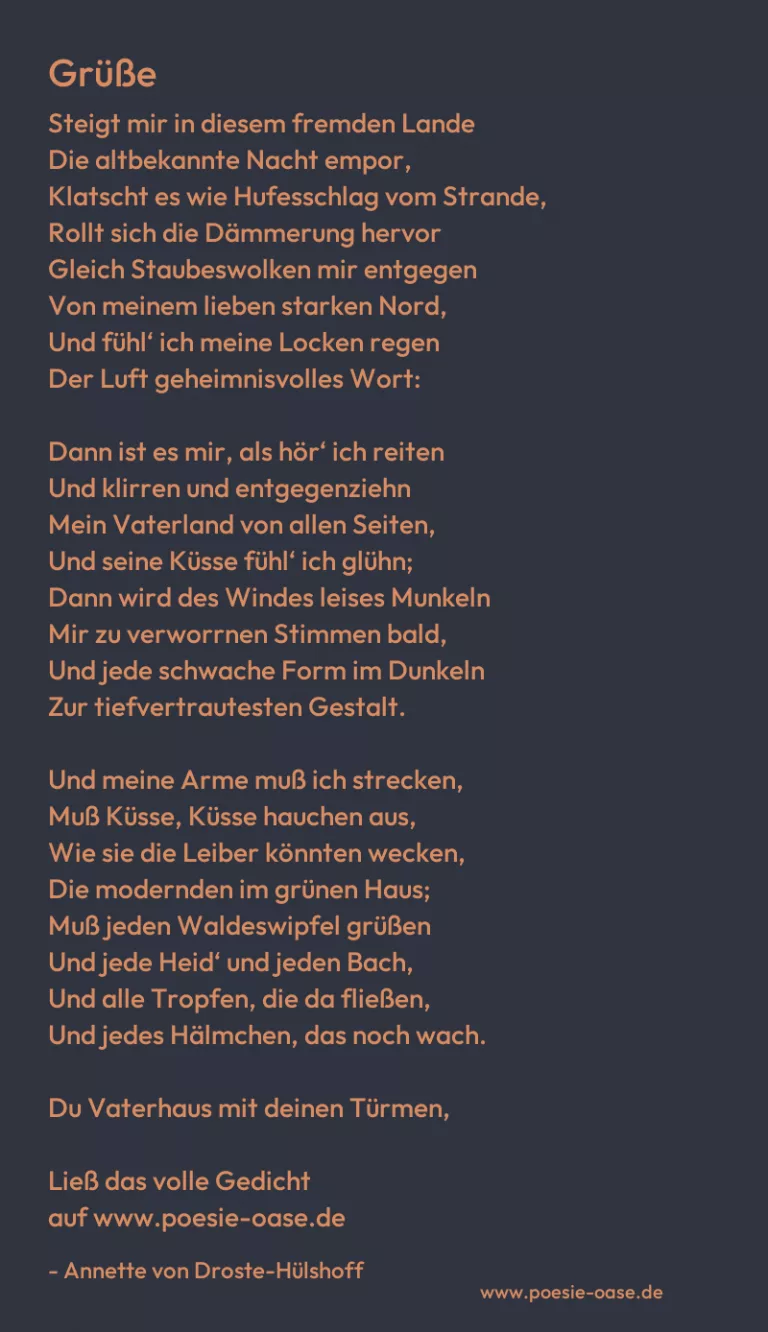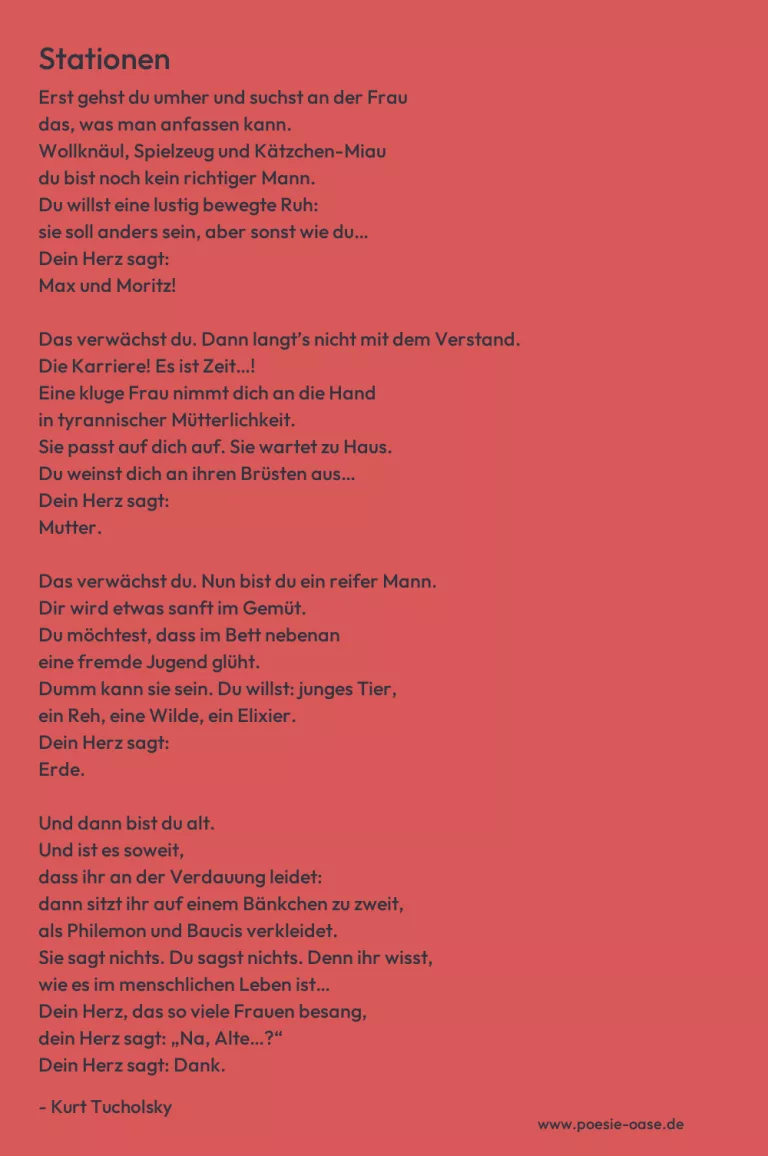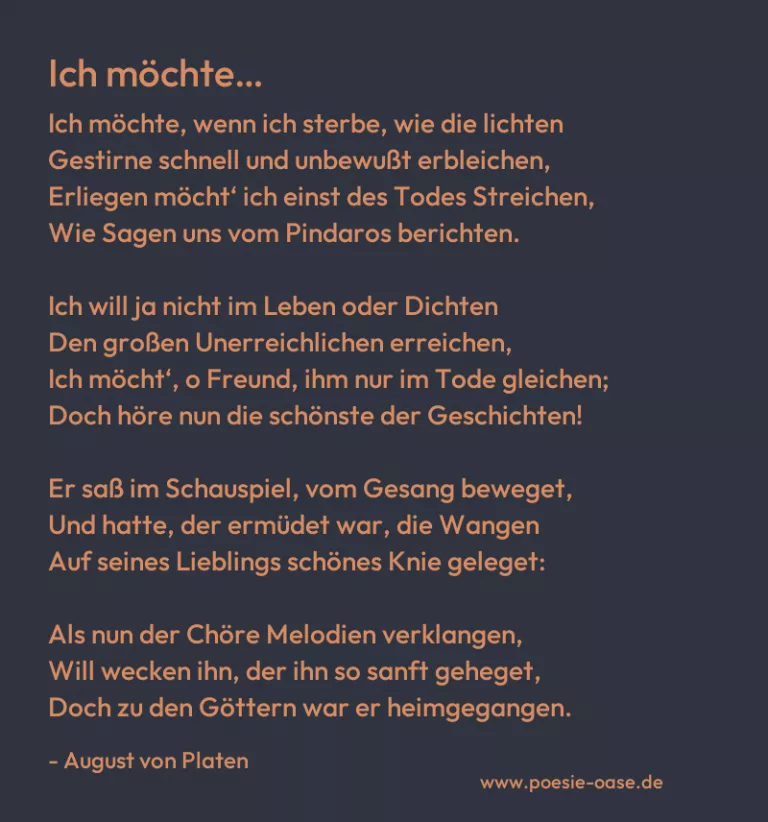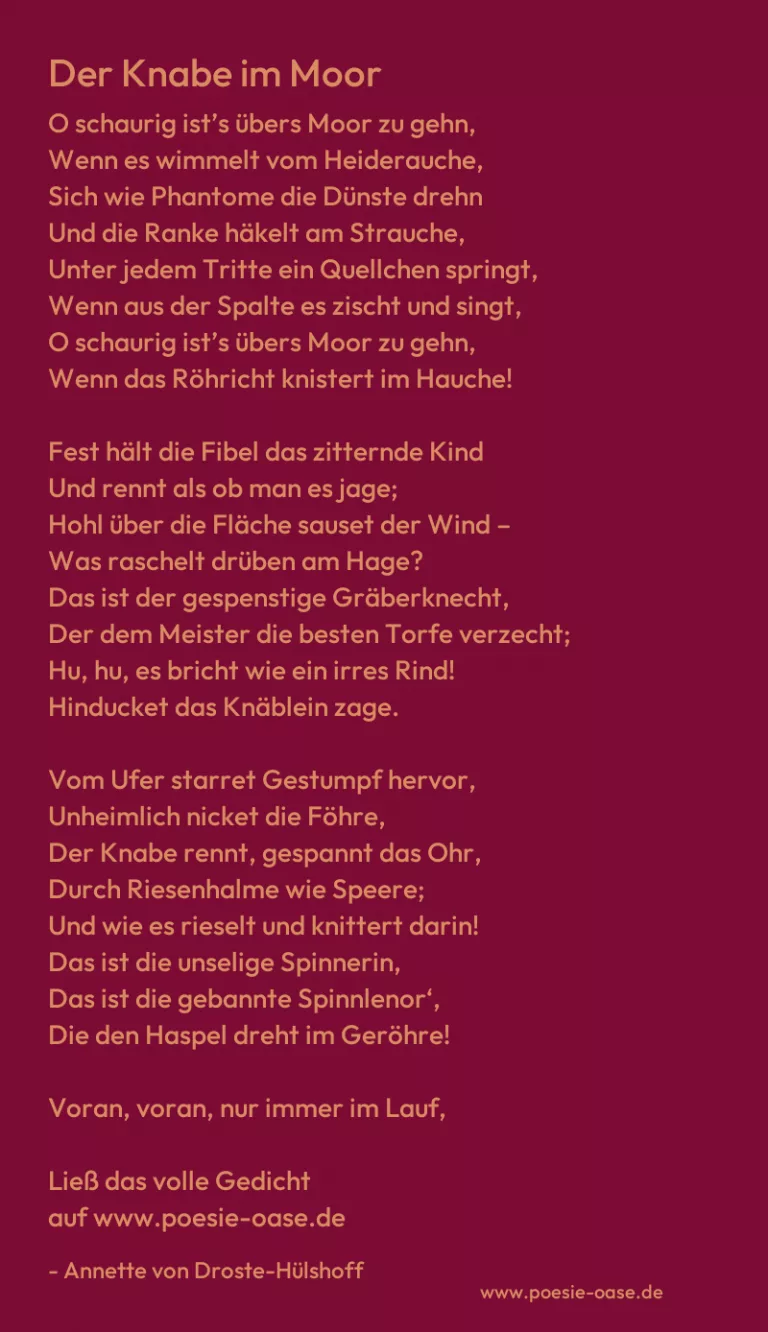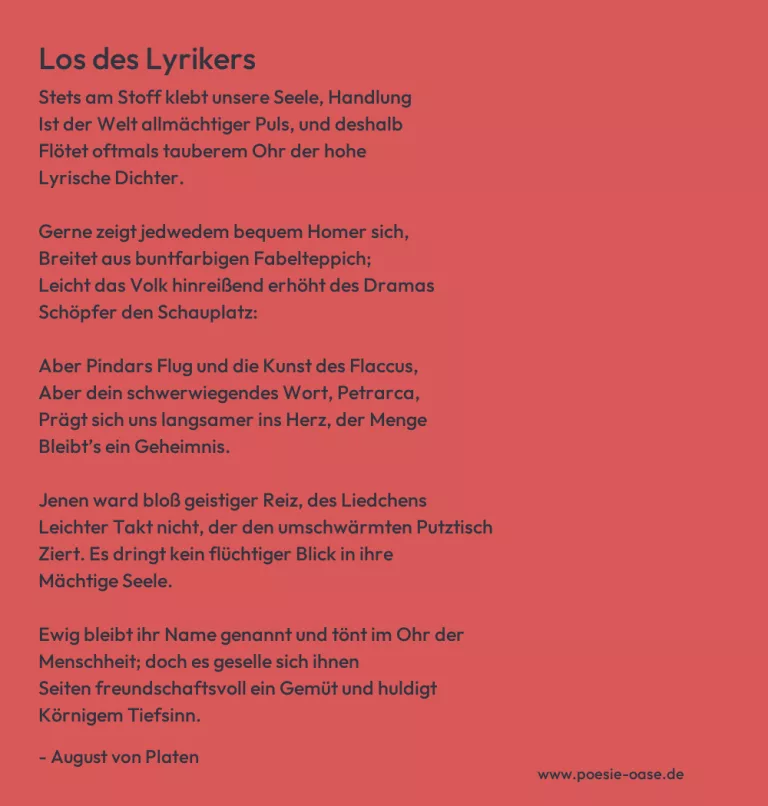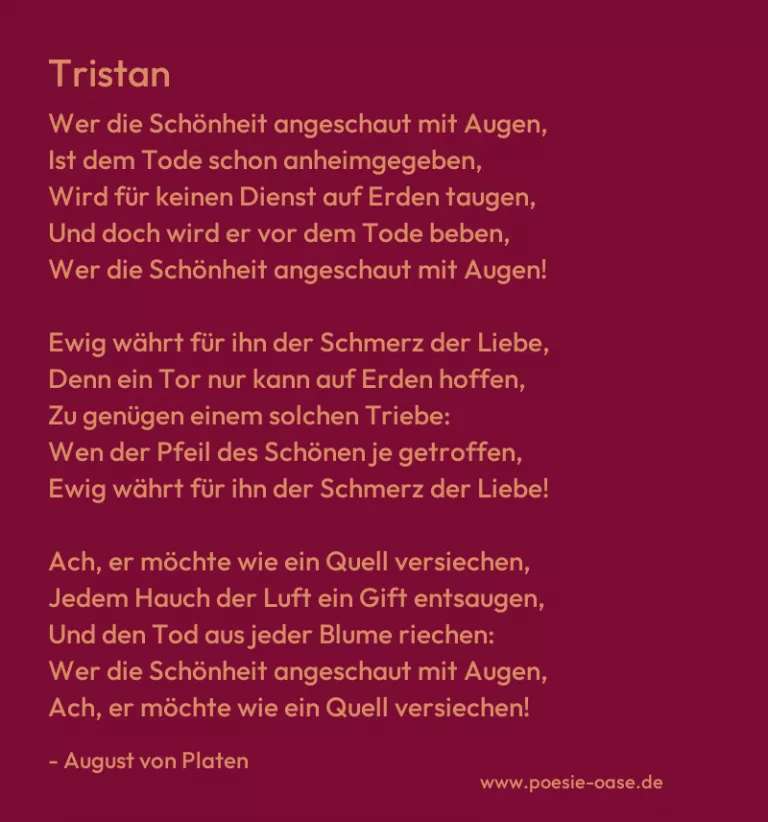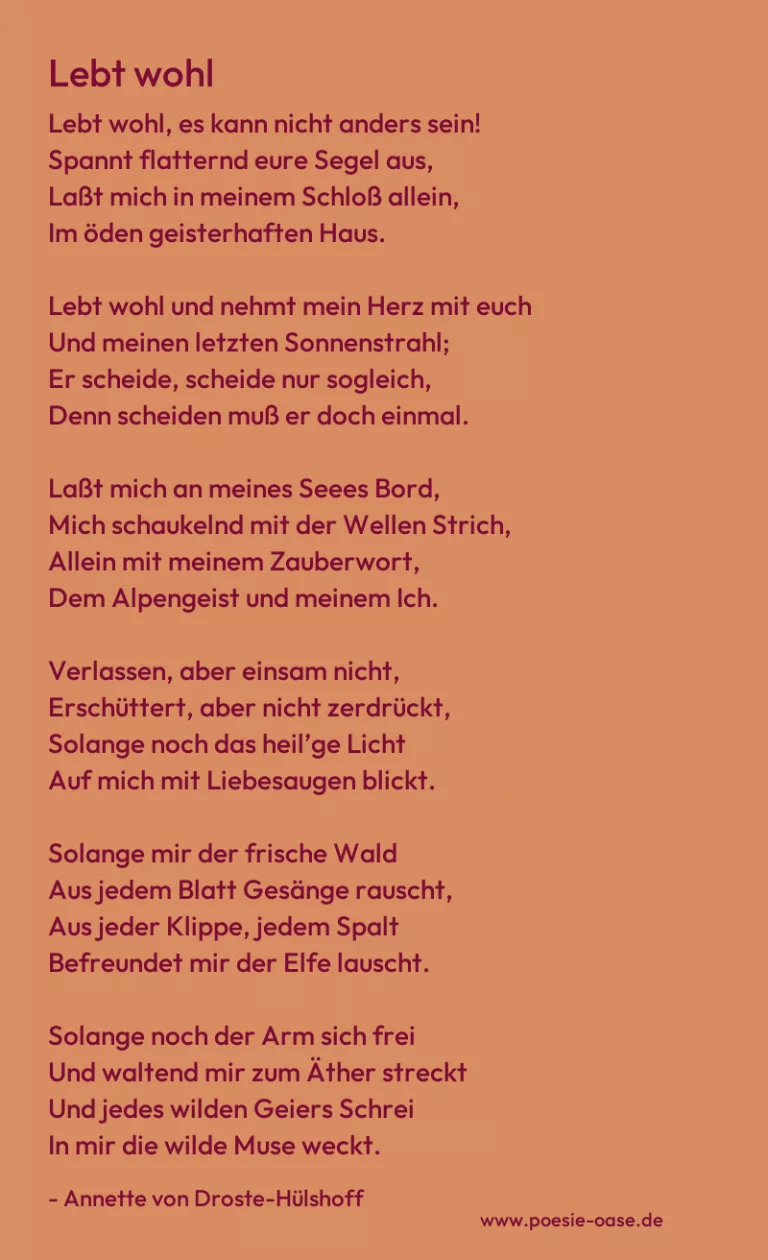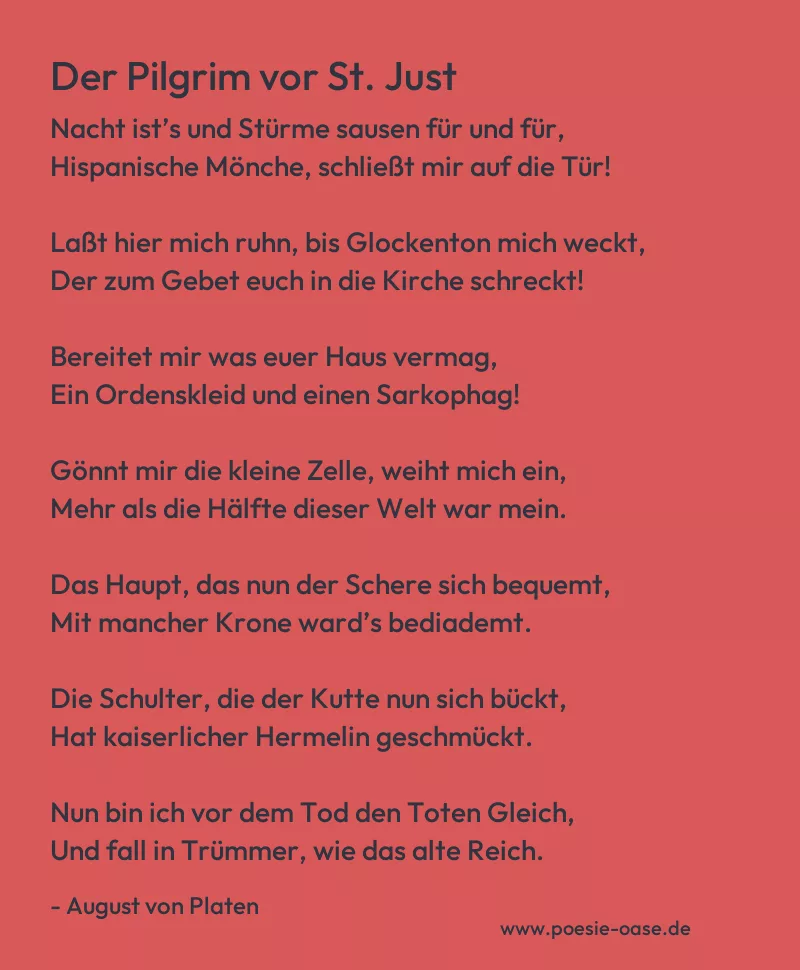Der Pilgrim vor St. Just
Nacht ist’s und Stürme sausen für und für,
Hispanische Mönche, schließt mir auf die Tür!
Laßt hier mich ruhn, bis Glockenton mich weckt,
Der zum Gebet euch in die Kirche schreckt!
Bereitet mir was euer Haus vermag,
Ein Ordenskleid und einen Sarkophag!
Gönnt mir die kleine Zelle, weiht mich ein,
Mehr als die Hälfte dieser Welt war mein.
Das Haupt, das nun der Schere sich bequemt,
Mit mancher Krone ward’s bediademt.
Die Schulter, die der Kutte nun sich bückt,
Hat kaiserlicher Hermelin geschmückt.
Nun bin ich vor dem Tod den Toten Gleich,
Und fall in Trümmer, wie das alte Reich.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
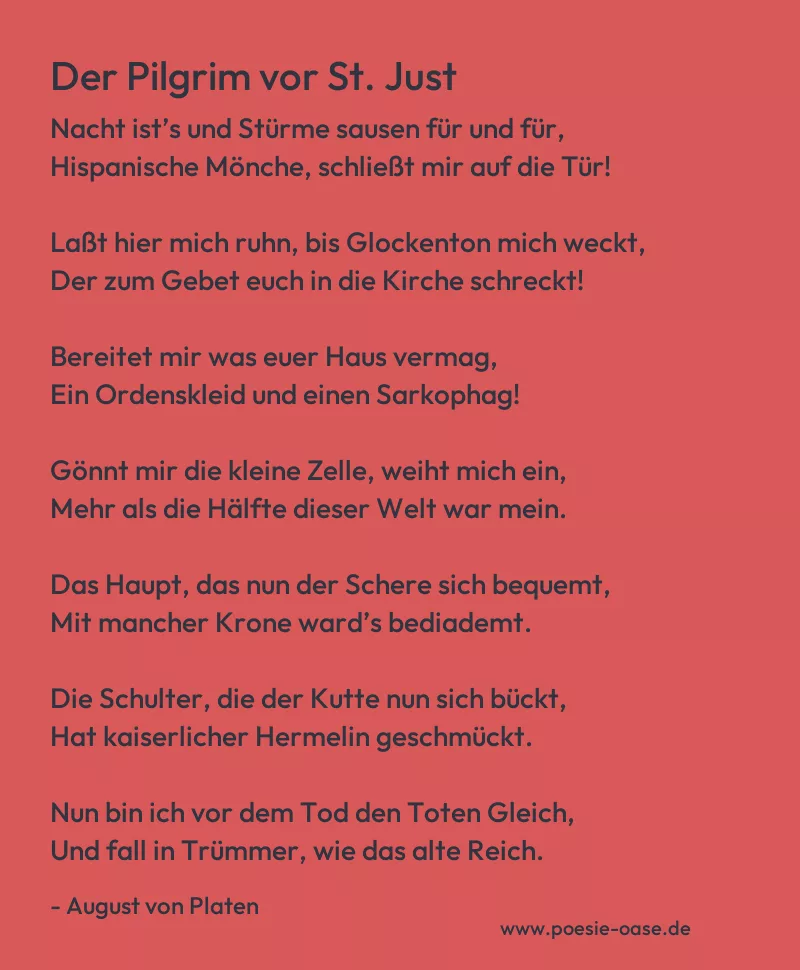
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Pilgrim vor St. Just“ von August von Platen schildert den inneren Konflikt und die Verzweiflung eines Pilgers, der sich am Ende seines Lebens dem Tod und der geistigen Einkehr nähert. Der Sprecher bittet in der ersten Strophe, inmitten von Sturm und Dunkelheit, die Mönche des Klosters um Einlass und Ruhe. Die Stürme und die Nacht, die als äußere Bedingungen genannt werden, spiegeln die innere Unruhe und das Streben des Pilgers wider, nach einer langen Reise und einer erfüllten Welt hin zur spirituellen Einkehr zu gelangen.
Der Pilger bittet nicht nur um Schutz und Ruhe, sondern fordert auch das, was ihm als letzter Trost zusteht: ein Ordenskleid, ein Sarkophag und eine kleine Zelle. Diese Wünsche, die sowohl das Leben als auch den Tod betreffen, sind symbolisch für den Übergang von weltlicher Herrschaft und weltlichem Ruhm zu einem demütigen Leben im Kloster und der Vorbereitung auf das Jenseits. Der Verweis auf den Glockenton, der zum Gebet ruft, stellt die religiöse Komponente dieses Übergangs dar, der den Pilger in das spirituelle Leben einführt und ihm die Möglichkeit gibt, sich von seiner weltlichen Existenz zu distanzieren.
Die zweite Strophe beschreibt die einstigen weltlichen Ehren des Pilgers. Der „Sarkophag“ und das „Ordenskleid“ sind dabei Symbole für den Tod und den Übergang von weltlicher Macht zu einem bescheideneren Leben im Kloster. Der Pilger reflektiert über die weltlichen Auszeichnungen, die er einst erlangte – das „Haupt, das der Schere sich bequemt“ und „mit mancher Krone“ geschmückt wurde, sowie die „Schulter“, die mit „kaiserlichem Hermelin“ geschmückt war. Diese Symbole von Macht und Status, die er nun ablegt, verdeutlichen den Wandel von weltlicher Größe hin zu einem bescheidenen Leben im Dienst Gottes und der Buße.
In der letzten Strophe wird der Pilger zu einem Symbol für den Verfall und den Übergang von der Weltlichkeit zum Tod. Der Pilger fällt in Trümmer, „wie das alte Reich“, was eine Metapher für den Zerfall seiner eigenen weltlichen Identität und Macht ist. Der „Sarkophag“ und das Ordenskleid, die für das Ende seiner Reise stehen, symbolisieren nicht nur den physischen Tod, sondern auch die Auflösung seines weltlichen „Reiches“. Diese Metapher verweist auf die Vergänglichkeit von Ruhm und Macht und die ewige, unaufhaltsame Realität des Todes, der alle Menschen, unabhängig von ihrem Status, gleichmacht. Das Gedicht endet mit einer resignierten und zugleich tief religiösen Sicht auf das Ende des Lebens und die Befreiung von weltlichen Bindungen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.