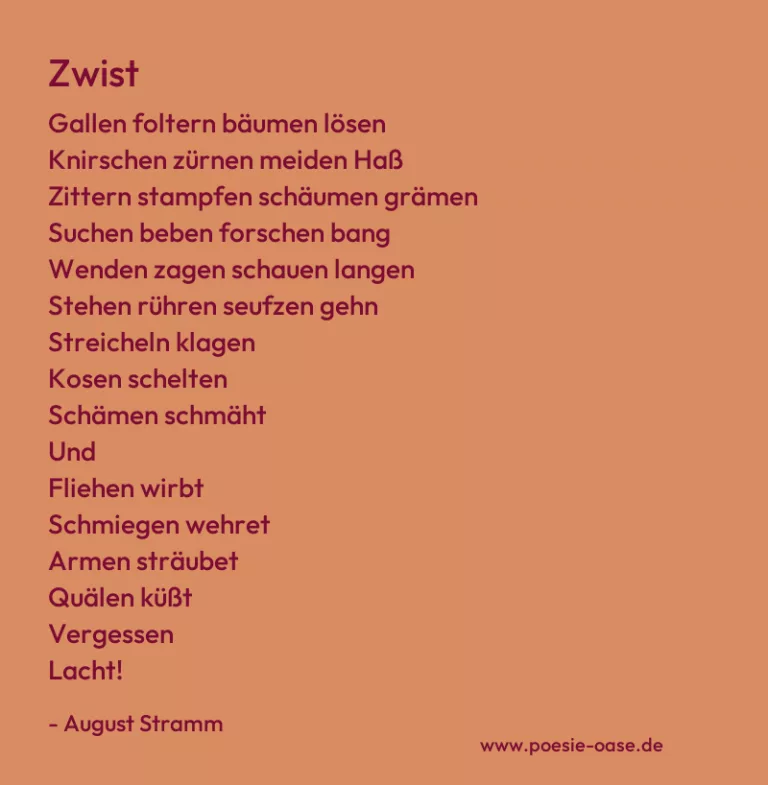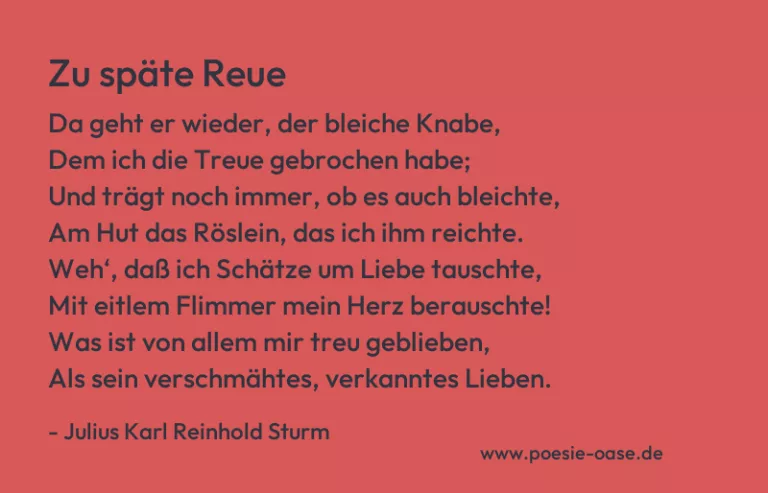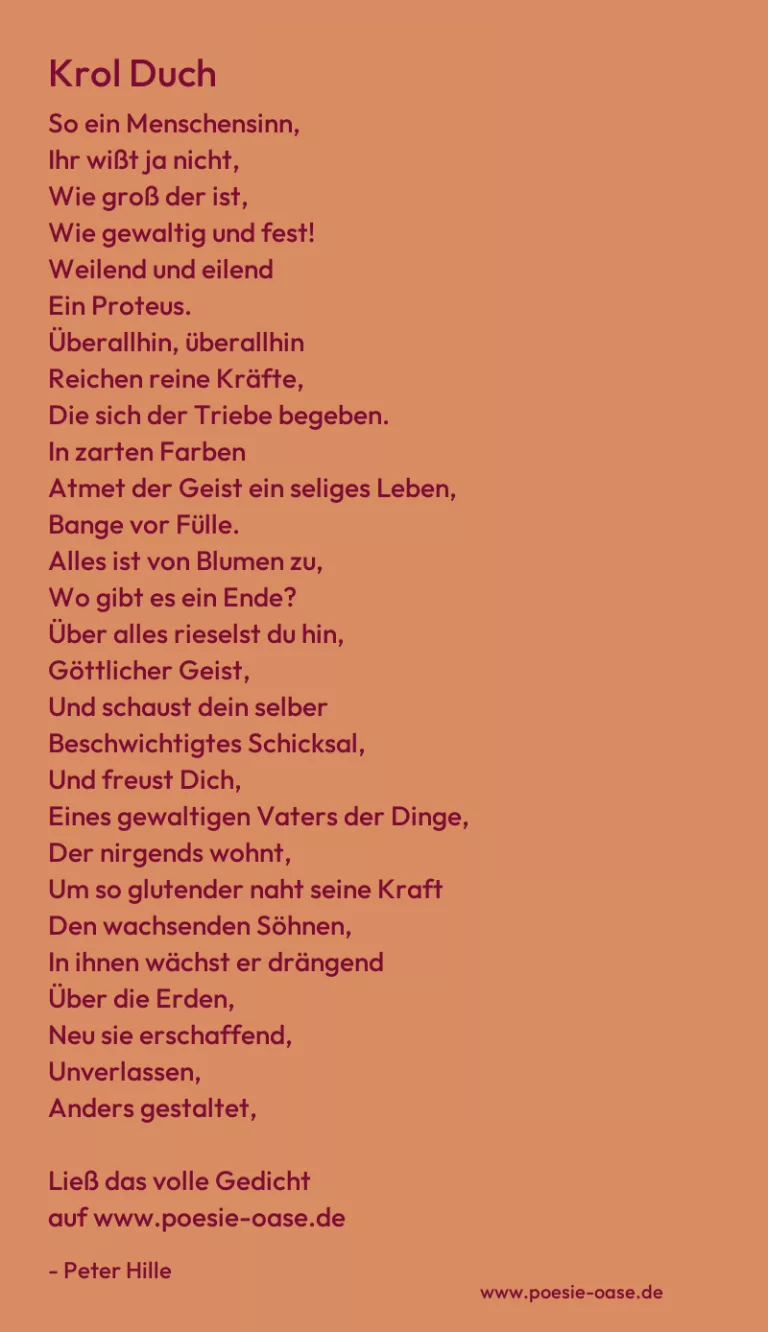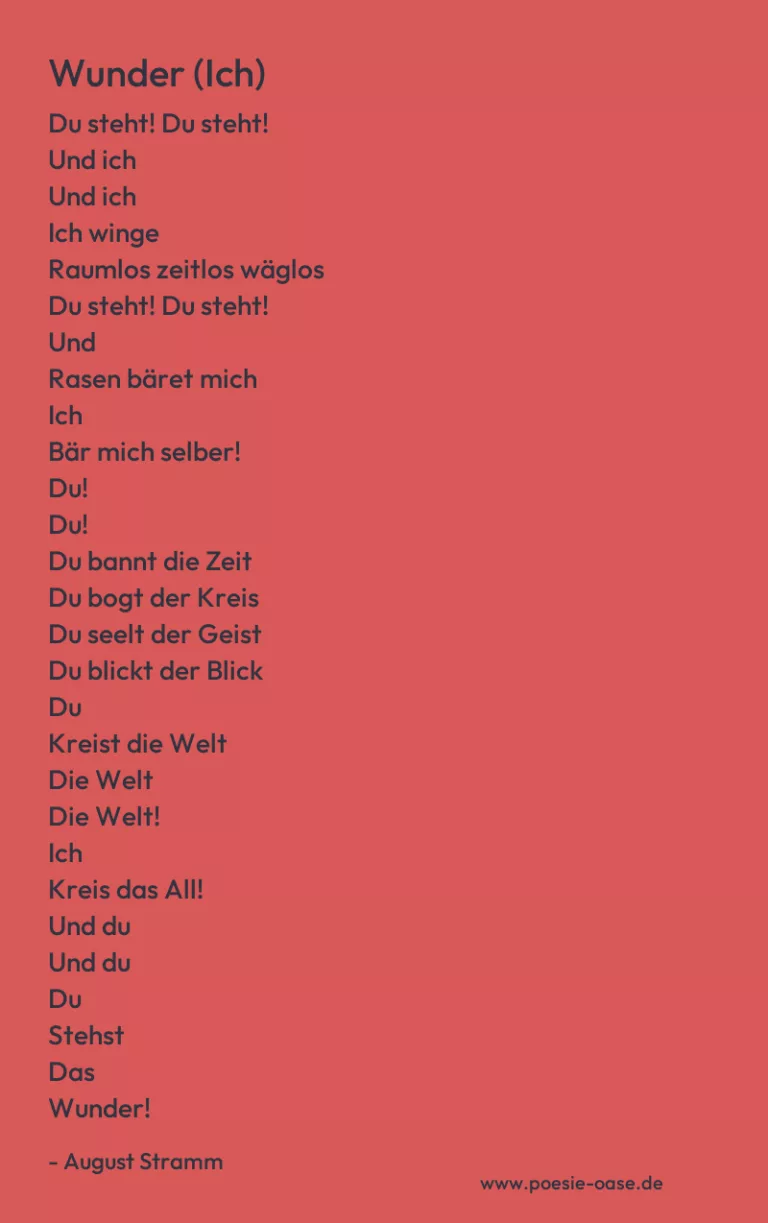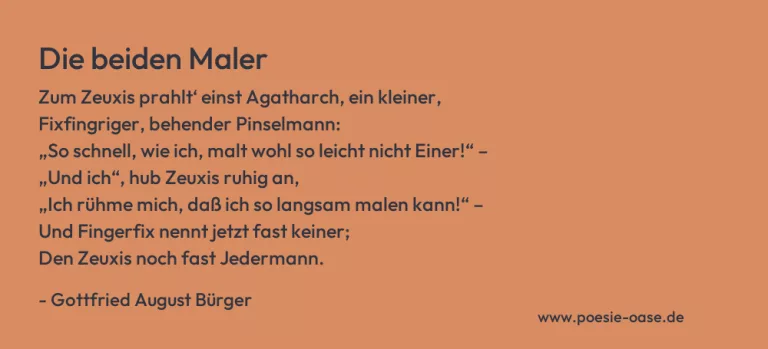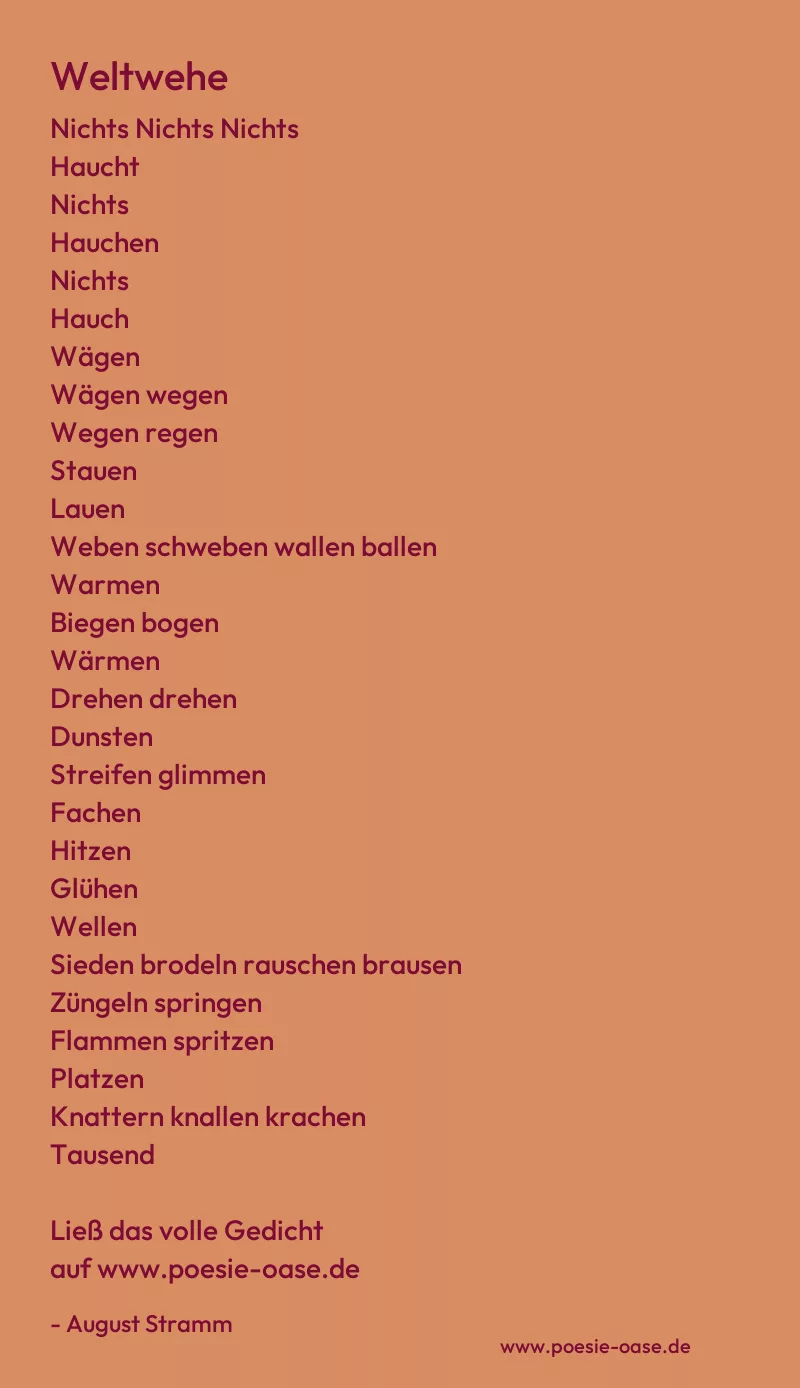Weltwehe
Nichts Nichts Nichts
Haucht
Nichts
Hauchen
Nichts
Hauch
Wägen
Wägen wegen
Wegen regen
Stauen
Lauen
Weben schweben wallen ballen
Warmen
Biegen bogen
Wärmen
Drehen drehen
Dunsten
Streifen glimmen
Fachen
Hitzen
Glühen
Wellen
Sieden brodeln rauschen brausen
Züngeln springen
Flammen spritzen
Platzen
Knattern knallen krachen
Tausend
Null Null Null
Tausend
Null
Milliarden
Null Null Null
Weißen
Lichten
Kreisen kreisen
Bahnen
Fliegen
Kreisen kreisen
Rollen
Kugeln
Kugeln kugeln
Glatten
Kugeln
Platten
Kugeln
Kreisen
Kugeln
Dichten schichten wichten walzen wälzen
Festen
Kreisen
Pressen
Kugeln
Schmieden
Kreisen
Kernen
Kugeln
Kern.
Halten fassen kraften schwingen
Ruhen reißen sprengen
Heben senken falten
Schieben wogen
Starren
Heißen
Beben
Schweißen
Beben
Leben
Atmen
Leben
Leben leben
Zeugen
Bären
Leben leben
Blühen
Wachsen
Leben leben
Brennen
Starken
Marken
Rollen rollen
Leuchten trocknen feuchten lichten
Streben ranken
Tönen
Ringen
Kämpfen
Ringen
Ringen
Können
Wollen
Können
Schwanken
Können
Wollen
Blühen
Wollen
Rollen
Können
Kranken
Placken racken ächzen
Rollen
Wollen
Lallen
Wollen wollen
Ranken
Wollen wollen
Rollen
Drehen wehen rollen
Wollen wollen
Stürmen wollen
Drehen
Matten
Wollen
Matten
Rollen drehen
Wehen wehen
Wollen
Kreisen
Engen
Kreisen
Engen
Schwanken
Wanken
Zittern
Schwingen
Wiegen kreisen engen lockern
Trudeln krudeln
Trudeln
Schlacken
Lockern
Schlacken
Bröckeln
Aschen
Trollen trollen
Aschen
Trollen trollen
Sollen
Wollen
Stocken reißen
Sacken rasen
Rasen
Sprengen
Platzen
Schmettern
Stäuben stäuben stäuben
Schweben
Weben
Wallen
Weben
Fallen
Wegen
Reigen
Wolken
Schleichen
Flaken
Weiten
Flaken
Wachten
Steinen
Nachten
Nebeln
Nachten
Weiten
Nachten nachten
Losen
Nachten nachten
Lösen
Nachten nachten
Raumen
Nachten nachten
Zeiten
Nachten
Weiten raumen zeiten
Nachten
Zeiten zeiten
Nachten
Zeiten
Nachten
Weiten
Weiten
Nichts Nichts Nichts
Nichts.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
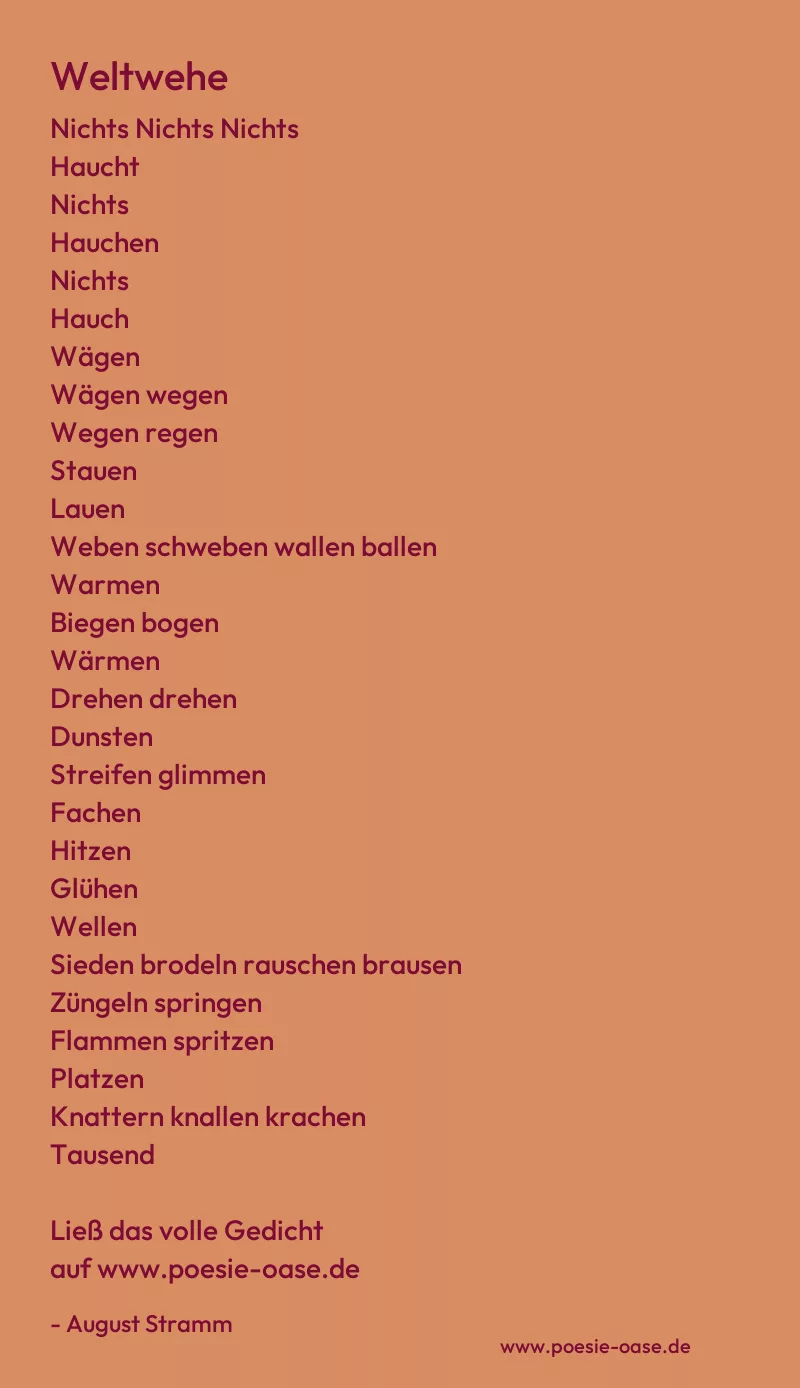
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht Weltwehe von August Stramm ist ein extremes Beispiel für den literarischen Expressionismus, insbesondere für dessen radikalste Form: die sogenannte „Wortkunst“. In dieser dicht verdichteten, fast eruptiven Sprache entwirft Stramm ein Bild von Weltentstehung, Weltdynamik und Weltvergehen, das sich sprachlich zwischen chaotischem Energieausbruch und rhythmischer Ordnung bewegt.
Die Struktur des Gedichts verzichtet auf syntaktische Sätze und klassische Metaphorik. Stattdessen arbeitet es mit einer Art Ur-Sprache aus Verben, Substantiven und Lautgruppen. Die vielfache Wiederholung, etwa von „Nichts“, „Kugeln“, „Kreisen“, „Wollen“, erzeugt eine suggestive Klangwelt, die weniger auf begriffliches Verstehen als auf körperlich-emotionale Wirkung zielt. Der Text scheint ein Universum zu entwerfen, das sich aus der Leere heraus in Bewegung setzt, Materie bildet, sich verdichtet, lebt, kämpft – und schließlich wieder in Auflösung übergeht.
Das Gedicht lässt sich als eine kosmische Evolution lesen: Vom „Nichts“ entfaltet sich über „Flammen“, „Kugeln“, „Schmieden“, „Kernen“ und „Leben“ eine Steigerung hin zur organischen Welt, in der „Leben leben“, „kämpfen“, „wollen“. Es ist ein Naturbild, das gleichermaßen mechanisch wie vital erscheint. Energieformen – Hitze, Rotation, Druck – mischen sich mit biologischen Prozessen wie „Atmen“, „Wachsen“, „Zeugen“. Dieses Weltbild ist weder teleologisch noch harmonisch: Es ist ein ständiger Kampf, ein „Placken“, „Ringen“, „Ächzen“, das letztlich in „Aschen“, „Schlacken“, „Trollen“ mündet.
Zugleich zeigt sich eine zyklische Bewegung. Der Text oszilliert ständig zwischen Entstehen und Vergehen, zwischen Bewegung und Stillstand. Worte wie „rollen“, „kreisen“, „drehen“ durchziehen das Gedicht und unterstreichen diese Dynamik. Doch am Ende steht erneut das „Nichts“ – das Anfang und Ende zugleich ist. Diese kosmische Spirale wirkt erschöpfend und existenziell: Der Mensch ist Teil eines grandiosen, gleichgültigen Weltmechanismus, dessen Schönheit, Gewalt und Vergänglichkeit in der Sprache selbst widerhallen.
Weltwehe ist damit nicht einfach nur ein Naturgedicht, sondern eine poetische Verdichtung von Energie, Evolution und Verfall – eine Art Schöpfungsepos im Zeitraffer. In seiner Sprachgewalt und formalen Radikalität formuliert es eine existentielle Weltschau, die den Menschen als Teil eines unaufhörlich pulsierenden und zerfallenden Kosmos begreift.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.