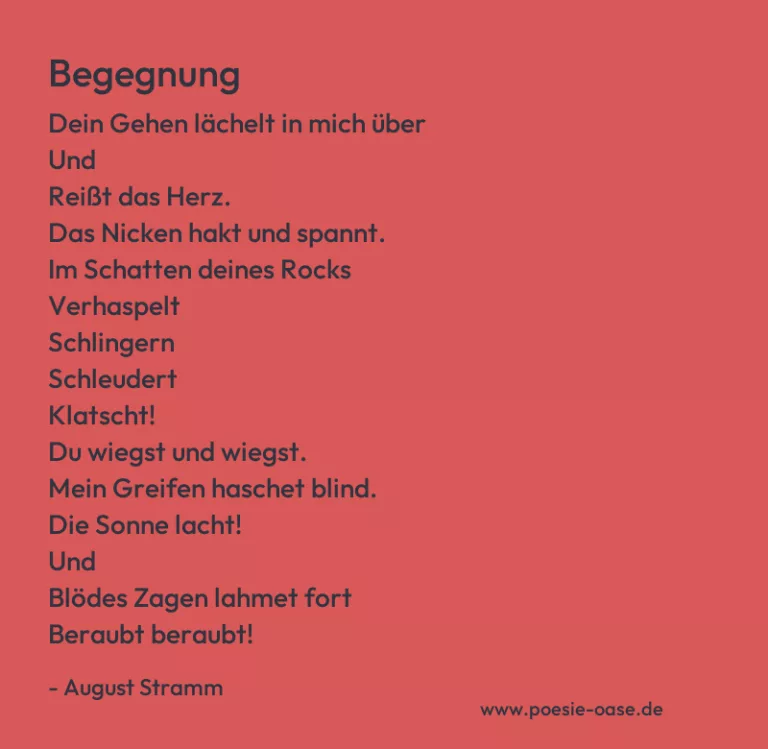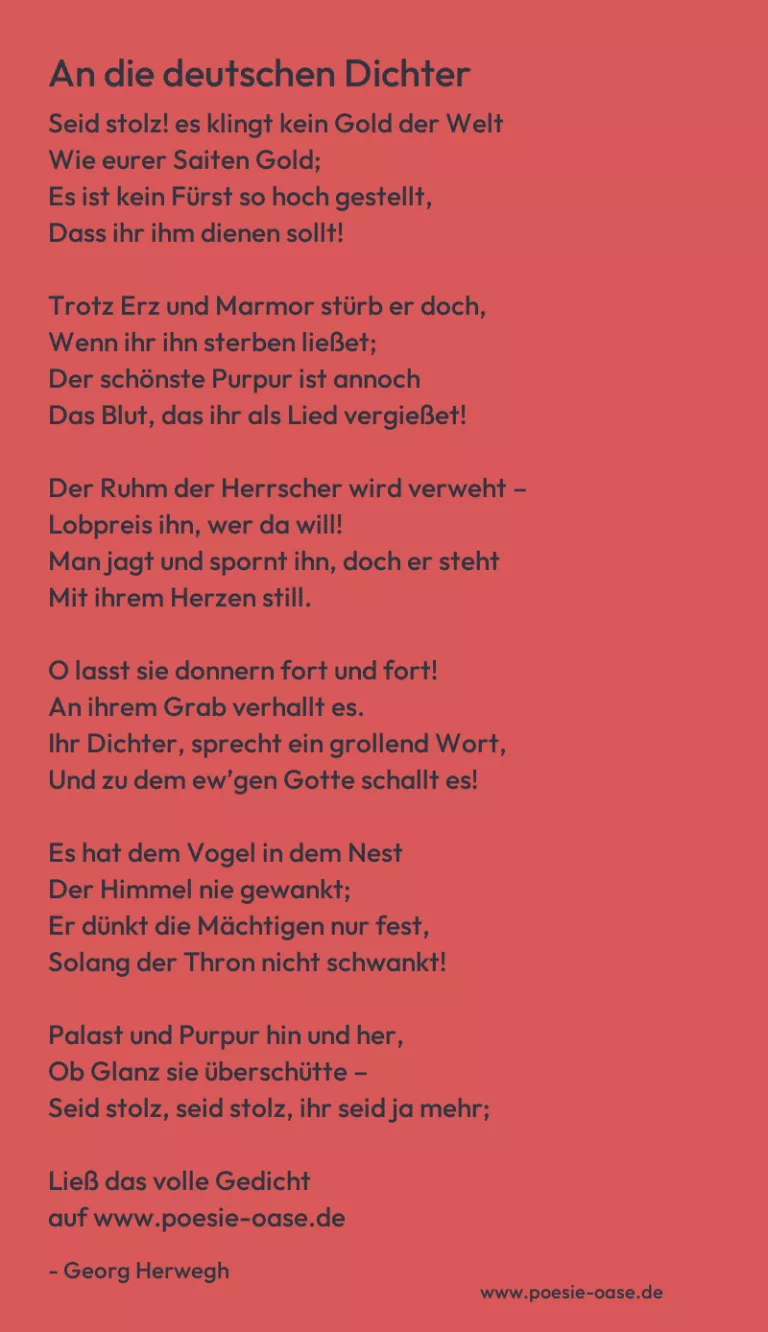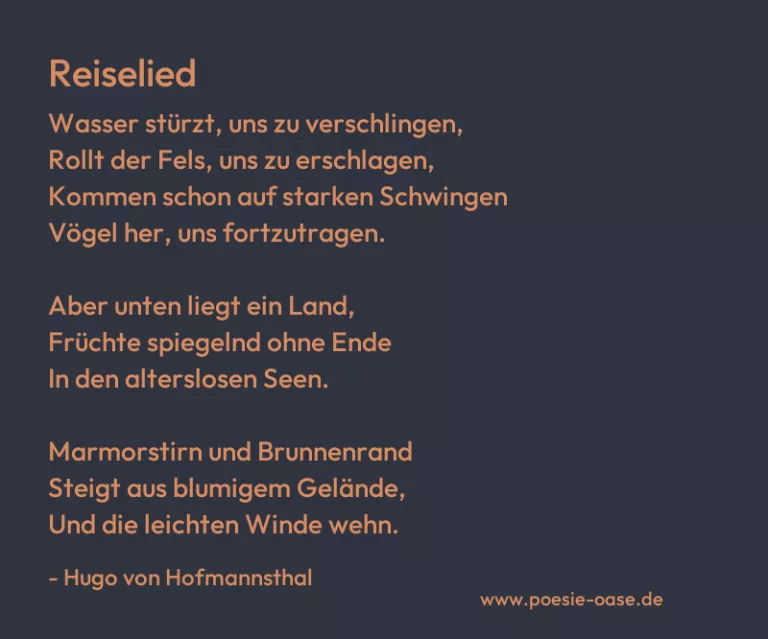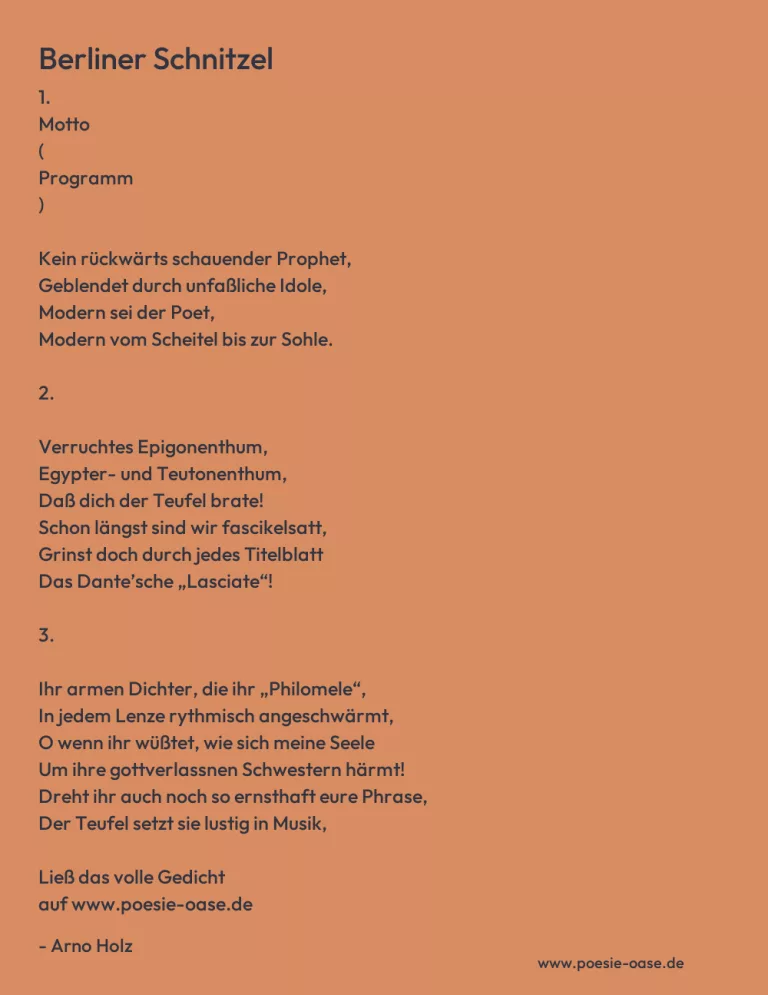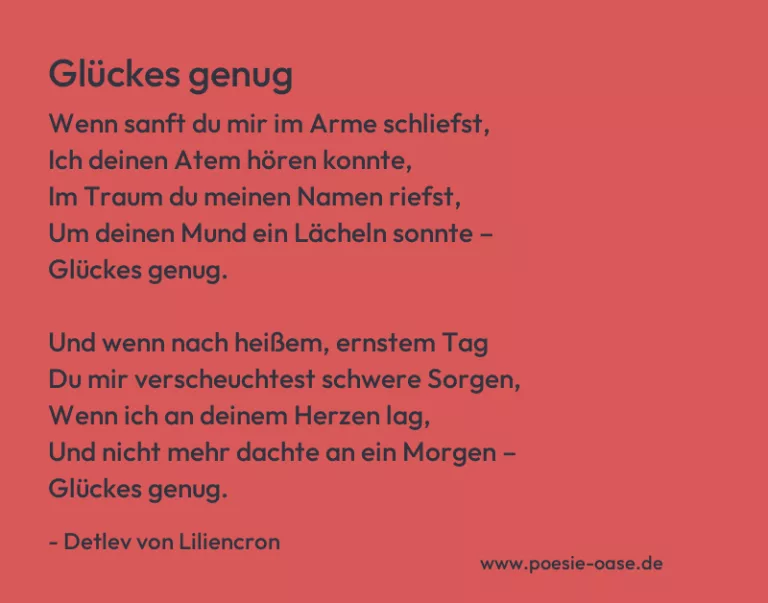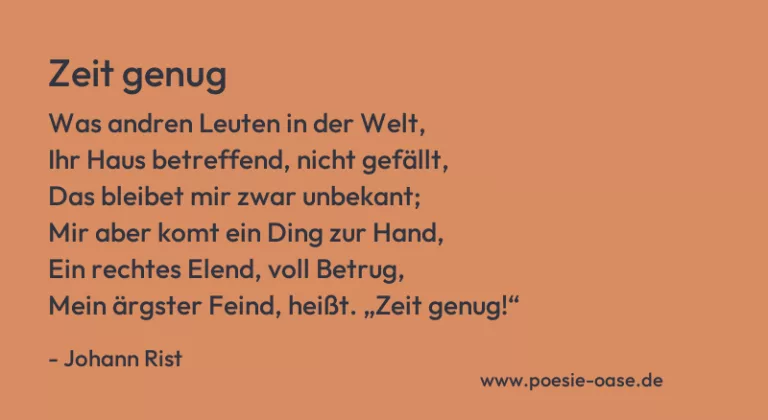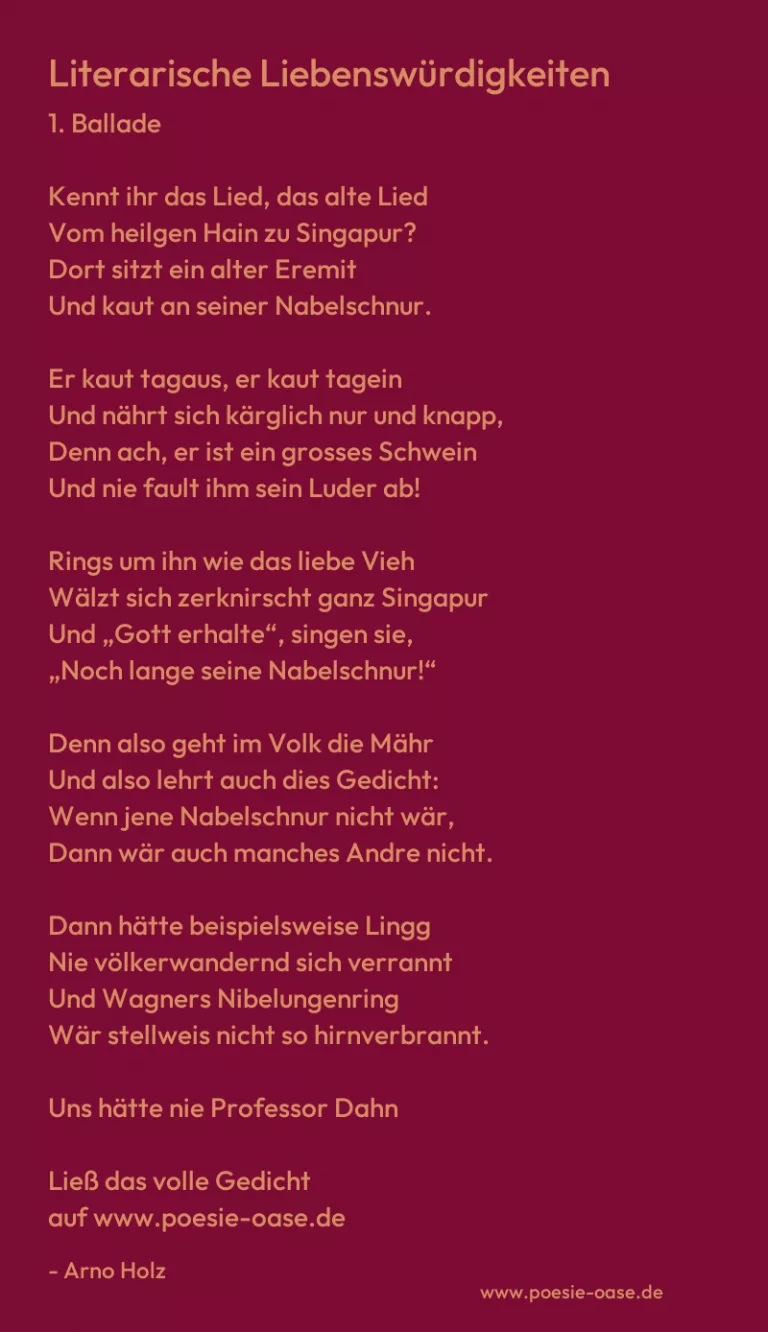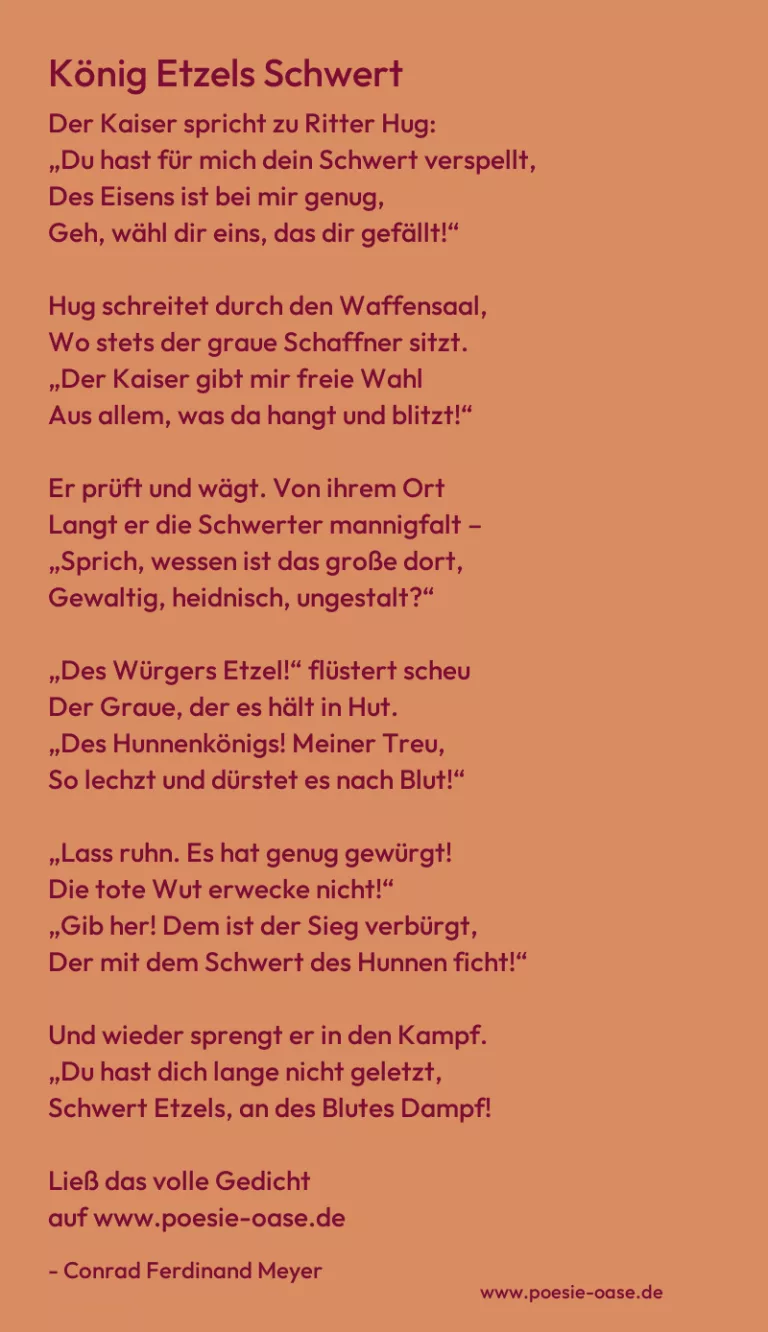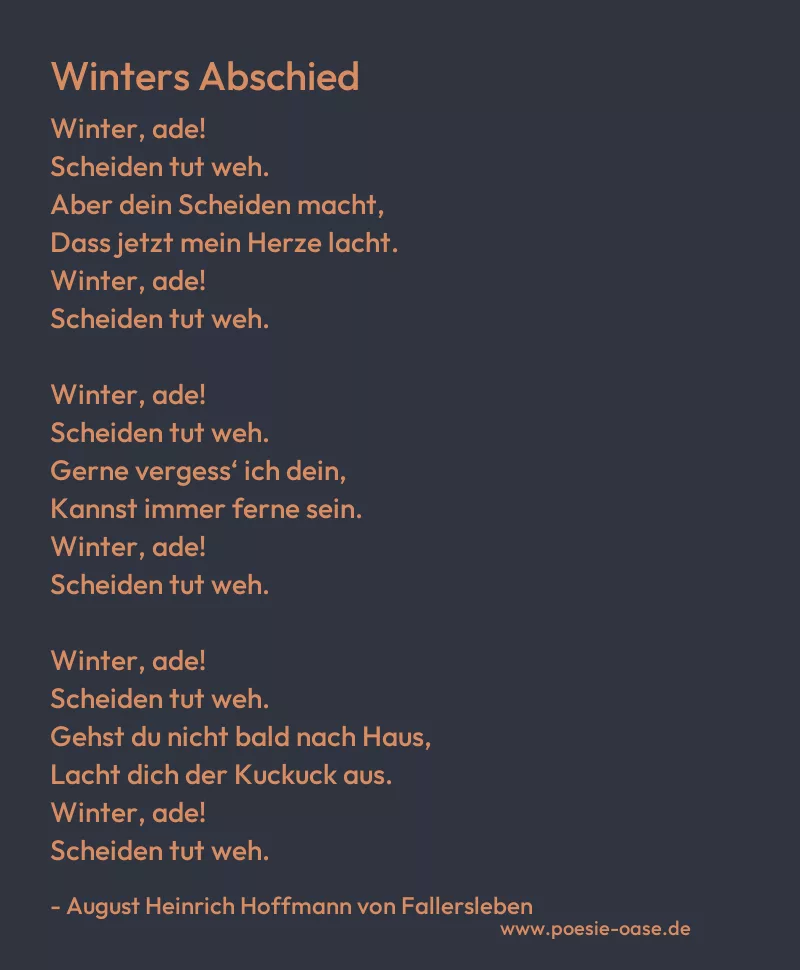Winters Abschied
Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Aber dein Scheiden macht,
Dass jetzt mein Herze lacht.
Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Gerne vergess‘ ich dein,
Kannst immer ferne sein.
Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Gehst du nicht bald nach Haus,
Lacht dich der Kuckuck aus.
Winter, ade!
Scheiden tut weh.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
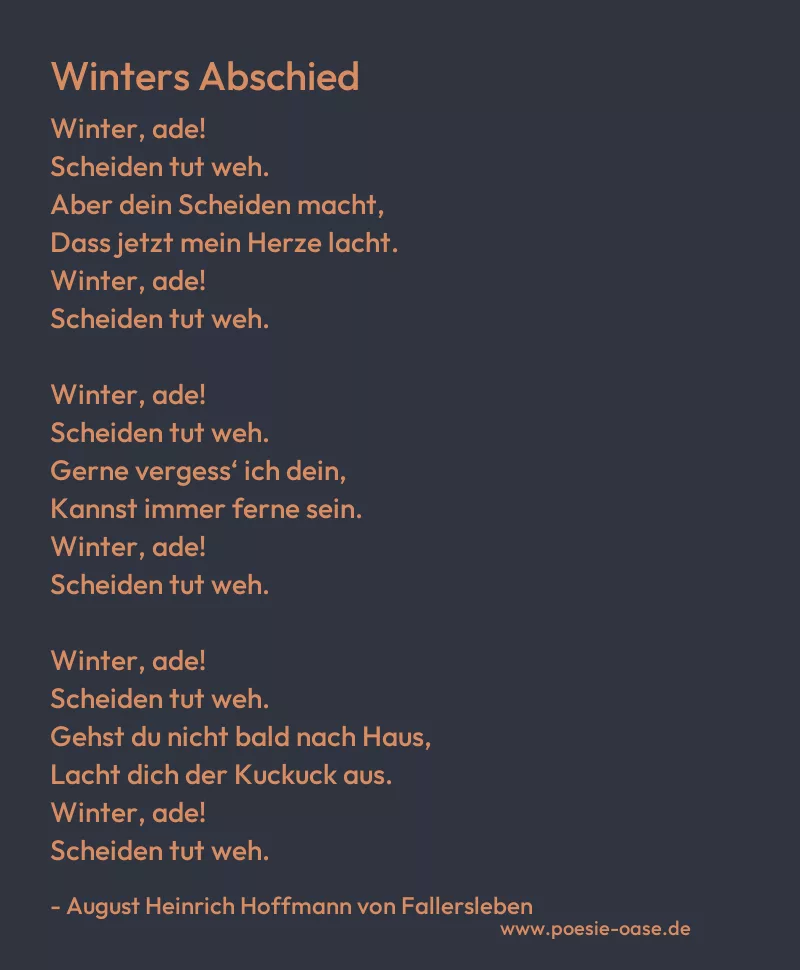
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Winters Abschied“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben ist ein heiteres, volksliedartiges Stück, das den Abschied vom Winter mit einer Mischung aus Ironie, Erleichterung und kindlicher Freude inszeniert. Trotz der wiederholten Klageformel „Scheiden tut weh“ wird das Ende des Winters keineswegs betrauert – im Gegenteil, es wird regelrecht gefeiert.
Die strophische Struktur mit der sich wiederholenden Eingangslinie und dem Kehrvers verleiht dem Text einen rhythmischen, liedhaften Charakter. Dieser Aufbau unterstützt die volkstümliche Einfachheit und macht das Gedicht leicht einprägsam – nicht zufällig wurde es auch vertont und ist als Kinderlied bekannt. Die Sprache ist bewusst schlicht gehalten, fast spielerisch, was dem Gedicht einen fröhlichen, zugänglichen Ton verleiht.
Inhaltlich zeigt sich eine klare Umkehrung der üblichen Abschiedsklage: Zwar wird betont, dass Abschiednehmen „weh“ tut, doch bezieht sich das eher auf die Form denn auf das Gefühl. Tatsächlich löst der Abschied des Winters Freude aus – das Herz „lacht“, der Winter darf „gerne vergessen“ sein, ja er wird sogar verspottet („lacht dich der Kuckuck aus“). Der Winter steht hier sinnbildlich für Kälte, Dunkelheit und Starre, die nun der Lebendigkeit des Frühlings weichen.
Der Text lebt von dieser Spannung zwischen der scheinbar traurigen Formel und der freudigen Haltung, die sich dahinter verbirgt. Durch diese Ironisierung wird die Jahreszeitenwende nicht nur als natürlicher Zyklus dargestellt, sondern auch als Moment des Neubeginns, in dem Lebensfreude und Hoffnung spürbar werden. So wird das Gedicht zur kleinen, lebensbejahenden Allegorie auf das Ende des Dunklen und die Rückkehr des Lichts.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.